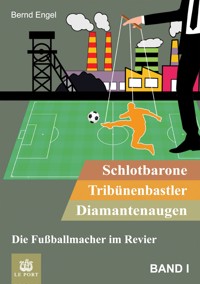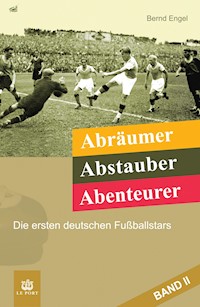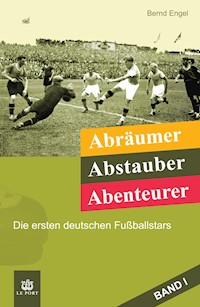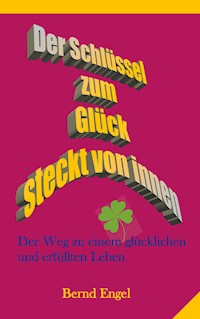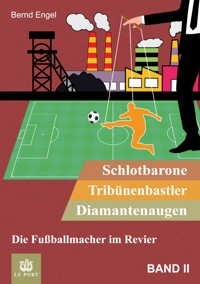
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Schlotbarone, Tribünenbastler, Diamantenaugen.
- Sprache: Deutsch
Geht man der Frage nach, wer die Fußballvereine im Ruhrgebiet in den letzten 100 Jahren groß gemacht hat, kommt man an diesen zwölf Männern kaum vorbei. Es sind Männer mit Sachverstand, Ehrgeiz, aber auch mit Charisma und Selbstbewusstsein. Letzteres war nicht unwichtig, denn die spezifische, mitunter raue Fußballkultur des Reviers erforderte ein dickes Fell und Nehmerqualitäten. Die hier porträtierten Vereinslenker bieten in Sachen Temperament und Selbstverständnis eine ordentliche Bandbreite an. Vom fröhlichen Daueroptimisten über den beinharten Krisenmanager, den smarten, umsichtigen Socializer bis hin zum Patriarchen alter Schule – alles ist dabei. Auch die Wege ins Amt waren unterschiedlich. So gab es ehemalige Aktive, die ihrem Verein verbunden blieben und schließlich an die Spitze rückten, ortsansässiges Bürgertum, das gegen mehr Bekanntheit, mehr Renommee, mehr Kundschaft nichts einzuwenden hatte, oder auch klassische Selfmade-Mittelständler, die mit dem Erreichen und Sichern ihrer ökonomischen Ziele ihrem emotionalen Haushalt etwas Gutes tun wollten Sie alle verstanden die Seele der Vereine; beherrschten instinktiv die Gefühlswelt der Mitglieder und Fans. Ihre Arbeit zeichnete sich durch Ideen, Eloquenz, Hartnäckigkeit, Bauernschläue aus. Ihre Pläne und Projekte, egal ob es um Aufstieg, Meisterschaft, Stadionbau oder Nachwuchsförderung ging, wurden zu Quantensprüngen. Oder zu Rohrkrepierern. Mit Mittelmaß gaben sie sich nur selten zufrieden. Dafür war zu viel Herzblut und manchmal auch ein wenig Eitelkeit im Spiel. Porträts in Band II: Georg Melches Erhard Goldbach Dr. Gerd Niebaum Klaus Steilmann Günter Eichberg Hans-Joachim Watzke
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 653
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Bernd Engel
Schlotbarone, Tribünenbastler, Diamantenaugen.
Die Fußballmacher im Revier
Band II
© 2023 Bernd Engel | Le Port
ISBN Softcover: 978-3-347-98435-6
ISBN Hardcover: 978-3-347-98436-3
ISBN E-Book: 978-3-347-98437-0
Druck und Distribution im Auftrag :
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Bild auf dem Umschlag:
©Open-Clipart–vectors / pixabay.com (149241, 154904, 2023250, 157930), ©Clker–Free–Vector– Images / pixabay.com (40620), ©Mohammed–hassan / pixabay.com (5926178, 4254951)
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Charismatische Führung
Die vorliegenden zwölf Porträts…
Ein Dankeschön
Georg Melches
Gründer und Antreiber: Alles begann hinter dem Gartenzaun
Fußballanfänge in Essen
Erster Weltkrieg
Berufliche Schritte nach WK I
Ende der Spielerlaufbahn
Entwicklung zum Funktionär
NS-Zeit und Gauliga
Neustart nach dem Krieg
Sportlich zurück in die Spur
Die großen Jahre beginnen
DFB-Pokal 1953, Deutscher Meister 1955
DFB-Pokal
Es geht bergab
Mit den Didier-Werken im Wirtschaftswunderland
Rückzug und Abschied
„Stahl und Kohle formten den Verein…“
Letzte Ruhestätte auf dem Matthäusfriedhof
Erhard Goldbach
Der Ölkönig und seine Luftschlösser: Ein barockes Leben mitten im Ruhrgebiet
Einstieg ins Tankstellengeschäft
Ein Mann namens Birkenkämper
Goldbach entdeckt die Westfalia
Erste Turbulenzen
Erste Verdachtsmomente
Besondere Zeiten führen zu besonderen Maßnahmen
Protektion von höchsten Stellen
Das große Finale
Unruhe bei der Westfalia
Verhaftung und Gerichtsurteile
Erfolglose Schatzsuche
Dr. Gerd Niebaum
Schwarz-gelbe Renaissance mit dramatischem Ende: Zwischen Möller und Molsiris
Eine Jugend im östlichen Ruhrgebiet
Über Münster in die Juristerei
Der schnelle Weg zum BVB
Troubleshooting 1984
„Nur kurz in die Bücher gucken…“
Sanierung im Eilverfahren
Mit dem PAL-System zum nächsten Hitchcock-Krimi
Die Relegation als Wendemarke
Rauball geht, Niebaum übernimmt
Der BVB startet durch
Ein schlafender Riese erwacht
Mit Euphorie in die nächste Saison
Ein Lünener findet einen Lünener
Beginn der Hitzfeld-Ära: Über die Fast-Meisterschaft…
…zum ersten Duell mit Juve
Mit Möller und César auf Meisterkurs
Gelungene Titelverteidigung
Die Besteigung des europäischen Throns
Hitzfeld geht – und bleibt doch
Niebaum auf dem Gipfel
Die Börse im Blick
Ein junges Gesicht auf der Trainerbank
Retter-Duo Lattek und Sammer
Der Börsengang
Offensive auf und neben dem Spielfeld
Warnsignale
Saison 2002/03 ohne Happy End
Endgültige Entschleierung
„Die Party ist aus“
Homm macht’s Möglich
Rauball kehrt zurück
Der 14. November 2004
Niebaums endgültiger Abschied
Wendepunkt 14. März
Rückkehr in das zivile Berufsleben
Zehrende Mietstreitigkeiten
Stippvisite zum Jubiläum 2009
Verlust der juristischen Titel
Betrug, Untreue, Urkundenfälschung
Rückzug ins Privatleben
Klaus Steilmann
Zwischen Laufsteg und Lohrheide: Für Millionen, nicht für Millionäre
Ausbildung und Berufseinstieg
Start in die Selbständigkeit
Steilmann lernt die SGW kennen
Fußballanfänge in Wattenscheid
Nachkriegszeit
Umzug in die Lohrheide
Ausweitung des Wattenscheider Engagements
Ankunft in der Regionalliga
Familienvater Klaus Steilmann
Kampf um die kommunale Selbständigkeit
„Vollprofi ist doch nur etwas für Verrückte“
„Gammler kann ich nicht gebrauchen“
Bongartz geht, Babington kommt
Wechselhafte Jahre in der 2. Bundesliga
Europas führender Textilkonzern trifft Karl Lagerfeld
Bongartz kehrt zurück
Vier Jahre Eldorado
Hartmann Löst Bongartz ab
Neustart mit Briegel
Paradigmenwechsel in der Steilmann-Gruppe
Einstieg der Töchter
Veränderter Weltmarkt
Niedergang der SGW
Strukturelle Hilfen für Leichtathleten und Sportgymnasten
Niedergang der Steilmann-Gruppe
Schlussakkord in 2009
Günter Eichberg
AOK-Lehrling, Kurdirektor, Klinik-Chef, Schalke-Präsident: Ein Aufstieg in Westfalen
Wurzeln in Gütersloh und Haltern
Die AOK als Sprungbrett
Eichberg trifft Olsberg
Wenn Krampfadern zu Goldadern werden…
Erste Übungen als Fußballsponsor
Von Gütersloh nach Düsseldorf
Triumph auf Schalke mit kurzem Anlauf
Start mit Hindernissen
Neururer kam, sah und rettete
Neue Strukturen, neue Köpfe
Das sportliche Reifejahr
Aufstieg trotz Trainer- und Transfer-Turbulenzen
Eichbergs Nachwuchsinitiative
Klassenerhalt mit personellem Aderlass
Gedankenspiele rund um eine neue Arena
Mit Lattek in die nächste Saison
Die mysteriöse Marketing GmbH
Privates Tohuwabohu
Neubesetzung der Schlüsselpositionen
Ein Scheinangebot?
Der Feuerwehrmann kommt, der Präsident geht
Ein irritierender Blick in den Spiegel
Schreiben, was ist?
Tönnies stilisiert sich zum Retter
Berger schafft den Klassenerhalt
Das Ende eines Klinik-Imperiums
Rückkehr nach Deutschland
Bürgermeister in Bad Bertrich
Wieder daheim in Gütersloh
Mailänder Missklänge
Sommer 2018: Es geht zu Ende
Hans-Joachim Watzke
Der schwarz-gelbe Leuchtturmwärter: Sanierungshilfe aus dem Sauerland
Heimat Erlinghausen
Zeitgeist und Parteipolitik in den Siebzigern
Abstieg, Goldgrube, Dauerkarte
Hochzeit und Berufseinstieg
Vom Angestellten zum Unternehmer
Annäherungen
Im Sog der Krise
Erste Warnzeichen
Westfalenstadion – von der Goldgrube zur Fallgrube
Weiter geht die wilde Fahrt
Dramatisches Ende der Niebaum-Ära
Retter Reinhard Rauball
In Erlinghausen klingelt das Telefon
Entscheidender Termin in Düsseldorf
Die Basics der Sanierung
Die Neustrukturierung
Die merkliche Entlastung
Relative Ruhe im sportlichen Bereich
Ein misslungener Abschied und seine Folgen
Berg- und Talfahrten mit Thomas Doll
Klopp unterschreibt
TV-Gelder und Traditionsvereine, die Erste
Die Meisterjahre
Eintagsfliege oder mehr?
Jubel, Double, Heiterkeit
Bayerns dritter Anlauf
TV-Gelder und Traditionsvereine, die Zweite
Bayerischer Backlash
Last Exit London
Schwarz-gelbe Weltmeister
TV-Gelder und Traditionsvereine, die Dritte
Der Klopp-Peak ist überschritten
Die Tuchel-Jahre
Der Anschlag
Die ewige Suche nach dem neuen Klopp?
Geduldsprobe Favre
Pokalsieg mit Terzić
Die duale Transferstrategie
Schwierige Gemengelage – national wie international
Watzkes Überlegungen auf der Meta-Ebene
Auf den Spuren Reinhard Rauballs
Literaturangaben /Bildverzeichnis
Sie Möchten die Dosis erhöhen?
Schlotbarone, Tribünenbastler, Diamantenaugen
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Sie Möchten die Dosis erhöhen?
Schlotbarone, Tribünenbastler, Diamantenaugen
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
Vorwort
Superlative müssen nicht bemüht werden, aber es gibt ihn schon, den spezifischen Charme des Revierfußballs. Ein Charme, der sich aus verschiedenen Quellen speist. In den Anfangsjahrzehnten war es die identitätsstiftende Funktion der Vereine – speziell für die zugewanderten Arbeitskräfte im Ruhrgebiet. Das damit aufkommende Wir-Gefühl wurde verstärkt durch die gemeinsame Errichtung der ersten Fußballplätze, unterstützt von den Arbeitgebern, den Zechen und Hüttenwerken vor Ort. Die „Straßenbahnnähe“ der Konkurrenz sorgte zudem für Trennschärfe gegenüber anderen Vereinen.
In der Nachkriegszeit war es der auffällige Kontrast zwischen der Flutlicht-Glitzerwelt Profifußball und dem grauen Industriealltag, der den Revierfußball zu etwas Besonderem machte. Und gegen Ende des 20. Jahrhunderts sorgte ein gewisser Underdog-Trotz für den Unterschied. Es war der robuste und entschlossene Trotz einer Region, die sich in einem tiefgreifenden Strukturwandel befand und sich mit Haut und Haaren gegen den gleichzeitigen Niedergang ihrer Traditionsvereine wehrte – meist mit Erfolg.
Schließlich gibt es noch als zeitlose Eigenheit die tradierte Liebe zum Verein, frei nach der „Borussia“-Liederzeile „als Kind bin ich mit meinem Vater gekommen, und der wurd' auch schon von seinem mitgenommen…“ (Bruno Knust). Damit wird der von Fußball-Hipstern häufig zitierten Theorie Nick Hornbys, „Du suchst Dir nicht Deinen Verein aus, sondern Dein Verein sucht sich Dich aus“, doch gleich mal ein Riegel vorgeschoben. Denn solche elementaren, den Familienfrieden nachhaltig beeinflussenden Richtungsentscheidungen überlässt der Fan zwischen Duisburg und Dortmund nur ungern dem Zufall. So entstanden über die Jahrzehnte im Revier äußerst stabile, belastbare Beziehungen zu den jeweiligen Klubs. Beziehungen, die noch eine Spur intensiver und humorloser gelebt werden als anderswo in der Republik.
Charismatische Führung
Zu den Präsidentenämtern zog es markante, selbstbewusste Persönlichkeiten, die es sich zutrauten, ihre Vereine mutig durch die Fährnisse eines oft rasanten Liga-Alltags zu steuern. Es waren durchsetzungsstarke Männer mit ehrgeizigen Zielen. Sie verstanden die Seele ihrer Vereine, beherrschten die Tastatur der Fan-Emotionen. Dabei waren sie bestens vernetzt und besetzten auch rasch und ohne falsche Koketterie die Entscheiderebene. Ihre Arbeit zeichnete sich durch Ideen, Volksnähe, Eloquenz, Hartnäckigkeit und auch einen Schuss Bauernschläue aus. Ihre Pläne und Projekte, egal ob Aufstiege, Meisterschaften, Stadionbau oder Nachwuchsförderung, wurden zu Quantensprüngen. Oder zu Rohrkrepierern. Mit Mittelmaß gaben sie sich nur selten zufrieden. Dafür war zu viel Herzblut, zu viel Ambition und bisweilen auch etwas zu viel Eitelkeit im Spiel.
In Sachen Temperament oder auch Selbstverständnis gab es eine ordentliche Bandbreite. Vom fröhlichen Daueroptimisten über den beinharten Krisenmanager, den smarten, umsichtigen Socializer bis hin zum Patriarchen alter Schule. Der letztgenannte Typ dominierte in den Nachkriegsjahrzehnten, als sich die Bundesrepublik von einer aufstiegswilligen „das Brot der frühen Jahre“-Gesellschaft in eine anspruchsvolle Wohlstandsgesellschaft wandelte. In dieser Zeit waren die Vereine noch eingetragene Vereine, bildeten eine reine Männerdomäne und wurden ehrenamtlich geführt. Wahl und Inauguration erfolgten in temperamentvollen, alkoholschwangeren Versammlungen. Wer mit frisch geschmiedeten Allianzen und Bierzelt-kompatibler Rhetorik aufwarten konnte, der hatte gute Karten. Denn von einem Präsidenten wurden Kreativität, Kontaktfreude, Robustheit und Macherqualitäten erwartet. Später, mit steigenden Ablösesummen und Gehältern, galt auch eine dicke Brieftasche als willkommene Begleiterscheinung.
Die Vorleben der in diesem Buch porträtierten Männer fallen sehr unterschiedlich aus. Es gab ehemalige Aktive, die ihrem Verein verbunden blieben und schließlich auf der Vorstandsetage ankamen. Es gab ortsansässiges Bürgertum, das gegen mehr Bekanntheit, mehr Renommee, mehr Kundschaft nur wenig einzuwenden hatte. Und es gab klassische Selfmade-Mittelständler, die nach Erreichen und Sichern ihrer ökonomischen Ziele ihrem emotionalen Haushalt etwas Gutes tun wollten. Egal, welcher Weg ins Amt führte, einen geordneten Rückzug schafften am Ende nur wenige – was schade ist. Denn die meisten haben unter dem Strich enorme Verdienste, die oft erst Jahre später (an)erkannt wurden. Zu dieser Anerkennung möchte auch dieses Buch einen kleinen Beitrag leisten.
In den Neunziger- und Nullerjahren änderten sich vielerorts die Vereinsstrukturen. Die meisten Vereine verwandelten sich in Kapitalgesellschaften mit entsprechenden Aufsichtsgremien. Ein rapides Umsatzwachstum und ein damit einhergehendes breiteres Aufgabenspektrum sorgten für arbeitsteilige Strukturen mit neuen starken „Mitspielern“ im Management oder in den Aufsichtsräten. Für einen charismatischen oder gar patriarchalischen Führungsstil blieb da nur noch wenig Spielraum. Romantiker beklagen eine Technokratisierung des Fußballs. Das mag teilweise stimmen. Doch der Autor ist sich sicher: Solange grüner Rasen, ausverkaufte Stadien und gleißendes Flutlicht vor Industriekulisse für ein faszinierendes Flair sorgen, wird es auch weiterhin schillernde Persönlichkeiten, Männer wie Frauen, geben, die es zu den Traditionsvereinen an der Ruhr drängt.
Die vorliegenden zwölf Porträts…
…beschränken sich auf Präsidenten und Personen, die von Vereinsversammlungen gewählt wurden; Angestellte bleiben außen vor.
…sind eingebettete Geschichten, die den Hauptscheinwerfer auf die Amtszeit der jeweiligen Hauptperson richten, gleichzeitig aber auch das Vor- und Nachleben, das berufliche Umfeld, den Verein, die Stadt, die Zeit, die familiäre Situation so weit ausleuchten, dass es zu einem besseren Verständnis der Person beiträgt.
…erheben keinen wissenschaftlichen Anspruch im Sinne formaler Akkuratesse. Die Lesefreundlichkeit genießt Priorität. Trotzdem gibt es zu den neuralgischen Passagen und direkten Zitaten – diese werden durch Anführungszeichen und Einrückung kenntlich gemacht und stets eins zu eins inklusive eventueller Fehler wiedergegeben – konkrete Quellenangaben. Entweder unmittelbar im Text oder als Fußnote. Auch Erläuterungen und „sachdienliche“ Hintergrundinformationen werden, wenn es als notwendig erachtet wird, als Fußnote angeführt. Literaturverzeichnisse und Bildnachweise im Anhang sind selbstverständlich.
…könnten visuell vielleicht etwas opulenter ausfallen. Doch die Bild- und Fotobeschaffung ist bei einem Low-Budget-Rahmen und einem recht rigiden Urheberrechtsgesetz in Deutschland nicht so einfach. Bilder mit CC-Lizenz, Digitalisate von historischen Zeitungen, eigene Fotos und einzelne, private Sondergenehmigungen ließen am Ende eine einigermaßen befriedigende Bildauswahl zu.
…sind in ihrem Hauptstrang im historischen Präsens geschrieben, was sie, so die Hoffnung, einen Tick frischer, unmittelbarer macht.
…folgen weitgehend einem chronologischen Faden, trotz gelegentlicher Lasso-Einstiege und kleinerer Exkurs-Einschübe.
Ein Dankeschön
Zu einigen Porträts tauchte bei den Recherchen doch noch die eine oder andere Frage auf. Zumeist erhielt der Autor von den Hauptpersonen selbst, von Familienmitgliedern oder Fachleuten bereitwillig Auskunft, so dass an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön gehen soll an
• Heinrich Hellmich (Hellmich Transporte GmbH) und Walter Hellmich (Hellmich-Gruppe), die mir Einblicke in die durchaus komplexe Familiengeschichte der Hellmichs in Hamborn gewährten,
• Michael Wüst, Bernd Kreienbaum, Dr. Henry Wahlig, die äußerst interessante Text-, Bild- und auch Audio-Materialien zu Ottokar Wüst zur Verfügung stellten,
• Reiner Keith, den Urenkel von Fritz Unkel, und Natalie Pöschke für ihre Prüfung und Ergänzung meiner Recherche-Ergebnisse zum Elternhaus und zur Familie von Fritz Unkel,
• Ute, Cornelia und Ingrid Steilmann für wichtige Hinweise, Korrekturen zum Porträt von Klaus Steilmann und eine sehr geduldige und angenehme Kommunikation,
• Wolfgang Schubert von der Website www.minister-achenbach.de für interessante Hintergrundinformationen zu Lünen-Brambauer und zur Zeche Minister Achenbach im Niebaum-Kapitel,
• einige andere Personen, die mir beim Probe- und Korrekturlesen (Sebastian Thürmer, Sabine Engel) bzw. bei gestalterischen Fragen (Ralf Skiba) hilfreich zur Seite standen.
Georg Melches
* 24. August 1893 in Borbeck/Vogelheim
† 24. März 1963 in Bühl im Schwarzwald
Abb. 1: Georg Melches. // Bild: be – eigenes Werk; CC BY-SA 4.0
Gründer und Antreiber
Alles begann hinter dem Gartenzaun
Das Leben beschert ihm große Erfolge – beruflich wie sportlich, hält aber auch Schicksalsschläge bereit. Doch sein tief sitzendes Verantwortungsgefühl sorgt dafür, dass er sich bis zum Schluss leidenschaftlich für „seinen Verein“ engagiert. Mit seiner beruflichen Aufgabe und der zunehmenden Internationalisierung der jungen Bundesrepublik geht sein Blick nach dem Krieg häufiger über die Landesgrenzen, was Kontakte schafft, den Horizont erweitert und auch internationale Anerkennung sichert. Nationale Erfolge erlauben es ihm, gemeinsam mit seinem Freund Franz Kremer, dem Vereinsvorsitzenden des 1. FC Köln, Pionierarbeit für den deutschen Profifußball zu leisten. Doch als die Bundesliga kommt und aufblüht, ist er nicht mehr da. Der rastlose Einsatz für seinen Verein fordert seinen gesundheitlichen Tribut.
An einem Donnerstag, dem 24. August 1893, erblickt in Borbeck-Vogelheim ein kleiner Junge das Licht der Welt. Es ist Georg Melches, hineingeboren in ein gutbürgerliches Zuhause inmitten eines Bergarbeiterviertels. Dieses Arbeiterviertel gibt es heute so nicht mehr. Aber das Elternhaus steht noch an gleicher Stelle, in der Hafenstraße 210.
Der aus Mülheim an der Ruhr stammende Vater Heinrich, geboren am 7. Januar 1867, und Mutter Katharina Wilhelmine, geborene Trappmann, 9. Juli 1871, freuen sich über den Nachwuchs, der sich in den nächsten Jahren gesund und munter entwickeln wird. Es sind die Neunzigerjahre des 19. Jahrhunderts. Bismarck ist abgetreten. Der Wilhelminismus drängt nach einer Führungsrolle in Europa, rasselt mit dem Säbel und liefert sich Rüstungswettläufe mit Frankreich, Großbritannien und Russland. Der Jugendstil mit seinen geschwungenen, verspielten Formen setzt zunehmend Akzente in Architektur, Mode, Schmuck. Und in Athen starten 1896 die Olympischen Spiele der Neuzeit.
Die wirtschaftliche Gründerzeit liegt bereits zwei Jahrzehnte zurück. Doch der Steinkohlebergbau im Ruhrgebiet wächst weiter und wird seine Fördermenge in den nächsten 20 Jahren fast verdreifachen. Entsprechend nimmt auch die Anzahl der Beschäftigten im Ruhrbergbau zu. Vater Heinrich Melches arbeitet als Direktor und später als Betriebsführer auf der in Vogelheim, einem Stadtteil der Bürgermeisterei Borbeck, gelegenen Zeche Emscher. Diese entwickelte sich aus Grubenfeldzukäufen der älteren Zeche Anna in Altenessen und den darauf neu errichteten Förderanlagen. Sie gehört, wie auch die bekannte Zeche Carl, dem renommierten Kölner Bergwerks-Verein.
1892 wird neben dem seit 1877 in Betrieb befindlichen Schacht Emscher 1 der Schacht Emscher 2 eingerichtet. Weitere zehn Jahre später, 1902, beginnen die Abteufarbeiten für die neue Doppelschachtanlage Emil 1/2, benannt nach dem Generaldirektor des Kölner Bergwerks-Vereins Emil Krabler. In den Dreißigerjahren bürgert sich der fusionierte Zechenname Emil-Emscher ein. Und zu Beginn des neuen Jahrhunderts errichtet der Verein für die neue Schachtanlage eine Zentralkokerei an der Gladbecker Straße, etwa auf Höhe der gegenüberliegenden Johanniskirchstraße. Die Kokerei wird für eine krisenresistente Produktion von Koks und Gas sorgen. Die Inbetriebnahme erfolgt am 1. Oktober 1911.
Abb. 2: Wilhelminische Zeiten: Krupp’sche Rüstungsbetriebe machten Essen bereits im 19. Jahrhundert zur „Kanonenstadt“. // Bild: Autor unbekannt, Hermann Lorch Kunstanstalt, Dortmund – zeno.org; CCO gemeinfrei
Vater Heinrich hat beruflich alle Hände voll zu tun, um das Wachstum seiner Zeche zu organisieren. Neben dem Tagesgeschäft geht es um die Anwerbung neuer Arbeitskräfte, den Aufbau von Siedlungen, die Einrichtung von Konsum-Verkaufsstellen u.v.m. Heinrich Melches sieht sich aber auch dem Gemeinwohl verpflichtet. So engagiert er sich von 1898 bis 1912 als Zentrums-Mann im Borbecker Gemeinderat, was ebenfalls Freizeit kostet.
Melches ist allerdings kein Workaholic. Er nimmt sich immer wieder Zeit für seine Familie und beobachtet mit Liebe und Interesse die Entwicklung seiner Kinder. Am 10. Januar 1895 bringt Mutter Katharina Wilhelmine ein kleines Brüderchen zur Welt, Hermann Melches. Mit ihm gewinnt Georg einen verlässlichen Spiel- und Sportkameraden, der Georgs Interessen teilt und ihn, wie einige Fotos aus dieser Zeit vermuten lassen, häufig begleitet bei seinen vielen Unternehmungen. Am 29. März 1896 kommt Schwester Grete zur Welt (1896-1953). Die Melches-Familie ist komplett.
Abb. 3: Das Carl-Humann-Gymnasium im Essener Süden versorgte schon früh den ältesten Essener Fußballverein, den Essener Sportverein 1899, mit Nachwuchs. // Bild: Wiki05 – eigenes Werk; CCO gemeinfrei
Die Kinder- und Jugendjahre sind geprägt von der allgemeinen Aufbruchstimmung im Ruhrgebiet und der besonderen im Essener Norden. Georg entwickelt sich rasch zu einem begeisterten Fußballspieler, der unter seinen Schulkameraden und Gleichaltrigen in Bergeborbeck und Vogelheim genügend Mitstreiter für den neuen Sport findet. Fußball wird um die Jahrhundertwende überwiegend im bürgerlichen Milieu gespielt. Lange Arbeitszeiten und hohe Preise für eine Fußballgarnitur verwehren der Arbeiterklasse noch den Zugang zum neuen Trendsport. Doch auch im bürgerlichen Lager dominieren Vorbehalte gegenüber der „Fußlümmelei“, wie sie abschätzig genannt wird. Diese Vorbehalte äußern sich bestenfalls durch Herablassung und schlimmstenfalls durch offene Feindseligkeit. Für Letzteres sorgen verlässlich deutschnationale Kreise aus dem Umfeld der Turnvereine. Hier gilt der Turnsport als erprobte, alternativlose Vorstufe zur Wehrertüchtigung, die nicht nur den Körper trainiert, sondern auch Zielstrebigkeit und Disziplin fördert. Der Fußball hingegen wird als anarchische, britisch-degoutante Freizeitaktivität betrachtet. Erst während des Ersten Weltkriegs, als Gefechtspausen zum Fußballspielen einladen, wandelt sich das gesellschaftliche Image des Fußballs, so dass neue Milieus für die noch immer junge Sportart erschlossen werden können.
Fußballanfänge in Essen
Als ältester Fußballverein Essens gilt der Essener Sportverein 1899, der noch heute als Essener Sport-Gemeinschaft 99/06, kurz ESG 99/06, besteht. Zu den Spielern im Jahr 1899 zählen überwiegend Schüler des im Südosten Essens gelegenen Carl-Humann-Gymnasiums. Etwa 70 Jahre später, von 1974 bis 1978, wird Nationalelf-Manager Oliver Bierhoff bei der ESG seine ersten Schritte in Stollenschuhen unternehmen.
Nur ein Jahr später, im Januar 1900, gesellt sich die von Turnrat Otto Weber gegründete Fußballabteilung des Essener Turnerbundes (ETB) Schwarz-Weiß hinzu. ETB ist ebenfalls im Süden der Stadt ansässig und zählt schon 1902 zum Rheinisch-Westfälischen Spielverband (RWSV), dem Vorläufer des 1907 gegründeten Westdeutschen Spielverbandes (WSV). Die Fußballabteilung nimmt fortan auch an Meisterschaftsspielen teil. Mit dem ETB gehen acht weitere Vereine an den Start – davon einige mit mehreren Mannschaften. Der Liga-Spielbetrieb, auch wenn er zunächst ein wenig fragmentarisch daherkommt, wird Mitte der Nullerjahre für viele zu einem weiteren Anreiz, einen eigenen Verein zu gründen. Dies gilt auch für die Melches-Brüder und weitere Kombattanten aus der Vogelheimer Nachbarschaft, was zudem eine kleine Vorgeschichte hat.
Denn Heinrich Melches gehört nicht zu den Vätern, der seine Söhne unbedingt vom Fußball abbringen möchte. Im Gegenteil. Weihnachten 19061 erfreut er seine beiden Sprösslinge mit einem echten Fußball. Zu jener Zeit ein äußerst rares und teures Geschenk. Dieser wird binnen weniger Wochen zu einem ausgiebig genutzten Sportgerät in der gesamten Nachbarschaft – vorwiegend hinter dem Gartenzaun der Melches – und schließlich zu einem handfesten Aufhänger für die Idee, einen eigenen Fußballverein zu gründen.
Georg Melches, erst dreizehn Jahre alt, entwickelt sich zum Anführer und Antreiber. Seine Akzeptanz – heute würde man von Street Credibility sprechen – muss recht hoch gewesen sein. Befördert wird diese von seinen fußballerischen Fähigkeiten, seinen Erfolgen als Leichtathlet, auch das betreibt er mit Freude und Ehrgeiz, seiner Bildung und nicht zuletzt seinen rhetorischen Talenten. Denn der junge Mann besucht nach der Volksschule Vogelheim das Gymnasium Borbeck und später das Realgymnasium Altenessen, heute Leibniz-Gymnasium. Er versteht es, geschliffen zu formulieren und überzeugend zu argumentieren.
Ein wichtiger Helfer auf dem Weg zur Vereinsgründung ist erneut Vater Heinrich, der es nicht beim Weihnachtsgeschenk Fußball belässt. So dürfen die Melches-Brüder samt Anhang ihre Spiele auf dem Gelände der Emscher-Schachtanlage austragen, das nordöstlich hinter Melches‘ Gartenzaun liegt. Nach getaner, oft staubiger Tat ziehen sich die Spieler im Keller der Melches um, wo es auch eine Waschgelegenheit gibt.
Ermuntert und beraten von Vater Heinrich und befördert von dem Selbstvertrauen, über einen Fußball und sogar einen Fußballplatz zu verfügen, streben die beiden Melches-Brüder gemeinsam mit anderen Schülern, Angestellten und Bergleuten der Zeche Emscher im Jahr 1907 eine Vereinsgründung an. Zuvor werden noch einige talentierte Spieler von zwei anderen Mannschaften aus der Nachbarschaft, dem „SC Preußen“ und der „Deutschen Eiche“, abgeworben. Dann kann das Abenteuer beginnen. Der neugegründete Verein nennt sich „Sportverein Vogelheim“. Als Vereinsanschrift dient die Adresse von Melches‘ Elternhaus.
Karl Utzat, ein Zeitgenosse aus dem Freundeskreis der Melches, blickt 1925 in einer der ersten RWE-Vereinszeitschriften auf diese unschuldigen Anfänge zurück:
„Der Ball selbst war die Hauptsache, das andere fand sich von selbst: Spieler, mehr als nötig waren, an Platz fehlte es auch nicht. Die ersten Wettkämpfe fanden zwischen Straßen- und Gartentor auf Melches-Hof statt. […] Unser Vereinslokal war Melches Waschküche. Wenn die im Winter mollig geheizt war, versammelten wir uns jeden Abend. “
Mit der Verbandsaufnahme gestaltet es sich schwieriger. Denn die „wilden Vereine“, zumeist getragen von euphorisierten, jungen Fußballern, leiden unter dem Misstrauen der Verbandsoberen, die nicht immer von der Nachhaltigkeit der Anträge überzeugt sind. Bei „stabilen“ Abteilungen aus etablierten Turnvereinen verläuft die Aufnahme schneller. So führen schließlich die 1910 angestoßenen Verhandlungen mit dem Turnerbund Bergeborbeck, der zuvor einige Spieler von Preußen Bergeborbeck eingegliedert hat, zur Integration unter dem Dach der Turner und damit auch zur Verbandsaufnahme. Heinrich Melches, stets im Umfeld seiner Söhne unterwegs, wird sogar 2. Vorsitzender des TB Bergeborbeck. Seine Söhne Georg und Hermann finden Aufnahme in der ersten Mannschaft, die mit wechselndem Erfolg unterwegs ist. So berichtet z.B. der „General-Anzeiger“ am 2. September 1911 in einer dürren Meldung:
„Am vergangenen Sonntag standen sich in Bergeborbeck die beiden Fußballmannschaften des Turnvereins Duisburg-Kasslerfeld und des TurnerbundesBergeborbeck im Fußballmeisterschaftsspiel gegenüber. Kasslerfeld siegte überlegen mit 6:1 Toren. Halbzeit 2:0. “
Die meisten ehemaligen Vogelheimer müssen sich allerdings mit der zweiten Mannschaft des Turnerbundes begnügen. Aus diesem und noch anderen Gründen, man tickt halt anders, geht die Ehe mit dem Turnerbund nicht lange gut, was in jener Zeit eher die Regel, als die Ausnahme darstellt. Denn nur die wenigsten Zweckbündnisse zwischen Turnern und Fußballern sind von wechselseitiger Sympathie geprägt. Hinzu gesellen sich des Öfteren Abteilungsgerangel und Platzstreitigkeiten. Am 14. September 1913 erfolgt die Trennung vom TB Bergeborbeck. Die Fußballer gründen sich vier Tage später neu unter dem Namen „Spiel- und Sportverein Emscher-Vogelheim“, kurz „SuS Emscher-Vogelheim“. Eine eigenständige Mitgliedschaft im Westdeutschen Spielverband (WSV) gibt es obendrauf2, so dass es in den amtlichen Mitteilungen der WSV-Zeitschrift „Fußball und Leichtathletik“ am 18. September 1913 zur Neuaufnahme nüchtern heißt:
„Spiel und Sportverein Emscher, Vogelheim, Heinr. Melches, Vogelheim bei Bergeborbeck, Emscherstraße 74, 26 Mitglieder; dunkelroter Jersey mit weißer Schärpe und weißer Hose.“
Erster Weltkrieg
Der 24. Oktober 1911 wird zu einem traurigen Tag für die Familie Melches. Hermann Melches, Georgs jüngerer Bruder, stirbt mit erst sechzehn Jahren. Hermann wird später auf Melches‘ Familiengrab auf dem Essener Matthäusfriedhof eine lebensgroße Skulptur erhalten. Sein Tod erschüttert die Familie.
Auch für Georg ziehen am Horizont dunkle Wolken auf. Im zunehmend chauvinistischer werdenden Europa rückt der Krieg näher. Nach dem Attentat von Sarajevo auf Erzherzog Franz Ferdinand, den Thronfolger Österreich-Ungarns, und seine Gemahlin Sophie am 28. Juni 1914 eskaliert die Situation. Die rasch aufeinander folgenden Kriegserklärungen, beginnend mit denen der Mittelmächte Österreich-Ungarn (28. Juli) und Deutsches Reich (1. August) an Russland, mobilisieren halb Europa. Georg Melches meldet sich als Freiwilliger zur Front, kehrt aber gegen Ende des Jahres 1918 wohlbehalten nach Essen zurück.
Der Fußball läuft in den vier Kriegsjahren mit einigen Ersatzleuten und ein wenig Improvisation weiter. Trotzdem schlägt sich der SuS Emscher-Vogelheim ganz ordentlich und kann sich zeitweise sogar in der Tabellenspitze seiner Klasse behaupten. Dabei profitiert der SuS davon, dass sich in seinen Reihen viele Reklamierte3 befinden. Die „Dortmunder Zeitung“ schreibt am 13. November 1915 anerkennend:
„Der Spiel- und Sportverein Emscher, Essen/Ruhr, verfügt zur Zeit über eine Mannschaft, die so leicht keinen Gegner zu fürchten braucht. Die Mannschaft konnte noch vor einigen Sonntagen in Duisburg den Liga-Meister von Westdeutschland, Duisburger Spielverein, mit 1:0 besiegen […]“
Wer die überragende Rolle des Duisburger SpV in den Zehnerjahren im Westen des Kaiserreichs kennt, der kann ermessen, was diese Meldung bedeutet – trotz Kriegszeit.
Nach dem WK I lässt sich der Verein am 19. Februar 1921 beim Amtsgericht Borbeck als „Spiel und Sport 1912, Essen Bergeborbeck“ ins Vereinsregister eintragen. Zum sechsköpfigen Vorstand zählen u.a. der „Kaufmann Georg Melches“ und der „Maschinensteiger Gustav Klar“. Letzterer wird als Rot-Weiss-Vorsitzender von 1930 bis 1945 noch eine lange Wegstrecke mit Melches gemeinsam gehen.
Im Alltag bzw. auf den Trikots wird der Name zu „SuS 12“ abgekürzt. Kurze Zeit später gibt es erneut Kontakte und Gespräche mit dem Turnerbund, bei denen ein gewisser Theo Schneider auf einen gemeinsamen Neustart drängt. Im Juni 1923 ist es dann so weit. Spiel und Sport 1912 übernimmt eine Gruppe talentierter Fußballer vom Turnerbund Bergeborbeck4 und gründet sich ein letztes Mal neu. Dieses Mal mit offensiver Namensgebung. Da 1915 das Industriedorf Borbeck, mit immerhin 77.000 Einwohnern die größte Landgemeinde des Deutschen Kaiserreichs, nach Essen eingemeindet wird, nennt sich der neue Verein Rot-Weiss Essen5. Seine Heimat liegt an der Vogelheimer Straße6, die ab 1936 Hafenstraße heißen wird.
Dabei haben auch die RWE-Vorgängervereine, wie so viele Fußballvereine dieser Zeit, eine wahre Odyssee über verschiedene Sportplätze hinweg hinter sich. Neben der erwähnten Fläche im Garten bzw. im unmittelbaren Umfeld von Melches‘ Elternhaus (1907) nutzen die Vorgängervereine Breilmanns Wiese an der heutigen Westuferstraße (1908-1909), einen etwas weiter entfernten Platz bei Overbecks Hof an der heutigen Emscherbruchallee (1907-1913) oder auch die Zechenwiese am Steinberg (1907-1909) bzw. den Sportplatz an den Emscherschächten an gleicher Stelle (1913-1922). 1912 kommt ein Sportplatz in der Germaniastraße, gelegen an der Borbecker Jugendhalle, hinzu, der bis 1922 bespielt wird.
1921 pachtet der SuS nach langen und zähen Verhandlungen mit dem bisherigen Pächter, dem TV 1884 Bergeborbeck, und dem Grundstückseigentümer, der Zeche Carolus Magnus, einen vom Turnverein nicht mehr benötigten kleinen Sportplatz in der Vogelheimer Straße 97A an. Dieser liegt direkt neben der damaligen Gaststätte Böhmer, die in der Anfangsphase auch Umkleidekabinen zur Verfügung stellt. Die Adresse wird zur RWE-Heimat für die nächsten hundert Jahre. Allerdings sind zuvor noch einige Aus- und Umbauarbeiten zu erledigen, die in Inflationszeiten nur mühsam realisiert werden können. Doch am 2. April 1922 ist es soweit. Der vollständig restaurierte Platz, das „Stadion Rot-Weiss“, wird mit einem Privatspiel gegen Preußen Duisburg eingeweiht.
Berufliche Schritte nach WK I
Nach der Rückkehr aus dem Krieg startet Georg Melches ins Berufsleben mit zwei halbjährigen Praktika. Das erste Praktikum findet unter Tage auf Schacht Emscher, also im Betrieb seines Vaters statt. Das zweite Praktikum führt ihn zur 1876 errichteten Kokerei am Altenessener Schacht Helene7 in der Twentmannstraße. Doch der klassische Bergbau interessiert Georg Melches nur bedingt. Ihn fasziniert der noch junge Maschinen- und Anlagenbau im Umfeld von Zechen und Kokereien. So schließt sich der junge Essener 1920 der Essener Koksofen und Gasverwertungs AG, kurz Kogag, an, bei der er einen rasanten Aufstieg in leitende Funktionen mit Prokura erleben wird.
Abb. 4: In der Kokerei von Zeche Helene an der Twentmannstraße – hier ein aktuelles Bild – absolvierte Georg Melches nach dem WK I ein Praktikum. // Bild: smial – eigenes Werk; Free Art License
Die Kogag wurde 1916 gegründet. Das Kapital stammt zur Hälfte von der Frankfurter Metallbank und Metallurgische Gesellschaft AG und zur anderen Hälfte von der Dortmunder Firma August Klönne. Melches trifft auf ein noch recht junges, dynamisches „Startup“, das mit grundsätzlichem Wachstumsehrgeiz und guten Aufstiegschancen um Personal wirbt. Für Georg Melches ist es genau die richtige Einstiegskonstellation.
Doch die Anfänge gestalten sich schwierig. Zunächst können nur kleine Aufträge, meist Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, an Land gezogen werden. Doch mit der Zeit verstetigen sich die Geschäftsbeziehungen zur Kernzielgruppe, den Berg- und Hüttenwerken des Ruhrgebiets. 1925/26 rutscht auch endlich etwas Größeres in die Auftragsbücher, ein 20-Öfen-Auftrag des Köln-Neuessener Bergwerksvereins für die Kokerei Emil. Ob bei diesem Auftrag die Melches-Familienbande eine „abschließende“ Rolle gespielt haben, ließ sich nicht ermitteln.
Schon bald sorgen auch Fusionen und Kooperationen für einen noch ambitionierteren Geschäftsansatz. So beteiligt sich 1926 die Stettiner Chamottefabrik F. Didier AG zu 50 Prozent an der Kogag und wandelt sie anschließend in die Didier-Kogag AG um. Zwei Jahre später klettert Melches auf den Posten des kaufmännischen Direktors und wird gleichzeitig Vorstandsmitglied. Am 1. März 1931 übernimmt Didier die Kogag vollständig; Melches und seine Position bleiben unangetastet.
Die Firma Didier geht auf den am 5. Januar 1801 in Stettin geborenen Hugenotten-Nachkommen Ferdinand Didier und seine 1834 gegründete Chamottefabrik F. Didier in Podejuch8 zurück. Der Fokus liegt zunächst auf feuerfesten Materialien, z.B. Schamotten für die Gasindustrie, was Didier mit Wilhelm Kornhardt, Direktor der Stettiner Gaswerke, ins Gespräch bringt. So kommt es, wie es wohl kommen musste: 1865 gründen der Industriepionier Didier und der für seine Gaswerköfen bekannte Tüftler Kornhardt die „Stettiner Chamottefabrik F. Didier“, die später oft als „Keimzelle des industriellen Ofenbaus“ bezeichnet wird. In den Folgejahren führen Aktienausgaben9 zu Kapitalaufstockungen, die wiederum eine weitere Expansion befördern. Fusionen und Firmenkäufe gehören zum Alltag des Unternehmens. Bereits 1890 können im Anlagenbau schlüsselfertige Gaswerke angeboten werden. Der Firmensitz wandert von Stettin nach Berlin. 1932 wird die Dachgesellschaft in Didier Werke AG umbenannt.
Abb. 5: Zwei tatkräftige Männer haben sich gefunden, links: Ferdinand Didier (1801-1867), rechts: Wilhelm Kornhardt (1821-1871). // Bild: Ferdinand Didier – www.vdkf-ev.de; Wilhelm Kornhardt – www.vdkf-ev.de; beide CC0 gemeinfrei
Parallel nimmt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Bedeutung der Kokereien zu. Auch hier sind für den Hüttenkoks große Öfen gefragt, die die Fettkohle unter Luftausschluss auf 1.000° C und mehr erhitzen können. Entsprechend fügen sich schon bald der Kokerei-Anlagenbau und der ältere Gaswerk-Anlagenbau zu einer Branche zusammen.
1934 wird es internationaler. Mit der renommierten Gibbons Brothers Ltd. wird ein Lizenzvertrag abgeschlossen, der helfen soll, den britischen Markt zu erschließen. Gibbons Brothers Ltd. verfügt im Berg- und Ofenbau über einen exzellenten Ruf, was den Vertrieb der Didier-Kogag-Produkte auf der Insel deutlich erleichtert. Speziell der hochmoderne Koksofen, der in Großbritannien als „Gibbons-Kogag Coke Oven“ vermarktet wird, entwickelt sich zu einem verlässlichen Kassenschlager.
Doch auch im Inland geht es voran. Die Didier Aktiengesellschaft hatte bereits 1924 eine Kooperation mit der 1911 von Bergwerksdirektor Wilhelm Hinselmann (1863-1944) gegründeten Hinselmann Koksofenbaugesellschaft mbH in Essen angestoßen. Nach vollzogener Vereinigung von Didier und Kogag wird die Kooperation 1938 wiederbelebt, dieses Mal mit personellen Verflechtungen. Die „Rhein- und Ruhr-Zeitung“ berichtet am 31. August:
Die Didier Kogag Koksofenbau und Gasverwertung A.G. und die Hinselmann Koksofenbau Gesellschaft m.b.H., beide in Essen, haben sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. Der bisherige Geschäftsführer der Hinselmann Koksofenbau Gesellschaft m.b.H., Herr Schenk, ist in freundschaftlichemEinvernehmen mit den Gesellschaften aus der Geschäftsführung ausgeschieden. Für beide Gesellschaften ist Personalunion geschaffen.
In den Vorstand der Didier Kogag Koksofenbau und Gasverwertung A.G. ist Herr Dr. Litterscheidt als stellvertretendes Mitglied eingetreten. Zu Geschäftsführern der Hinselmann Koksofenbau Gesellschaft m.b.H. sind die Mitglieder des Vorstandes der Didier Kogag Koksofenbau und Gasverwertung A.G. bestellt, die Herren Georg Melches und Dr. Litterscheidt.
Der Arbeitsgemeinschaft stehen die praktischen Erfahrungen beider Gesellschaften auf den bisherigen Arbeitsgebieten zur Verfügung.
Georg Melches sitzt damit noch fester im Sattel. Gleichzeitig ist es für sein Unternehmen, das jetzt Didier-Kogag-Hinselmann AG (DKH) heißt, ein wichtiger Schritt zum akzeptierten Entwicklungsdienstleister für Kokereien und Kohlenwertstoffanlagen auf dem internationalen Markt.
Ende der Spielerlaufbahn
Der Neustart nach dem Ersten Weltkrieg fällt schwer. Das erste Spiel geht gleich mit 1:26 verloren. Die Spieler verfügen nicht einmal über einheitliche Trikots10. Mittelstürmer Georg Melches gehört sofort wieder der ersten Mannschaft an. Er ist schnell, athletisch und verfügt über einen Körper, der sich durchzusetzen weiß. Später, als Kraft und Kondition nachlassen, lässt er sich nach hinten „versetzen“ und bewährt sich als Verteidiger. RWE ist Mitte der Zwanzigerjahre noch keine echte Größe im Vereinsfußball. Auf bemerkenswerte Siege, wie das 5:3 am 18. April 1924 im Gesellschaftsspiel gegen den SC Union Charlottenburg, folgen deftige Niederlagen, wie das 1:6 gegen den Lokalmatador Schwarz-Weiß am 3. August des gleichen Jahres. 1927 beendet Melches seine aktive Laufbahn. Anlässlich der Gruppen-Meisterschaft in der 2. Bezirksklasse 1928/29 bedankt sich die erste Mannschaft noch einmal bei ihrem „Freund und Führer Georg Melches“ für dessen Engagement mit einer Urkunde und einigen zeittypischen Versen: „Du hast mit Weisheit den Verein regiert. / Was war Dein Ziel; es galt der teuern Jugend. / Da hattest Du des Sportes Macht erkannt, / die Körperkraft zu pflegen und zu heben. / Gesundheit, Lebensfreude, Arbeitslust […].“
Die Fußballschuhe hängen nun am Nagel. Doch seinem Verein bleibt der „Freund und Führer Georg Melches“ auch nach seiner aktiven Zeit auf mannigfaltige Weise erhalten.
Entwicklung zum Funktionär
Melches ist aus dem Ersten Weltkrieg als gereifter Mann zurückgekehrt. Die ersten beruflichen Erfahrungen und Beförderungen tun ihr Übriges. Auch den 1923 aus dem Zusammenschluss mit den Turnerbund-Fußballern hervorgegangenen Klub RWE empfindet er als „seinen“ Verein, der von ihm, seinem verstorbenen Bruder und seinem Vater mitgegründet wurde – und auch mitverantwortet werden muss. Wo auch immer nach 1919 Bedarf besteht, Georg Melches kümmert sich – sei es als Fußballobmann, Jugendbetreuer, Finanzobmann oder Schriftführer. Als 1925 aufgrund von Straßenplanungen, es geht um die Streckenführung der heutigen Bottroper Straße, auch der Platz an der Vogelheimer Straße 97A nicht mehr lange nutzbar erscheint, führen Georg Melches und Kassenwart August Schmitz die Verhandlungen mit der Stadt Essen, der Zeche Carolus Magnus und den anliegenden Schrebergartenbesitzern, um für den Verein ein Ersatzgrundstück auf der anderen Straßenseite der Vogelheimer, nördlich der damaligen Langenhorster Straße zu sichern. Dieses Grundstück bzw. der darauf zu errichtende Platz kann nach eilig organisierten Bauarbeiten ab der Saison 1926/27 genutzt werden. Doch der neue Sportplatz wird bereits im Sommer 1927 durch ein heftiges Unwetter umgepflügt. Auch die Rahmenbedingungen ändern sich schon bald wieder. Denn die Straßenplaner favorisieren mittlerweile einen anderen Straßenverlauf, so dass RWE ab 1928 mit der Vogelheimer Straße 97A wieder planen kann. Diese glückliche Fügung soll die Verdienste von Melches und Schmitz in dieser für den Verein heiklen Phase jedoch keinesfalls schmälern.
Auch nach seiner aktiven Karriere bleibt Melches‘ Engagement für den Verein ungebrochen. Denn Georg wie auch Vater Heinrich sehen im Neustart als „Rot-Weiss Essen“ eine großartige Gelegenheit, alle Konflikte zwischen Fußballern, Turnern und Verbänden endgültig hinter sich zu lassen, und mit veränderter Größe und dem Bekenntnis zur Stadt Essen den eigenen Resonanzraum deutlich zu vergrößern. So geschieht es auch. Der Verein, der schon als SuS nachhaltig vom Fußballboom der Nachkriegszeit11 profitierte, wird populärer und attraktiver. Ende der Zwanzigerjahre stellt sich auch der sportliche Erfolg ein, auf den man schon so lange wartet. 1929 steigt RWE in die 1. Bezirksklasse auf. Ein Jahr später sorgt eine Neuordnung der Spielklassen sogar dafür, dass der Verein erstklassig wird. Ein Niveau, das RWE zwei Jahre halten kann. Doch die Zeitumstände bleiben schwierig. Gebeutelt von der Weltwirtschaftskrise zu Anfang der Dreißigerjahre muss RWE Ballast abwerfen. 1931 kündigt der Verein den Pachtvertrag für den zweiten Platz an der Langenhorster Straße. Die Ausgaben für Auswärtsfahrten werden kontingentiert oder gleich ganz gestrichen. Bei den Jugendmannschaften versucht der Verein, Spiele zu organisieren, bei denen Fahrtkosten erst gar nicht anfallen. Doch für zwei Urkunden bleiben Zeit und Geld: Georg Melches und August Schmitz werden aufgrund langjähriger Verdienste am 13. August 1932 zu Ehrenmitgliedern ernannt.
NS-Zeit und Gauliga
Ein halbes Jahr später beginnt in Deutschland die Alleinherrschaft der NSDAP. Die Nationalsozialisten sorgen rasch dafür, dass die Sportvereine, deren emotionale Mobilisierungskräfte sie fürchten, nach dem Führerprinzip organisiert und gleichgeschaltet werden. Bei Rot-Weiss wird am 14. Juni 1933 der zuvor bereits erwähnte Gustav Klar zum Vereinsführer ernannt. Ihm arbeitet ein Vereinsführerring zu, dem auch Georg Melches als Klars Stellvertreter und Fußballobmann angehört.
Laut dem Historiker Nils Havemann, der über den Weg von Rot-Weiss in der NS-Zeit berichtet, entfacht das neue Regime im Arbeiterviertel Bergeborbeck anfänglich nur wenig Begeisterung12:
„In den folgenden Monaten war bei Rot-Weiß Essen allerdings nur wenig Aufbruchstimmung zu verspüren. Zwar bemühte sich Klar, die Konformität des Vereins mit dem neuen Regime nach außen darzustellen, indem er beispielsweise den Wehrsport einführte, die Jugendabteilung zu lokalen Aufmärschen schickte und gelegentlich über den ‚Schandvertrag von Versailles‘ wetterte, doch die Resonanz der Mitglieder auf solche Veranstaltungen war den Vereinsprotokollen zufolge ‚sehr gering‘.“
Auch in den nachfolgenden Jahren will sich bei Rot-Weiss keine rechte Begeisterung für Parteiveranstaltungen einstellen, auch wenn Georg Melches am 1. Mai 1937 als Mitglied Nummer 5.603.339 der NSDAP beitritt. Zur Situation gegen Ende der Dreißigerjahre noch einmal Havemann13:
„Bei Rot-Weiß Essen war das Interesse der Mitglieder an ideologischen Schulungen trotz des großen Engagements seines Dietwartes Gustav Welckerebenfalls begrenzt. Dieser hielt im April 1937 einen Vortrag über die Folgen von Erbkrankheiten für die Entwicklung des Volkes. […] Im Anschluss daran sah sich Vereinsführer Klar genötigt, an die Mitglieder zu appellieren, ‚auch ihrerseits mit dazu beizutragen, ein gesundes, starkes Deutschland herauszubilden‘. Dieser Aufruf erreichte nicht einmal ein Viertel des Vereins. […] In den folgenden Jahren nahm bei Rot-Weiß Essen das Interesse an solchen Abenden nicht zu. Im Dezember 1939 ‚bat‘ Welcker auf der Jahreshauptversammlung darum, dass an seinen Veranstaltungen ‚alle Mitglieder noch zahlreicher erscheinen mögen‘.“
Sportlich bleibt RWE ambitioniert. Vor einem Gastspiel in Castrop-Rauxel im Juni 1933 wird die Mannschaft vom „Castroper Anzeiger“ in zeittypischer, leicht martialischer Tonalität beschrieben14:
„Rot-Weiß Essen, […] der Neuling der Sonderklasse, stellt sich der Castroper Sportgemeinde vor. In einer überzeugenden Manier haben sich die Essener den Aufstieg in die Sonderklasse erkämpft. Kampf ist ihre Parole, und erst mit dem Schlußpfiff ist für sie der Kampf beendet.“
Unterhalb der Gauliga Niederrhein, die zu den sechzehn neugegründeten Gauligen 1933 gehört, richtet der Verband eine Bezirksklasse ein, die aus mehreren Gruppen besteht. Hier findet sich auch RWE wieder und erzielt in den nächsten Jahren respektable vierte und zweite Plätze. Hinter dem Repräsentationsverein und der zu dieser Zeit unangefochtenen Nummer eins der Stadt ETB Schwarz-Weiß rangelt man mit dem BV Altenessen 06 um den zweiten Platz im Essener Fußballkosmos. RWE muss und will dazu in die Gauliga aufsteigen, woraus Melches auch keinen Hehl macht. Als der Verein im Dezember 1936 mal wieder auf dem undankbaren zweite Platz logiert und dem Spitzenreiter Union Hamborn mit drei Punkten hinterherläuft, äußert sich Melches gegenüber dem „Essener Anzeiger“ in aller Deutlichkeit15:
„Die Meisterschaft ist was Schönes. Wenn die anderen Vereine besser wären, würden wir uns nicht sonderlich um die Frage nach dem Meister bekümmern. Aber sie sind nicht besser.“
Einige Zeilen weiter gestattet „Gönner Melches“, wie ihn die Zeitung nennt, einen Einblick in seine Sehnsüchte:
„Im nächsten Februar feiern wir unser 30jähriges Bestehen. Ein schöneres Geschenk könnte uns die Mannschaft nicht machen, als daß sie in dem Jubiläumsjahrdie Meisterschaft holt und sich damit die Berechtigung zu den Aufstiegsspielen erkämpft.“
1936/37 soll es noch nicht sein. Aber ein Jahr später, 1937/38, gelingt mit dem ersten RWE-Trainer Erich Schmidt endlich der Sprung in die oberste Klasse, die Gauliga. Einen Tag vor dem entscheidenden Spiel in der Aufstiegsrunde gegen den VfR Ohligs am 24. April 1938 wagt die „Rhein- und Ruhr-Zeitung“ eine Prognose:
„Bei normalem Ablauf der Dinge dürfte am Abend des 24. April der erste Aufsteigende feststehen: Rot-Weiß Essen! Die Essener haben ihre bisherigen Prüfungen so klar und sicher für sich entschieden, daß es schon einem ‚Sensatiönchen‘ gleichkäme, würden sie sich den Rang heute noch ablaufen lassen.“
Das „Sensatiönchen“ bleibt aus. Zwar reicht es vor 5.000 Zuschauern gegen den VfR Ohligs nach 0:2-Rückstand nur zu einem mühsamen 3:2-Sieg, aber der Aufstieg ist geschafft. Die Lokalzeitung „Ohligser Anzeiger“ sieht gar den Schiedsrichter als Spielentscheider16:
„[…] das Spiel wurde von Rot-Weiß unverdient gewonnen. Das hatte VfR Ohligs nicht verdient. 3:017 lagen die grünen Husaren in Führung und doch wurde ihnen der Sieg noch entrissen, bedingt durch die unkorrekte Leitung des Schiedsrichters.“
Nach dem Spiel lachen glückliche Essener Spieler in die Kamera des Fotografen. Ein strahlender Georg Melches muss nach diversen Umarmungen und Jubelsprüngen zunächst den Rasen nach Hut und Uhr absuchen. RWE freut sich auf die Gauliga Niederrhein.
Mit dem Gauliga-Aufstieg und den jetzt zu erwartenden prominenten Gästemannschaften wie Fortuna Düsseldorf, VfL Benrath oder eben ETB Schwarz-Weiß dürften die Zuschauerzahlen deutlich zunehmen. Gustav Klar und Georg Melches sehen schon Anfang 1938 die Gefahr, vom eigenen Erfolg überrollt zu werden. Sie planen frühzeitig einen Stadionausbau und sind in ihren Gesprächen mit der Stadt, den Bergeborbecker Turnern und dem regionalen Verband des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen (DRL) auch schon recht weit gekommen. Doch Ende August spielen sintflutartige Regenfälle erneut Schicksal. Das Stadion steht etwa 10 Tage unter Wasser. Die damit einhergehenden Bilder helfen Melches & Co., die Vertreter der genannten Parteien für eine grundsätzliche Aufwertung des RWE-Stadions zu sensibilisieren. Überfüllte Spitzenspiele in der anlaufenden Saison tragen ein weiteres Scherflein zu der Einsicht bei, dass dringend etwas unternommen werden muss.
Georg Melches sieht und nutzt seine Chance. Er korrespondiert viel mit Essens Oberbürgermeister Just Dillgardt, dem Essener Bauamt, Architekten und Bauplanern, dem Unternehmen Hochtief und natürlich auch mit vielen vereinsinternen Helfern, die mit Rat und Tat den Aus- und Umbau des Stadions die Saison 1938/39 hindurch begleiten.
Abb. 6: RWE schickt die ruhmreiche Hertha im Pokal mit 3:0 nach Hause. // Bild: „Essener Anzeiger“, 10. Oktober 1938 – zeit.punkt-NRW; CC BY-SA 4.0
Sportlich läuft es bei RWE bestens. In der Gauliga Niederrhein springt man direkt auf den dritten Platz. Lediglich Fortuna Düsseldorf und den Lokalrivalen ETB muss man in der Tabelle passieren lassen. Die ETB-Fußballer, die sich 1924 aufgrund der Reinlichen Scheidung vom Hauptverein trennen mussten, aber seit 1937 wiedervereinigt sind, fügen RWE am 16. Oktober 1938 eine schmerzhafte 0:5-Heimpleite zu. Fünf Monate zuvor, am 22. Mai, hatten sich die beiden Kontrahenten in einem Privatspiel noch schiedlich-friedlich 4:4 getrennt. Dieses Mal fällt das Spiel sehr einseitig aus. Der „Essener Anzeiger“ vom 17. Oktober schlagzeilt: „Mit 5:0 zertrümmerte der ETB Schwarz-Weiß die stolzen Hoffnungen des Gauliganeulings.“ Und auch die „Essener Volkszeitung“ resümiert: „Schwarz-Weiß in glänzender Form – Rot-Weiß verlor die Nerven“. Doch der dritte Platz überstrahlt am Ende alles, auch diesen Ausrutscher.
Im Tschammer-Pokal geht es gar nach einem 3:0-Sieg über Hertha BSC18 bis ins Viertelfinale. Es schwingt Anerkennung mit, wenn der „Essener Anzeiger“ am Tag nach dem Hertha-Spiel, dem 10. Oktober, über die Erfolgsfaktoren der Rot-Weissen sinniert:
„Die erste Voraussetzung ist eine tüchtige Portion Können. Die ist auch da. Aber über genau so viel Können verfügen auch andere Mannschaften am Niederrhein und sicher auch die diesmal klar geschlagene Hertha. Aber diese Einheiten wenden ihr Können nicht so unbekümmert, so herzhaft an wie die Rotweißen.“
Die fachlich-wohlmeinende Analyse ist das eine, Volkes Stimme das andere. Auch die fängt der „Essener Anzeiger“ ein, als er die Menschentraube, die an den Aushängen vor der eigenen Geschäftsstelle im Eickhaus nach den Sportergebnissen Ausschau hält, belauscht19:
„Wat, seh ich richtig? Drei zu Null haben’se Hertha reingelegt? Donnerkiel! “
„Tja, dat ist der kommende Meister. Warte bloß, was Sonntag Schwarz-Weiß abgeputzt wird!“
„Langsam, junger Mann, langsam; so weit ist es denn doch noch nicht. Ich habe das Spiel vorhin gesehen, auch Rot-Weiß ist zu schlagen. “ […]
„Zu schlagen? Jawoll! Jede Mannschaft is et. Aber wie? Werder Bremen, St. Pauli, Hamborn 07, SSV Wuppertal. Nun Hertha, dat alte Mädchen vom Gesundbrunnen. Is dat nix? Und mein’se, die hätten sich zum Vergnügen verbiegen lassen? Nich, dat ich kichere!“ […]
Trotz soviel Optimismus bildet der SV Waldhof in der nächsten Runde die Endstation (2:3 nach Verlängerung). Dafür ergibt sich am 13. August 1939 ein weiteres Highlight: Der FC Schalke 04, den RWE am 8. März 1931 schon einmal in einem Gesellschaftsspiel mit 5:3 besiegen konnte, schaut zur Eröffnung des neuen Rot-Weiss-Stadions vorbei. Die Knappen, inzwischen das Nonplusultra im deutschen Vereinsfußball, spielen in Bestbesetzung. Das lässt im Einweihungsspiel zunächst Schlimmes befürchten, wie die „Essener Volkszeitung“ am nächsten Tag berichtet20:
„Rot-Weiß hat Anstoß. Kuzorra fängt den Ball ab. Er gibt ihn in schöner Vorlage an Szepan, der zu Eppenhoff verlängert. Der junge Rechtsaußen läuft damit in den gegnerischen Strafraum und schießt blitzschnell an dem verblüfften Moritz vorbei ins Tor.“
Abb. 7: Einweihung des neuen RWE-Platzes gegen Königsblau (1:5). Vereinsführer Gustav Klar dankt Heinrich Melches und besonders Georg Melches für mannigfaltige Anstrengungen, ohne die diese Sportanlage nicht entstanden wäre. // Bild: „Essener Volkszeitung“, 14. August 1939 – zeit.punkt-NRW; CC BY-SA 4.0
Doch die „Volkszeitung“ hält auch Komplimente für die Hausherren bereit. Journalist Willi Kahlert in seinem Fazit:
„Die Rot-Weißen dagegen gingen mit einem Löweneifer in den Kampf. Sie wollten zur Übernahme dieses neuen schönen Platzes ihrem Verein eine besondere Freude bereiten und ehrenvoll gegen den Meister aus Schalke abschneiden. Sie haben es trotz dieser Niederlage getan.“
Ähnlich sieht es der „Patriot“, der besonders das neue „Schmuckkästchen“ hervorhebt21:
„Mit 22.000 Zuschauern waren die Ränge restlos besetzt und ausverkauft. […] Sicher mit 5:1 (1:0) wurde Rot-Weiß Essen auf der eigenen neuen Sportplatzanlage, die als ein Schmuckkästchen angesprochen werden kann, geschlagen. Die Kampfstätte selbst hat mit dem Einweihungsspiel die Feuerprobe glänzend bestanden.“
Zweieinhalb Wochen später beginnt der Zweite Weltkrieg. Im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg dominiert dieses Mal kein Hurra-Patriotismus die Stimmungslage. RWE bekommt bereits im Oktober 1939 den Krieg zu spüren. Der Verein verzeichnet einen deutlichen Aderlass. Viele Spieler werden zum Arbeits- oder Wehrdienst eingezogen. Der Verein ist gezwungen, seine Personalnot mit Nachwuchskräften und Ehemaligen zu kompensieren. Mit Blick auf andere Gauliga-Klubs, die es nicht so hart trifft, spricht so mancher Essener gar von Wettbewerbsverzerrung.
Die meisten Menschen blicken sorgenvoll in die Zukunft und beschränken ihre Konsumausgaben erst einmal auf das Wesentliche. Stadionbesuche gehören nicht dazu. Und so bringen sinkende Zuschauerzahlen RWE erneut finanziell ins Trudeln, zumal der Verein noch einige Kredite aus dem Stadionausbau zu bedienen hat. Georg Melches zieht alle Register. Kurzfristige Verbindlichkeiten werden, wenn möglich, in langfristige Verbindlichkeiten umgewandelt; mit einigen Gläubigern können Zahlungspausen vereinbart werden. Bei Melches‘ Geldbeschaffungsmaßnahmen rückt einmal mehr die Stadt Essen in den Fokus. Hier gelingt es dem Krisenmanager Melches nach einigen Anläufen und unter Mithilfe von Verwaltung, Banken und Schulbehörden einen Deal zu vereinbaren, der gegen städtisches Geld die Schulklassen vermehrt auf die RWE-Sportanlagen bringt und gleichzeitig die Schulden RWEs schmelzen lässt. Die finanzielle Lage entspannt sich.
Dann kommt die Nacht vom 25. auf den 26. Juli 1943, in der 600 RAF-Bomber erneut Essen ansteuern. Schon seit geraumer Zeit nehmen britische Luftwaffenverbände die Rüstungszone Ruhrgebiet unter Feuer. Die Bombardements von März bis Juli 1943 finden als „Battle of the Ruhr“ Aufnahme in den Geschichtsbüchern. In besagter Juli-Nacht muss die „Kanonenstadt Essen“ mit 2.852 ausgebombten Häusern und zahlreichen zerstörten Industrieanlagen schwere Schäden hinnehmen. Zu den verwüsteten Arealen zählt auch das Rot-Weiss-Stadion. All die erfreulichen Ergebnisse und Tabellenplätze während der Kriegsjahre22 rücken schlagartig in den Hintergrund. Der westdeutsche Vereinsfußball, eh schon schwer bedrängt, kommt im September 1944 endgültig zum Erliegen.
Neustart nach dem Krieg
Über RWE in der NS-Zeit im Allgemeinen und über Georg Melches im Besonderen lässt sich in der Literatur nur wenig Detailliertes finden. Melches blickt 1945 als Mann im besten Alter auf eine schon jetzt äußerst intensive Funktionärslaufbahn zurück. Verbands- und Sportplatzangelegenheiten sind bei ihm in besten Händen. Auch so manchen guten Spieler kann Melches für die Rot-Weissen gewinnen. Dabei zeigt er beachtliche organisatorische Qualitäten, stets an der Sache orientiert und frei von Eitelkeiten. So muss Melches nicht unbedingt Vereinsvorsitzender werden. Das ist ihm zu repräsentativ, zu langweilig. Seine Stärken kommen zum Tragen, wenn er sein Netzwerk aktivieren, wenn er fünf Bälle gleichzeitig in der Luft halten, wenn er mit Worten und Ideen Freunde wie Gegner begeistern und überzeugen kann.
Sein Sport-Netzwerk ist über die Jahre organisch gewachsen. Es vermischt sich – Melches kennt da keine Berührungsängste – mehr und mehr mit seinen beruflichen, oft finanzstarken Kontakten. Zeitgenossen, Vereinshistoriker und Sportwissenschaftler, die sich mit dem frühen Mäzenatentum im Fußball auseinandersetzen, sprechen vom „System Melches“, das ihn vereinsintern unersetzlich macht und nach außen oft für den entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz sorgt. Ohne ihn gäbe es diesen erfolgreichen Verein Rot-Weiss Essen, der in den sieben Jahren bis zum Kriegsende in der höchsten Liga spielt und dabei auch für manch positive Überraschung sorgt, nicht. Man denke z.B. an das äußerst knappe 1:2 nach Verlängerung gegen den FC Schalke 04 im Tschammer-Pokal 1941 oder an den 4:2-Sieg gegen den ETB Schwarz-Weiß in der Gauliga am 4. Oktober 1942.
Melches bleibt RWE auch im letzten Jahr des Krieges erhalten. Fußball ist da schon lange nicht mehr das Wichtigste. Am 30. März befehlen Partei und Stadtverwaltung die "totale Räumung" von Essen. Doch viele Essener weigern sich. Sie wollen wie Oberbürgermeister Dillgardt in ihrer Stadt bleiben und nicht wie die Parteispitzen nach Winterberg oder weiß Gott wohin flüchten. Am 11. April 1945 ist der Spuk vorbei. Der Krieg endet durch den Einmarsch der US-Truppen, die in die Essener Innenstadt über die Haus-Berge- und die Pferdebahnstraße vordringen. Die Stadt wird im Rathaus von Oberbürgermeister Dillgardt an US-General Ridgway übergeben. Etwa zehn Wochen später, am 21. Juni, übernehmen britische Truppen das Ruhrgebiet. Alle Uhren werden jetzt auf null gestellt. Die Innenstadt ist fast vollständig zerstört. Die Einwohnerzahl liegt nur noch bei 310.000 Einwohnern gegenüber 648.000 vor dem Krieg. Die Straßen sind mit Schutt und Trümmern bedeckt. Etwa 250.000 Wohnungen sind leicht bis schwer zerstört. Die Essener Sportvereine stehen vor Sportanlagen mit Bombenkratern, zerstörten Hallendächern und beklagen den Verlust zahlreicher Mitglieder. Allein RWE wird später 112 Kriegsopfer unter den Rot-Weissen zählen.
Doch die britische Militärregierung sieht im Sport eine wichtige Aktivität, um die Leute zu beschäftigen und von destruktiven Gedanken abzubringen. So darf schon ab dem 3. August 1945 der Sportbetrieb wieder aufgenommen werden. Vierzehn Tage später meldet die „Ruhr-Zeitung“, inzwischen zum zentralen Mitteilungsorgan der Briten mutiert, dass fünfzehn Fußballvereine, einschließlich Rot-Weiss, wieder Spiele austragen. Und Mitte Oktober beginnen auch schon die Punktspiele um die Essener Fußballmeisterschaft.
Spätestens ab dem 31. August mischt auch Georg Melches wieder mit. Der erste Schock ist überwunden. Die Spannkraft, um selbst anzupacken und andere zu motivieren, kehrt zurück. Am besagten Augusttag organisiert Melches eine erste Vereinsversammlung an der Hafenstraße. Etwa 40 Mitglieder finden sich ein und erklären sich umgehend bereit, die Spielfläche gemeinsam herzurichten und den Spielbetrieb wiederaufzunehmen.
Wer das RWE-Stadion nach dem Luftangriff im Juli 1943 sieht, der weiß, dass der Wiederaufbau des Stadions und seiner Nebengebäude keine Sache von wenigen Wochen sein kann. Für die Komplettsanierung verabreden die Vereinsmitglieder deshalb ein Jahr später, am 6. September 1946, einen festen Tag in der Woche, an dem sich alle an der Baustelle einfinden wollen. Und so wird bereits Anfang Oktober 1948 auf der RWE-Mitgliederversammlung die Vollendung der ersten Etappe vermeldet. Der Platz verfügt wieder über eine gepflegte Rasenfläche und eine Lautsprecheranlage. Das Areal ist eingezäunt, die Tribüne repariert.
Sportlich zurück in die Spur
Die Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten sind das eine. Sportlich geht es zunächst um die Stadtmeisterschaft in fünf Gruppen. RWE qualifiziert sich zwar als Vizemeister für die Ruhrbezirksliga in der nächsten Saison. Stadtmeister wird jedoch der ESC Preußen Essen 02, was nicht zuletzt an einem gewissen August Gottschalk liegt.
Gottschalk ist an der Hafenstraße kein Unbekannter. Bereits von 1939 bis zum Kriegsende war der auffällige Offensivspieler für die Rot-Weissen aktiv. Melches hatte ihn damals als 17jährigen von seinem Stammverein, den Preußen, an die Hafenstraße gelotst, wo er mit einer Sondergenehmigung und einem robusten Körper – Gottschalk war noch einige Jahre zuvor als Gewichtheber in der Leichtgewichtklasse unterwegs – auf Anhieb die hohen Erwartungen erfüllen konnte. Auch jetzt nimmt Melches wieder Witterung auf. Und tatsächlich, „Schorsch“ Melches findet die richtige Tonlage und hat auch die richtigen Argumente im Gepäck. Der „Tank von Bergeborbeck“, wie Gottschalk in der Presse genannt wird, schlüpft zur neuen Saison erneut in die rot-weisse Kluft.
Neben Gottschalk kann RWE auch weiterhin auf erfahrene Kräfte wie Waldemar „Wally“ Brockmann, Fritz Abromeit, Erwin Zöllmann oder auch Josef „Jupp“ Gipka bauen, die schon viele Jahre das rot-weisse Trikot tragen. Doch überraschenderweise reicht es am Saisonende trotzdem nicht. RWE schließt die Saison als Tabellendritter ab, was nicht zur Qualifikation für die neue Oberliga West reicht. Ein Jahr später klappt es besser. Im Entscheidungsspiel besiegt RWE am 8. März 1948 in Duisburg den punktgleichen VfB Hilden 03 mit 2:1 und sichert sich so die Meisterschaft in der Landesliga Gruppe 2. Anschließend setzen sich die Rot-Weissen in der Aufstiegsrunde gegen die Meister der anderen Landesliga-Gruppen, den traditionsreichen Duisburger SpV (Gruppe 3) und TuRa 86 Essen (Gruppe 1), knapp, aber verdient durch. Mit einjähriger Verspätung erreicht RWE die Oberliga West. Eine Klasse, in der sich die Essener und ganz besonders Georg Melches gut aufgehoben fühlen. Vater Heinrich erlebt diesen Triumph noch mit, doch bald darauf heißt es Abschied nehmen. Heinrich Melches stirbt am 15. Februar 1949. Sieben Jahre später folgt ihm seine Ehefrau.
Die großen Jahre beginnen
Mit Aufstiegstrainer Raymond Schwab, der später, in den Sechzigerjahren, mit Vorwürfen bezüglich illegaler Spielervermittlung und Bestechung konfrontiert werden wird, geht es nun in die Oberliga. RWE schlägt sich prächtig, belegt nach Saisonende den zweiten Platz hinter dem späteren deutschen Vizemeister Borussia Dortmund, der in den ersten Oberliga-Jahren den Westen dominiert. Auch der RWE hat sich als Zweiter für die DM-Endrunde qualifiziert, muss allerdings nach der ersten Qualifikationsrunde gegen den Zweiten der Oberliga Nord, den FC St. Pauli, die Segel streichen. Die Hamburger haben dank der spendierfreudigen Schlachterei Miller viele gute Spieler an Bord, u.a. Walter Dzur, Fritz Machate, Heinrich Schaffer vom Dresdner SC, dem letzten Meister der Kriegsjahre. Die Hamburger „Wunderelf“ gewinnt am 29. Mai 1949 in Braunschweig vor 15.000 Zuschauern deutlich mit 4:1. Doch Georg Melches fühlt sich bestätigt. Das ist die große Fußballwelt, in der er seine Rot-Weissen sehen will. Und zu dieser Fußballwelt gehört auch zweifellos der Vertragsfußballer. Damit dieser endgültig und auf rechtlich-sicherer Grundlage kommt, arbeitet Melches ab Herbst 1949 gemeinsam mit seinen Kollegen Dr. Josef Drees (Vorsitzender Preußen Münster), Dr. Hermann Kracht (Vorsitzender Westfalia Herne), Franz Kremer (Vorsitzender 1. FC Köln) sowie den weiteren Teilnehmern Dr. Spickhoff (Wuppertal), Dr. Siegert (Schwelm) in einem vom Verband organisierten Ausschuss zum Thema Vertragsfußball mit.
Parallel treibt Melches den Wiederaufbau des Stadions voran. Ihm schwebt eine hochfunktionale Sportanlage vor, die aber gleichzeitig das Vereinsleben zum Schwingen bringt. Baumaterial und Arbeitskräfte organisiert Melches über die Zechen und Kokereien. So entsteht in den nächsten Jahren an der Hafenstraße ein Klubhaus, das über diverse Umkleide- und Duschräume, Büros und Gesellschaftsräume verfügt. Einige clevere Grundstücksgeschäfte mit den Bergwerken und der Stadt rund um das Stadion sorgen überdies für planerische Beinfreiheit und weitere Ausbauphantasien. Phantasien, die Melches wenige Jahre später konkretisieren wird.
Hinzu kommt eine kleine, heimelige Grünanlage hinter der Tribüne, für die sich rasch der Name „Kleine Gruga“23 einbürgert. In ihr befindet sich eine beeindruckende Bergmannsstatue, lebensgroß mit freiem Oberkörper. „Kurze Fuffzehn“ heißt die Bronzefigur in Anlehnung an die klassische Viertelstunde Pause im Bergbau. Und wohl auch an die fünfzehnminütige Halbzeitpause eines Fußballspiels. Die RWE-Stadionzeitung trägt noch heute diesen Namen.
Doch der Stadionausbau ist nicht die einzige Spielweise von Georg Melches. Zeitgleich knüpft der Koksofen-Manager, wo immer es geht, internationale Kontakte zu renommierten ausländischen Vereinen. Denn es herrscht allgemeine Aufbruchstimmung. 1948 sorgt die Währungsreform für volle Regale im Einzelhandel