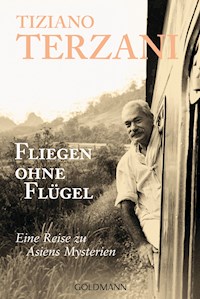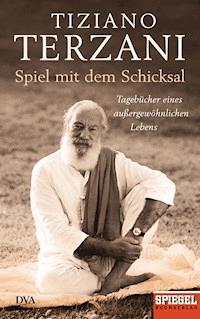
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Tagebücher eines grossen Weltbeobachters
Seine Tagebücher waren für Tiziano Terzani, langjähriger SPIEGEL-Korrespondent in Asien, Skizzenbuch für seine Reportagen und zugleich ein höchst privates Selbstzeugnis. Auf rund 3500 Seiten hat er, ein wunderbar aufmerksamer Beobachter, seit den 1980er Jahren seine Eindrücke aus Politik und Alltag festgehalten und sich dabei vor allem für Themen wie die Globalisierung, die Konsumgesellschaft, die asiatische Kultur und Philosophie sowie die Sinnleere der modernen Welt interessiert. Im Vergleich zu den veröffentlichten Reportagen sind seine Tagebuchaufzeichnungen persönlicher und unmittelbarer, auch suchender. Nachdem 1997 bei ihm Krebs diagnostiziert worden war, zog sich Terzani mehr und mehr zurück. Er beschäftigte sich von nun an zunehmend mit Meditation und fernöstlicher Lebensphilosophie und versuchte loszulassen von seinem rastlosen Leben. Die für diesen Band ausgewählten Einträge reichen bis kurz vor seinen Tod. Angela Terzani-Staude hat ein Vorwort verfasst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 846
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
»Ich werde 55, wie gewöhnlich ohne die Größe der Wende zu spüren, ich stelle sie mir aber groß vor und fasse große Vorsätze: diesmal regelmäßig und systematisch Tagebuch zu führen über die Jahre, die mir bleiben, das soll ein Tresor sein voll der Dinge, die der Strom des Lebens sonst mit sich nehmen würde. Werde ich das schaffen? Ich muss es schaffen. Gewiss ist das eine Art, die Zeit, die bleibt, zweimal zu leben.«
Der Journalist und hervorragende Asienkenner Tiziano Terzani hat jahrzehntelang seine Eindrücke und Gedanken über die Menschen, über Politik und Gesellschaft und die Spiritualität Asiens unmittelbar und lebendig in seinen Tagebüchern festgehalten. Sie sind das sehr persönliche Zeugnis eines großartigen Weltbeobachters und Geschichtenerzählers.
Der Autor
Tiziano Terzani,1938 in Florenz geboren, kannte Asien wie kaum ein anderer westlicher Journalist seiner Zeit. Von 1972 bis 1996 war er dort Korrespondent des SPIEGEL – anfangs in Singapur, dann in Hongkong, Peking, Tokio, Bangkok und Delhi. 1975 war er einer der wenigen westlichen Reporter, die in Saigon blieben, als Kommunisten die Stadt übernahmen. Anfang der 1980er Jahre konnte der Sinologe als einer der ersten Journalisten in Peking ein Korrespondentenbüro eröffnen. 1984 wurde er plötzlich verhaftet, antirevolutionärer Aktivitäten beschuldigt, einen Monat umerzogen und schließlich ausgewiesen. Nach mehrjährigen Aufenthalten in Japan und Thailand ging er 1994 nach Indien und hielt sich in den folgenden Jahren wechselweise in meditativer Abgeschiedenheit am Himalaja und in Italien auf. Im Sommer 2004 erlag Tiziano Terzani einer Krebserkrankung. Eines seiner bekanntesten Bücher ist »Das Ende ist mein Anfang. Ein Vater, ein Sohn und die große Reise des Lebens« (2007).
Tiziano Terzani
Spiel mit dem Schicksal
Tagebücher eines außergewöhnlichen Lebens
Vorwort von Angela Terzani Staude
Herausgegeben von Àlen Loreti
Aus dem Italienischen von Barbara Kleiner
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Un idea di destino. Diari di una vita straordinaria« im Verlag Longanesi, Mailand.
Copyright © 2014 Angela Terzani StaudeCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbHAlle Rechte vorbehaltenIn Kooperation mit dem SPIEGEL-Verlag, HamburgRedaktion: Ulrike SchimmingTypografie und Satz: DVA/Andrea MogwitzGesetzt aus der Goudy ModerneBook-Erstellung: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-15448–6
Inhalt
Ihr handelt, ich schreibe
Von Angela Terzani Staude
Tagebücher
1981–1984
1985–1990
1991–1994
1995–1999
2000–2003
Rede aus Anlass der Hochzeit von Saskia und Christopher
Nachbemerkung des Herausgebers
Dank
Anmerkungen
Ihr handelt, ich schreibe
Von Angela Terzani Staude
Ein paar Monate, nachdem Tiziano in Orsigna gestorben war, fuhr ich nach Florenz, um mir sein Büro anzusehen. Alles war in Ordnung und aufgeräumt: rasch, aber sinnvoll in Schachteln und Kartons verstaut, die ihm in den 25 Jahren Arbeit in Asien in die Hände gefallen waren. Er mochte alte und etwas abgenutzte Dinge, sie hatten die Patina der Geschichte. Neuerungen interessierten ihn nicht sonderlich, außer es waren solche technischer Natur.
Als ich ihn kennenlernte, da war ich achtzehn, zeigte er mir seine Olivetti Lettera 22, die damals der letzte Schrei war und das italienische Design in die ganze Welt trug. Das war sein einziger Besitz, und er war stolz darauf. Als ein Florentiner Techniker aus Übereifer die alten, etwas abgewetzten Tasten durch neue ersetzte, war Tiziano verzweifelt: Der Mann hatte seiner Schreibmaschine die Geschichte genommen, die Freuden und die Leiden, die er beim Schreiben darauf übertragen hatte und die sie zu seiner machten! Er musste die Tasten wieder auswechseln.
1972 zogen wir mit unseren damals noch ganz kleinen Kindern Folco und Saskia und vier Koffern nach Singapur. Mit seiner Lettera 22 machte Tiziano sich gleich ans Werk und schrieb seine ersten Berichte über den Vietnamkrieg; für Aufzeichnungen und Interviews dagegen benutzte er Notizhefte, die genau in die Brusttasche seiner weißen Hemden passten. Von diesen Notizheften finde ich einige Hundert in der schweren Renaissancetruhe in seinem Büro: Auf den ersten sind verschiedene vietnamesische Schönheiten abgebildet, die späteren haben fast alle einen schönen blassblauen Einband.
Ich blieb mit den Kindern in Singapur, meine Mußestunden brachte ich unter einem riesigen Baum mit lila Blüten zu und schrieb Tagebuch. Darum beneidete mich Tiziano. Er hat es immer für wichtig gehalten, eine Spur der eigenen Tage zu hinterlassen, aber er hatte keine Zeit dazu. In Saigon brach er frühmorgens auf an die Front, kam zurück ins Hotel Continental, um seinen Artikel zu schreiben, von dort eilte er zur AFP und gab ihn per Telex durch, dann machte er sich noch einmal auf, um einen Informanten zu interviewen oder die neuesten Gerüchte zu überprüfen. An den tropischen Abenden aß er mit den Kollegen in den Restaurants am Mekong, und sie redeten dabei weiter von den Ereignissen des Tages. Jede verlässliche Information landete in seinen Notizheften. Aus diesen Heftchen mit der energischen, fantasievollen und ein bisschen ungezügelten Schrift – für mich fast nicht zu entziffern, aber manchmal auch für ihn selbst nicht – sind zwölf Jahre lang Artikel und Korrespondentenberichte für den SPIEGEL, Il Giorno, L’Espresso und La Repubblica hervorgegangen sowie seine ersten beiden Bücher über den Vietnamkrieg.
1973 schreibt Tiziano in Singapur Pelle di Leopardo(Leopardenfell) und 1975 in Orsigna Giaiphong! La liberazione di Saigon(Giai Phong! Die Befreiung von Saigon), und ich erinnere mich, dass er, wie um die euphorische Stimmung des Kriegsendes aufrecht zu erhalten, vietnamesische Befreiungslieder hörte, die Notizhefte über den ganzen Tisch verstreut, und von nichts anderem reden und hören wollte. Die Niederlage der Amerikaner durch die Hand der kommunistischen Revolutionäre war für ihn ein persönlicher Triumph, sie stellte die Befreiung der Kolonialisierten von den Imperialisten dar, die Revanche der Unterdrückten für ihre Demütigungen. Der Traum seiner Generation, den er als Journalist unterstützen wollte, war in Vietnam Wirklichkeit geworden. Er weinte vor Freude, als die kommunistischen Panzer in Saigon einrollten. Über dem Schreibtisch in seinem Büro hängt noch immer ein Porträt von Ho Chi Minh, dem Vater der vietnamesischen Revolution.
Doch sein eigentliches Ziel war China. Er hatte sich lang darauf vorbereitet, hatte an zwei amerikanischen Universitäten Sinologie studiert: Er schlug den Revolutionären in Peking vor, uns als Köche, Übersetzer, Sprachlehrer oder sonst etwas anzustellen; er hatte sogar einen Aufsatz über Maos großes Experiment der sozialen Umgestaltung geschrieben, eine Umwälzung, wie die Welt sie noch nicht erlebt hatte und die ihn maßlos interessierte. Aber natürlich bekam er keine Antwort, und das Buch ist nie erschienen.
1975 wurde Tiziano Asienkorrespondent des Nachrichtenmagazins DER SPIEGEL, und wir zogen nach Hongkong, das damals noch eine englische Kolonie vor den Toren des riesigen China war. Und von dort aus unternahm er einen erneuten Vorstoß. Er suchte den Kontakt zu Kommunisten vor Ort, befreundete sich mit einem jungen chinesischen Journalisten, dem er sich so nah fühlte, dass er ihn »Bruder« nannte; er fragte einen gebildeten alten Jesuiten um Rat, Pater Ladány, der seit 30 Jahren im Auftrag des Vatikans China beobachtete. Im Januar 1980 schließlich war er einer der ersten Journalisten, die in Peking zugelassen wurden, und er eröffnete ein Korrespondentenbüro. Wir folgten ihm am Ende des Sommers, zusammen mit unserem Hund Baolì.
Aber die Enttäuschung kam bald. 1981 beginnt Tiziano seine ersten chinesischen Tagebücher auf der Maschine zu tippen. Es handelt sich um kurze, sporadische Reflexionen auf Durchschlagpapier und losen Blättern, der Tenor ist bereits skeptisch und pessimistisch. Er reist durch das Land, und schon die ersten Eindrücke bestätigen das, was ihm von Anfang an evident zu sein schien: Die Wirtschaft steht vor dem Kollaps, die Menschen sind traurig, arm und verängstigt, es herrscht ein Klima der Angst und der Bespitzelung. Millionen Menschen in Umerziehungslagern, Dutzende Millionen Tote. Die Kulturrevolution, die erst kürzlich zum Stillstand gekommen war, hatte Klöster, Buddha-Statuen, Pagoden, Denkmäler, öffentliche und private Bibliotheken zerstört und damit nicht nur die Schicht der Gebildeten vernichtet, sondern auch die materiellen Spuren der alten Kultur des Landes. Die sozialistische Moderne, dieses schöne Projekt, in das auch Tiziano so große Hoffnungen gesetzt hatte, ging zugrunde, wie zuvor schon in Kambodscha unter Pol Pot.
Seine Reportagen lassen keinen Zweifel an seinen Einschätzungen, und am 8. Februar 1984 wird er auf dem Rückweg von Hongkong von der Sicherheitspolizei am Flughafen Peking festgehalten. Man beschlagnahmt seinen Reisepass und zwingt ihn, eine »Selbstkritik« zu schreiben, in der er seine Vergehen gesteht: Mao beleidigt zu haben und im Besitz chinesischer Kunstschätze zu sein. Auch wird ihm verboten, irgendjemandem gegenüber ein Wort über das zu verlieren, was ihm zustößt, andernfalls droht die Deportation in ein Arbeitslager oder Gefängnis.
Schon 1983 hatte Tiziano aufgrund einiger merkwürdiger Vorkommnisse geahnt, dass jemand dabei war, ihm eine Falle zu stellen, deshalb hatte er mich, Folco und Saskia im Herbst nach Hongkong zurückgeschickt. Er kam von einem Besuch bei uns zurück, als man ihn festnahm. 36 Stunden nach seinem unerklärlichen Verschwinden aus der Wohnung in Peking, wo ich ihn zu keiner Tages- und Nachtzeit telefonisch erreichen konnte, setzte er sich endlich mit mir in Verbindung, um mir vage anzudeuten, dass ihm etwas zugestoßen sei und dass wir nur über »Brieftauben«, das heißt Reisende, die unsere Nachrichten persönlich überbringen würden, miteinander kommunizieren könnten.
Das Verbot, etwas über seine Festnahme verlauten zu lassen, galt auch für mich, weshalb ich in aller Heimlichkeit nur zwei Personen in Hongkong kontaktiere: den »Bruder« und Pater Ladány. Ich rufe auch beim SPIEGEL an und bei unserem Freund Bernardo Valli, der damals für La Repubblica aus London berichtete. Keiner von ihnen weiß, was er mir raten soll. In Peking tut Tiziano so, als wäre alles in Ordnung, aber es kursieren Gerüchte über einen Journalisten in Schwierigkeiten, und die Kollegen beginnen nachzuforschen. Bei mir in Hongkong taucht ein befreundeter Diplomat auf, aus dessen Fragen ich schließe, dass er ein doppeltes Spiel spielt, und ich fühle mich in die nebulöse Welt der Spione und Geheimdienste versetzt. Außerdem weiß ich, dass die Chinesen subtile Psychologen sind und Tizianos erklärten Wunsch, weiterhin in China leben zu können, ausnützen werden, um Katz und Maus mit ihm zu spielen, und dass dieses Spiel ihn am Ende zerstören wird.
Drei Wochen verstreichen, ohne dass sich etwas tut, meine Ratgeber in Hongkong sind besorgt und legen mir nahe, eine »allerhöchste Instanz« einzuschalten. Im ersten Moment ist mir nicht klar, dass sie den Präsidenten der Republik Italien, Sandro Pertini, meinen. Doch dann versuche ich umgehend, den Kontakt zu ihm herzustellen, auch wenn das nicht leicht ist.
Endlich, am 5. März 1984, wird Tiziano aus China ausgewiesen.
Voll bepackt mit Koffern – den Rest seiner Habe hat er in der italienischen Botschaft in Peking gelassen – landet er in Hongkong. Er ist erschöpft und desorientiert, hat sich aber vollkommen in der Hand. Der SPIEGEL bestellt uns nach Hamburg, und vor versammelter Mannschaft von Redakteuren und Herausgebern wird Tiziano einer peniblen Befragung unterzogen: Die Möglichkeit, dass ein Journalist für den Geheimdienst eines anderen Landes arbeitet, ist nie auszuschließen. Die Entscheidungen, die am Ende getroffen werden, fallen jedoch alle zu seinen Gunsten aus. Der SPIEGEL und danach LaRepubblica veröffentlichten seinen Artikel mit der detaillierten Schilderung seiner Ausweisung, den Tiziano trotz der Drohungen der chinesischen Polizei hatte schreiben können und unter dem Titel Love Letter to a Wife (Liebesbrief an eine Ehefrau) von Peking nach Hongkong geschmuggelt hatte. Die inkriminierten Artikel werden noch im selben Jahr zu einem Buch zusammengefasst und publiziert, zunächst in Deutschland unter dem Titel Fremder unter Chinesen, wenige Monate später in Italien unter dem Titel La porta proibita.
Nach der Ausweisung aus China bietet der SPIEGEL Tiziano ein anderes Einsatzgebiet an: Tokio.
Von China ist zwischen uns nicht mehr die Rede. Nur einmal, als er in den letzten Tagen sein Leben überdachte, sagte Tiziano mir, wenn Indien ihm geholfen habe, seine Gelassenheit wiederzufinden, so sei China das Land gewesen, in dem er am liebsten gelebt habe. An den Chinesen gefiel ihm, wie sie den Alltag meisterten, wie sie zu »spielen« verstanden, auch mit dem Schicksal, ihre Beharrlichkeit.
Im Büro in Florenz sehe ich über dem Faxgerät eine Karikatur hängen, die Folco unmittelbar nach der Ausweisung aus China gezeichnet hat. Sie zeigt wie Tiziano aus China rausfliegt: Ein Fuß in einem chinesischen Pantoffel hat ihm soeben einen Tritt versetzt, und er hält auf den in der Luft ausgestreckten Beinen eine Schreibmaschine, auf deren Tastatur er wild einhämmert.
Die Zeichnung illustriert sehr gut seine Beziehung zur Macht: »Ihr handelt«, sagte er, »ich schreibe.« Darin sah er seine Rolle, daraus schöpfte er seine Kraft und seine Freiheit.
Unter den Ordnern mit veröffentlichten Artikeln entdecke ich eine dicke Mappe, mit Tesafilm verklebt und doppelt verschnürt, darauf mit schwarzem Stift die Aufschrift: »NEIBU«, was auf Chinesisch heißt »nur für den internen Gebrauch bestimmt«, nicht in Umlauf bringen. Es ist das Dossier, das Tiziano, bevor er Peking verließ, einem australischen Diplomaten anvertraute, der in den Tagebüchern Deep Throat (»tiefer Schlund«) genannt wird, damit er es nach Hongkong bringe. Ich öffne es und sehe, dass es nur Material rund um seine Ausweisung aus China enthält – von »Brieftauben« überbrachte Botschaften, Treffen mit chinesischen Funktionären, Inventarlisten der Polizei, Schriftverkehr mit den beiden Botschaften, meine verschlüsselten Notizen, seine Anmerkungen, Papiere, Zettel und Telegramme. Zuoberst auf dem Stapel liegt ein Blatt Papier mit einem Gedicht:
Sag mir,
geliebter Computer,
ist die Welt, in der du geboren wurdest,
neu, oder bist du verdammt,
nur der Spiegel zu sein
eines alten,
gescheiterten,
unvollendeten Gedankens,
der den Pfad der Vernunft
verloren hat?
Computer
Hongkong, 25. Dezember 1983
Tiziano Terzani an seine Frau, die verzweifelt ist über die Einführung des Computers ins menschliche Leben.
Ich muss lachen. Wie er sich aufregen konnte über meinen Widerstand gegen technische Neuerungen, die ihn hingegen faszinierten. Dieser klobige Computer, den er Weihnachten 1983 anschaffte, war ihm überaus nützlich beim Verfassen und ständigen Neuschreiben seiner »Geständnisse«, wozu die Chinesen ihn zwangen. Er änderte ein paar Worte, druckte aus und gab die neue Fassung ab. Die chinesischen Polizisten ahnten ja nichts von der Existenz eines Computers in seinem Leben!
Von diesem Zeitpunkt an gibt Tiziano seine alte Lettera 22 auf und arbeitet nur noch mit dem neuen Gerät. Offenbar war er der Erste unter den Korrespondenten in Hongkong, der mit einem Computer arbeitete, und sicherlich mit Abstand der Erste unter den Journalisten des SPIEGEL. Er ist fasziniert, verbringt Stunden davor, ist begeistert von den enormen Möglichkeiten der Maschine. Er beschließt, den PC zu benutzen, um regelmäßig Tagebuch zu führen, was für seine künftige Produktion ausschlaggebend sein wird. Von diesem Zeitpunkt an sind seine Tagebücher also »technisch«, er schreibt sie nicht mehr wie früher von Hand in schöne, individuell gestaltete Hefte, er tippt sie nicht mit der Maschine und legt sie in Ordnern ab, sondern verfasst sie am PC und speichert sie auf Disketten.
Ich finde Schachteln voll solcher Disketten. Auf jeder in Schwarz, Violett oder Rot die Aufschrift »Tagebuch«, gefolgt von der Jahreszahl. Ich drucke eine aus, und es ist, als würde Tiziano selbst in diesen Zeilen wieder lebendig. Es ist, als ob ich das warme Timbre seiner Stimme wieder hörte, sein lebhaftes Sprechen, bald provozierend und überschäumend, bald nervös und irritiert von düsteren Gedanken. Ich bin beeindruckt von der Tatsache, dass die Texte wirklich »geschrieben« sind, es gibt keine halbfertigen Sätze oder nur angedeutete Gedanken.
Und noch etwas anderes beeindruckt mich in diesen Tagebüchern, etwas, was in seinen Büchern nicht zu Tage tritt: die starken Stimmungsschwankungen, dieses Hin- und Hergerissensein zwischen Begeisterung und Verzweiflung, Zweifeln, Gewissheiten und erneuten Zweifeln, zwischen Wut und heiterer Gelassenheit. Seine sehr hohen Ansprüche, vor allem an sich selbst, stürzten ihn in entsprechend tiefe Enttäuschung über die Wirklichkeit, notwendigerweise auch über die Familie. Dann ließ er einem keinen Raum, schenkte niemandem Vertrauen, vor allem seinen Kindern nicht. Im chinesischen Horoskop war Tiziano im Zeichen des Tigers geboren, der nächtlich dunklen Tiger-Mutter. Eine Familie zu schaffen und zu beschützen, lag in seiner Natur. Ohne den sicheren Rückhalt in der Familie hätte er sich in der Welt nicht durchfinden können, daran gab es für ihn keinen Zweifel, und auch als die langen Zeiten des Alleinseins fast unerlässliche Bedingung für seinen inneren Frieden geworden waren, verlor er doch keinen von uns je aus den Augen. Es war schön, sich so geliebt und beschützt zu fühlen, aber es war auch schwierig, so oft hören zu müssen, wie man sein sollte und was man zu tun hatte. Aber merkwürdig, das alles hat uns sehr verbunden, uns untereinander und mit ihm.
Ich finde es schön, heute in den Tagebüchern auch diese seine andere Stimme vernehmen zu können, die zornige, zweifelnde, leidende, die den Kontrapunkt zu der kräftigen und überzeugten Stimme bildet, mit der er sich der Welt präsentierte. Es ist, wie die ins Dunkel der Erde hinabreichenden Wurzeln eines Baumes zu entdecken, der seine Wipfel dem Himmel entgegenreckt.
Die Idee, diese Tagebücher zu veröffentlichen, kam mir sofort. Aber die Entscheidung, wann und wie, mit welchem Herausgeber und nach welchen Auswahlkriterien, hat einige Zeit gebraucht.
Natürlich hatte Tiziano sie für sich selbst geschrieben. Er brauchte einen stummen Gesprächspartner, stets bereit zuzuhören, so wie er ein virtuelles Archiv brauchte, dem er das anvertraute, was ihm tagsüber begegnete oder durch den Kopf gegangen war, sodass er beim Schreiben darauf zurückgreifen konnte. Er sagte, er sei nicht imstande, etwas zu erfinden, nichts erscheine ihm fantastischer als die Wirklichkeit.
Ich glaube nicht, dass er dieses ganze Material unter Verschluss halten wollte: Sonst hätte er die Tagebücher nicht so wohlgeordnet, durchnummeriert, gut sichtbar in seinem Büro liegen lassen. Ich sehe ihn noch, wie er in den letzten Monaten seines Lebens mitten in der Nacht aufstand, um von seinen Laptops all das zu löschen, was mit ihm verschwinden sollte. Von dem, was blieb, hätte er, wenn wir ihn gefragt hätten, dasselbe gesagt wie von all den schönen Dingen, die er gesammelt und stets eifersüchtig gehütet hatte: »Macht damit, was ihr wollt.«
Auch weil der eine oder andere sich eines Tages in seinen Texten wiedererkennen konnte, was ihm diesen »kleinen Moment von Ewigkeit« bescheren würde, den er sich in seinem Buch Fliegen ohne Flügel wünschte.
Schließlich haben wir alle Disketten ausgedruckt, und der Papierstapel war fast einen Meter hoch. Alles findet sich darin: Begegnungen, Eindrücke, Überlegungen, auf Englisch geführte Interviews, Hintergründe des politischen Geschehens, Spaziergänge durch alte und neue Welten, Tiere, Sonnenauf- und -untergänge, Briefe an die Familie … Besonders berührt hat mich der ergreifende Brief an Saskia über das sterbende Macau, das von der Modernisierung zerstört wird. Eine Stadt! Wie sehr kann man eine Stadt lieben? So sehr wie einen Menschen, wie das Leben selbst. Und Tiziano hat viele Städte geliebt.
1985 kommen wir nach Tokio. Tiziano ist neugierig, Japan kennenzulernen, damals das einzige asiatische Land, dem die Modernisierung gelungen war und das den Westen bereits mit seinen Autos und seinen elektronischen Gadgets überschwemmte. Der Preis für eine derart florierende Wirtschaft – das sieht Tiziano sofort – ist hoch, immens hoch. Die Amerikanisierung, die in Japan bereits vor über einem Jahrhundert einsetzte, hat die traditionelle japanische Kultur unter sich begraben, und das Land wird von einem einzigen Ideal beherrscht, das nicht mehr sozial und auch nicht mehr politisch ist, sondern einzig auf Produktion und Gewinnmaximierung beruht.
Tiziano hat jedoch den Eindruck, dass der imperialistische Traum des Dai Nippon, der Herrschaft Japans über ganz Asien, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts voller Ambition gehegt wurde und erst mit der Niederlage des Landes im Zweiten Weltkrieg unterging, irgendwo noch weiterlebt. Er wittert ihn, kaum in Tokio angekommen, im pompösen Patriotismus des schintoistischen Yasukuni-Schreins, wo der in den Schlachten des 20. Jahrhunderts gefallenen Soldaten gedacht wird. Diesem Traum hatte auch der Schriftsteller Yukio Mishima angehangen, der aus Protest gegen sein geschichtsvergessenes Land 1970 durch traditionelles Harakiri Selbstmord beging.
Den Reden, oder besser, wie er sagte, dem »Nachhall der Reden« von Leuten wie Premierminister Nakasone und anderen Männern der regierenden Rechten lauschend, gewann Tiziano den Eindruck, als ob tatsächlich ein Teil des Landes durch einen Geheimplan jenem glorreichen Traum verhaftet geblieben wäre, der 1988, während der Agonie von Kaiser Hirohito, kurz noch einmal aufflammte. In Wirklichkeit aber bestand Japans Ehrgeiz darin, eine wirtschaftliche Großmacht zu werden, ein Ehrgeiz, der durch die Globalisierung, von der man damals zu reden begann, noch bestärkt wurde.
Bereits traurig über das Scheitern des Sozialismus und den Verlust seines chinesischen »Gartens«, sieht Tiziano, als ihm klar wird, dass die Zukunft von einem ungehemmten und unkontrollierbaren Wachstum beherrscht sein wird, keine Rolle mehr für sich und verfällt in eine bedenkliche Depression, von der er sich nie mehr ganz erholen wird.
»Wenn das unsere Zukunft ist«, sagt er dem Freund Paolo Pecile, als er im Sommer nach Florenz kommt, »dann will ich sie nicht sehen.«
Seine Begeisterungsfähigkeit wird zum Teil wiederbelebt durch die »gelbe Revolution« auf den Philippinen – eine Revolution der alten Art, wie er sie mochte: Das ganze Volk protestierend auf den Straßen. Ausgelöst durch die Ermordung des Oppositionsführers Ninoy Aquino, brachte sie Präsident Marcos zu Fall, und Cory Aquino, Ninoys Witwe, kam an die Macht. In diesen zwei Jahren fährt Tiziano oft nach Manila, er wird gern gesehener Gast in der Familie Aquinos, von dem es hieß, er habe in Amerika Tizianos Bücher über die Befreiung Vietnams gelesen. Tiziano taucht ein in das fröhlich resignierte Leben der Philippinen, die, so sagte er, von den Völkern Asiens das sympathischste seien.
»In Manila trete ich ans Fenster, und ich sehe das Leben vorüberziehen«, erklärte er mir. »In Tokio sehe ich nichts.«
Das war das Grauen für ihn: nichts zu sehen. Denn, so wiederholte er immer wieder, sein Kopf sei leer, er brauche also Stimuli von außen, die er aufsauge wie ein Schwamm und auf die er dann reagiere.
Im Gegensatz zu China, wo in jenen Jahren alles zur Diskussion gestellt wurde, wo die Politik und das Leben noch einmal neu definiert wurden und in wer weiß welche Richtung aufbrachen, erschien ihm Japan reglos, im Materialismus erstarrt.
Im Sommer 1990, nach fünf schwierigen Jahren und bevor wir nach Bangkok übersiedeln, erprobt Tiziano zum ersten Mal eine Lebensform, die ihm neue Kraft gibt und auf die er auch in Zukunft mehrfach zurückgreifen wird: Er beschließt, in der Gegend von Daigo einen Monat in vollkommener Einsamkeit zu verbringen. Er will in Ruhe nachdenken, seine Schlüsse ziehen und womöglich ein Buch über Japan schreiben. Er bricht mit Baolì auf, in dem roten Toyota, den er schon in Peking fuhr, aber einmal in der Ruhe der Landschaft um Daigo angekommen, lässt er das Buchprojekt fallen, schläft, beschäftigt sich mit dem Hund und schickt Faxe über das wiedergefundene Glück an die in Orsigna versammelte Familie. Erst da beginnt er, nach langem Schweigen wieder Tagebuch zu schreiben, und diese Faxe werden darin aufgenommen.
1990, die letzten Tage des alten Bangkok. Wir beziehen das schönste Haus unseres Lebens in Asien, »Turtle House«, das Schildkröten-Haus, ganz aus Holz, halb von Termiten zerfressen, aber mit einem Teich unter Palmen und Mangobäumen, in dem eine riesige Schildkröte lebt. Anfangs hat Tiziano seinen Spaß daran, er kauft Fische, bringt zwischen den Pflanzen versteckte Lampen an, aber der schwarze Hund der Depression, von dem Churchill schreibt, kehrt an seine Seite zurück. In dem Wissen, dass nur dann, wenn er in Bewegung ist, sein Herz sich wieder öffnet und die Angst weicht, geht er erneut auf Reisen.
Im Sommer 1991 ist er mit einer chinesisch-sowjetischen Expedition auf dem Fluss Amur unterwegs, als er erfährt, dass Gorbatschow gestürzt wurde. In Chabarowsk, am äußersten östlichen Ende des Sowjetreichs, geht er von Bord, um durch Sibirien, Zentralasien und Russland bis Moskau zu reisen und nach 70 Jahren Kommunismus dem Zusammenbruch der UdSSR beizuwohnen. Er reist mit einem Laptop, auf dem er Tag für Tag seine Eindrücke und Gedanken festhält, und am Ende der Reise ist das Buch praktisch fertig. In einem Monat der Überarbeitung in seinem Büro in Bangkok, mit Blick auf den Teich und die Kokospalme, die aus dem Dach herauswächst, macht er aus den Tagebuchaufzeichnungen das Buch Gute Nacht, Herr Lenin.
Es ist ein Abschied vom Kommunismus, ohne Wut und ohne Häme. Im Gegenteil, Tiziano empfindet großes Mitgefühl mit denen, die ihr Leben der Idee des Sozialismus geweiht haben, und er widmet das Buch dem Andenken seines Vaters, der ebenfalls diesem Traum anhing. Mit dem Zusammenbruch der UdSSR ist der Traum vom Kommunismus definitiv an sein Ende gelangt, um nur auf dem kleinen Kuba noch weiterzuleben. Schon während er durch die zentralasiatischen Staaten reist, bemerkt Tiziano, dass die Lenin-Statuen mit dem Ruf »Allahu akbar!«, Allah ist groß, gestürzt werden und er sieht als einer der ersten voraus, dass der Islam die neue Religion der Entrechteten sein wird.
Im selben Jahr, 1991, wird Kambodscha, das sich nach dem Pol-Pot-Regime nicht mehr erholte, einer UN-Übergangsregierung unterstellt. In zwei Jahren fährt Tiziano mehrmals nach Phnom Penh, eine Stadt, die er in Kriegszeiten, als sie noch schön, buddhistisch und in ihre Mythen eingebettet war, zutiefst liebte. Manchmal fährt er in Gesellschaft seines französischen Freundes Poldi hin, der in Bangkok lebt, und jedes Mal ist er bestürzt. Das Volk der Khmer ist traumatisiert, von Leiden entkräftet. Es ist ein unschuldiges Volk, weltfremd und in dunklen Prophezeiungen gefangen: Zu was soll es gut sein, dieses Volk noch weiter zu verwirren, indem man ihm unsere Werte aufzwingt, Demokratie, freie Wahlen, ganz zu schweigen von Prostitution, Drogen und Korruption, die die gut bezahlten Angehörigen der internationalen Organisationen unweigerlich ins Land schleppen? Warum überhaupt diese Organisationen dort hinbringen?
Tiziano kehrt immer erschütterter, düsterer und nervöser nach Bangkok zurück, unentschlossen, was zu tun sei. Schreiben erscheint ihm mittlerweile sinnlos. »Ich verspüre Angst vor den alten Gespenstern der Depression, die ständig bereit sind, mir wieder an die Kehle zu springen. Ich begreife, dass sie ihren Ursprung auch in der Politik haben«, vermerkt er am 24. September 1992 in seinem Tagebuch.
Es ist an der Zeit, einen neuen »Blickwinkel« zu finden.
1992 erinnert er sich zufällig – auch wenn nichts »zufällig« geschieht, den Zufall gibt es nicht, sagte er, der Zufall, das sind wir – an die Prophezeiung eines chinesischen Wahrsagers in Hongkong, der ihn 1976 gewarnt hatte, er solle im Jahr 1993 kein Flugzeug besteigen. Und 1993 stand vor der Tür! Er bricht erneut auf, wie er in dem neuen Tagebuch bemerkt, das zu schreiben er sich anschickt: »Die Wahrheit ist, dass ein Mensch mit 55 Jahren große Lust verspürt, sein Leben mit einem Schuss Poesie zu würzen, die Welt mit neuen Augen zu betrachten, die Klassiker wieder zu lesen, wieder zu entdecken, dass die Sonne aufgeht, der Mond am Himmel steht und die Zeit nicht nur eine mit der Uhr messbare Einheit ist.«
Er genießt diese Langsamkeit, dieses Leben mit dem Boden unter den Füßen, die vielen »zufälligen« Begegnungen wie ein Reisender der Vergangenheit, dennoch erforscht er mit dem Blick des Journalisten, der verstehen will, die Städte, die Lebensformen, die politischen Systeme und die Überlebensstrategien, die ihm unterwegs begegnen. Da heutzutage nun einmal die Möglichkeit der Erneuerung und der Modernisierung besteht, ist die schöne Welt der Vergangenheit zum Verschwinden bestimmt, das ist ihm klar. Und während er auf dem Mekong entlangfährt und am einen Ufer das von Öllämpchen gesprenkelte Dunkel von Laos sieht und am anderen die Scheinwerfer der Autos und die Neonlichter Thailands, fragt er sich: »An welchem Ufer liegt das Glück?« Wie viel von der alten, vertrauten Welt sind wir bereit aufzugeben, und was bekommen wir im Tausch dafür von der neuen? Die Antwort ist so komplex, dass Tiziano sie nie finden wird; umso dringlicher erscheint es ihm, dass die Menschheit und ihre Führer sich diesem Problem stellen.
Am Ende eines Jahres der Reisen durch Asien und Europa entsteht das Buch Fliegen ohne Flügel. Als einzige Passagiere neben 2000 Containern kehren wir an Bord eines Frachters des Lloyd Triestino nach Bangkok zurück, 19 Tage dauert die Fahrt auf der alten Schifffahrtsroute von La Spezia nach Singapur. Da gab es nur Meer und Himmel zu sehen.
In einem kleinen Haus in Ban Phe, an einem langen weißen Sandstrand am Golf von Thailand beginnt Tiziano, sein Buch zu schreiben. Aber zu viel hat er auf seiner langen Reise gesehen und bedacht, nicht alles wird Eingang ins Buch finden, vieles bleibt in den Tagebüchern aufbewahrt.
Und die Wahrsager! Was für ein wunderbarer Ausweg aus den Ängsten und Nöten des Alltags sind für die asiatischen Völker ihre Wahrsager, die Meditation, die religiösen Riten, die Spiritualität. Sie sind eine Lebenshilfe, die wir im Westen im Namen der Rationalität und der Wissenschaft endgültig verspielt haben. Als Entdecker, der er ist, und auch als jemand, dem die Angst so nah ist wie sein Schatten, möchte Tiziano versuchen, diese verschütteten Wege wieder freizulegen.
Schon im nächsten Jahr bittet er um seine Versetzung nach Indien. Dort sind die Vergangenheit und das traditionelle Wissen noch am Leben, auch wenn das Land sich schnell den neuen Zeiten anpasst. Es war ein Schock zu entdecken, dass Coca-Cola gleichzeitig mit uns in Delhi Einzug hielt.
Zwei Jahre lang bereist Tiziano als Journalist den Subkontinent – Indien, Kaschmir, Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka –, immer mit seinem Computer, in den er seine Tagebuchnotizen eingibt. Entdeckungsreisender von Natur aus, kann er freilich nichts Romantisches mehr in dem Asien ausmachen, das sich modernisiert, in den Millionen hupender Three-Wheelers – den dreirädrigen Motorrikschas – Autobussen, Motorrädern, Lkw, alle mit Verbrennungsmotor, die die Luft in eine »Gaskammer« verwandeln, wie er mir aus Pakistan schreibt. Er hat genug von den Ländern in chaotischem Wandel, genug auch von den Muezzin, die nicht mehr mit volltönender Stimme zum Gebet rufen, sondern durch krächzende Lautsprecher, die ihn im ersten Morgengrauen aus dem Bett reißen.
Haben sie vielleicht nicht das Recht dazu? Haben wir nicht auch unsere Modernisierung durchgemacht?
»Ich fühle mich wie gestern auf dem Balkon dieses baufälligen Hauses, zwischen dem ›Doktor‹ bei Kerzenschein und dem jungen Moslem mit seiner modernen Computerschule. Ich bin immer dazwischen, immer ein Pendler zwischen diesen beiden Welten: einer alten Welt, die ich nicht verlieren will, und einer neuen, auf die zu verzichten mir absurd und unlogisch vorkäme«, bemerkt er in seinem indischen Tagebuch.
Das sind Probleme, die sich mit den Mitteln des Journalismus nicht lösen lassen. So groß war Tizianos Wunsch, sich auf diese Fragen zu konzentrieren, dass er Ende 1996 in einer plötzlichen Entscheidung beim SPIEGEL seine Frühpensionierung beantragt.
So fühlt er sich entbunden von der Pflicht denen gegenüber, die ihm ein Gehalt bezahlten, die ihm eine Last war, nicht aber von der Verantwortung gegenüber dem Leben. An Plänen mangelt es ihm nicht. Wenige Monate später jedoch, während er noch auf der Suche ist nach einem Ort, wohin er sich zurückziehen kann, wird Magenkrebs bei ihm festgestellt. Es ist der Frühling des Jahres 1997, er ist 58 Jahre alt. Seit einer Weile schon war er unruhig, sah Ungutes voraus, aber bestimmt nicht Krebs.
Alles muss neu überdacht, verändert und umorganisiert werden. Nur auf eines der alten Projekte will er nicht verzichten: Hongkong. Die letzte und erstaunlichste aller britischen Kolonien, wo Folco und Saskia zur Schule gegangen sind und wir als Familie acht wunderschöne Jahre verlebt haben, wird am 30. Juni 1997 an China zurückgegeben: Damit endet der Kolonialismus und die Vorherrschaft des weißen Mannes in der Welt, ein Augenblick von größter historischer Bedeutung. Tiziano, der seit seinen Studientagen in Pisa von Entkolonialisierung sprach, darf bei diesem letzten großen Termin des 20. Jahrhunderts nicht fehlen. Wir fahren gemeinsam hin, wir wohnen in zwei kleinen Zimmern am Fuß des Peak, unter Chinesen, nur ein paar Schritte vom FCC, dem Korrespondentenclub, entfernt. Saskia lebt in Hongkong, es kommen Bernardo und andere befreundete Journalisten, Mitstreiter in vielen Kämpfen. Sogar xiao Liu kommt, unser geliebter Dolmetscher aus Peking, und es ist eine Dauerparty.
Die Artikel, die Tiziano hiervon an den Corriere della Sera schickt, sind sein Schwanengesang, sein Abschied vom Journalismus.
Nach dem Sommer in Orsigna brechen wir nach New York auf. Tiziano hat beschlossen, am Memorial Sloan Kettering Cancer Center Hilfe zu suchen, einer auf die Behandlung von Krebs spezialisierten Klinik. Chemotherapie, Bestrahlung, Eingriff an einer Niere, um einen Tumor zu entfernen. In New York will er allein sein, mit seinem PC auf dem Tischchen vor dem Fenster, das auf den Central Park geht, um von diesem neuen Stück Wegs zu erzählen. Plötzlich mit dem Tod konfrontiert zu sein, sieht er als »Chance, sich nicht zu wiederholen«, und er sagt, er sei glücklich darüber.
Wir kommunizieren per Fax und per Mail. Ich besuche ihn mehrmals, und ich empfinde ihn als zugleich zerbrechlich und stark. Kraftvollen Schritts gehen wir stundenlang vom Park bis zur Bowery und bis ans Ende der Insel Manhattan. Wir machen Halt und essen Sushi, geröstete Kastanien an den Straßenecken, wir kaufen Bücher bei Strand, bequeme Kleidung im Old Navy Store, wir gehen ins Kino, reden, machen auch Pläne. Keine langfristigen allerdings: Tiziano macht sich keine Illusionen über die Zeit, die ihm bleibt. Von diesem neuen Abenteuer, von dieser weiteren Runde auf dem Karussell, möchte er in seinen Tagebüchern berichten, um einen Sinn darin zu entdecken.
Im Januar 1998 ermuntern ihn die Ärzte, sein früheres Leben wieder aufzunehmen, aber das erscheint ihm absurd: »Wenn es doch eben dieses Leben war, das mich krank gemacht hat!« Wir kehren zurück nach Indien, und unter dem Vorwand, alternative Behandlungsmethoden zu suchen, beginnt er zwischen einem Kontrolltermin in New York und dem nächsten, das spirituelle Leben Asiens zu erkunden. Mit seinem Freund Poldi meditiert er im Norden Thailands, er besucht die Heiler auf den Philippinen, er verbringt Monate in einem Aschram in Südindien und studiert die klassischen indischen Texte, unter Anleitung eines Swami – Meister oder Guru –, in enger Gemeinschaft mit seinen Schülern. Er bringt sein Ego zum Schweigen, indem er sich »Anam« nennen lässt, der Anonyme, der Namenlose, doch als echter Florentiner verzichtet er nicht auf den »guten alten Zweifel« und wird niemandes Anhänger.
»Mein Hiersein, jetzt, mein Versuch zu schreiben, führt die Geschichte weiter und fügt das letzte Kapitel hinzu, das wahrhaftigste: Es gibt keine Abkürzungen, schon gar nicht die eines Guru, der dir den Pfad weist. Das ist ein Aspekt, den man unbedingt unterstreichen muss, auch um künftige junge Reisende davor zu warnen, sich von der Vorstellung irreführen zu lassen, ›dass man jemanden braucht, der Licht macht‹. Das soll er tun, doch dann ist es an uns zu urteilen, zu bewerten, unsere Erfahrungen zu machen«, schreibt er am 10. Juli 2002.
Am 14. September 1998 feiert er in Orsigna seinen 60. Geburtstag. Mit Folco hatte er im Himalaja in der Nähe der Stadt Dharamsala, dem Exilort des Dalai Lama, die Hütte eines Eremiten gesehen, die ihm sehr gefallen hatte, eine Gompa. Im Tagebuch hat er sie ausführlich beschrieben, und nun baut er sie sich in Orsigna bis ins Detail nach, auch mit den kräftigen tibetischen Farben, die er so sehr liebt. In dieser Gompa wird er sechs Jahre später für immer die Augen schließen.
Tiziano ist weiterhin auf der Suche nach einer Bleibe in Indien. Ende 1999 nehmen wir mit Poldi von Delhi aus einen Zug, und nach 15 Stunden Fahrt, davon drei im Auto, gelangen wir nach Almora, einst Hauptstadt eines kleinen Himalaja-Reichs. Im Gästehaus Deodars, wo wir unterkommen, erzählt uns der Besitzer von einem alten Mann, der auf 2300 Metern Höhe abgeschieden an einem Ort namens Binsar wohnt, vor sich die göttliche Himalaja-Kette, die hier den ganzen Horizont einnimmt.
Sollen wir hinfahren? Natürlich fahren wir hin.
Mit dem Auto fahren wir die Abhänge hinauf, durchqueren einen alten Wald, gelangen an einen Mandir, einen Tempel, von dort aus gehen wir noch eine Stunde zu Fuß weiter, dann kommen wir an ein Gittertor. Wir öffnen es, noch ein Stück Wald, und wir sehen uns vor einem sonnenüberfluteten Halbrund aus Wiesen, am oberen Ende ein kleines Haus in englischem Kolonialstil vom Ende des 19. Jahrhunderts. Ein alter Inder, Vivek Datta, empfängt uns und lädt uns ein, mit ihm und seiner belgischen Frau, Marie-Thérèse, das letzte Silvester des alten Jahrtausends zu verbringen. Am Ende macht er Tiziano wunderbarerweise den Vorschlag, die steinerne Hütte zu beziehen, die unterhalb seines Hauses steht: das schönste Geschenk, das er ihm machen konnte.
Wir verzichten nicht auf unsere Reise nach Pakistan, die wir mit Poldi schon geplant hatten, aber auf dem Rückweg besorgen wir Solarpaneele und Vorräte für Tiziano, und dann, während ich schon wieder auf dem Weg nach Florenz bin, wird er sich auf dem Basar von Almora mit dicken Decken und warmer Wollkleidung versorgen: In Binsar gibt es weder Strom noch fließend Wasser, geheizt wird mit Holz.
Schnee fällt, und Vivek, ein sehr gebildeter Mann mit einem reichen Fundus an Geschichten und indischer Spiritualität, öffnet für Tiziano die »Büchse der Pandora« seines Geistes. Seit seiner ersten Berührung mit Indien war Tiziano beeindruckt von der starken Spiritualität, die er bei den Menschen hier wahrnahm. Es ist also kein Zufall, dass ausgerechnet ein Inder seiner langen Suche ein Ende setzte und ihm das letzte Stück Wegs wies, das zurückzulegen blieb. Das bestätigt, wie wahr das indische Sprichwort ist: »Wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Meister.«
Dort oben verbringt Tiziano mit langen Unterbrechungen die Jahre 2000 und 2001.
Allein vor der erhabenen Gebirgskette des Himalaja, sieht er sich wie einen verschwindend kleinen Teil des Kosmos, ähnlich wie ein Marienkäfer, ein Blatt, eine Krähe, die geboren wird und vergeht, wie eine Wolke, die sich bildet und sich wieder auflöst, und das versöhnt ihn vollkommen mit dem Gedanken, dass das auch sein Schicksal ist.
Die Natur ist seine große Lehrmeisterin, der einzige Guru, den er anerkennt: »Ich setze mich und versuche zu meditieren, aber nichts, was ich in mir finden könnte, ist so überwältigend wie das, was ich vor Augen habe, weshalb es absurd wäre, sie zu schließen. Ich lasse mich durchdringen und trunken machen von den Farben, der Stille, dem Wind, den Rufen meiner beiden Krähen, die sehen, wie feige ich bin, und mich am Boden zurücklassen.« (25. Februar 2000)
Nur der 11. September kann ihn aus seiner Höhle locken und führt ihn zurück into the plains, wie die Inder aus dem Gebirge die Ebene nennen, womit sie auch die weltlichen Geschäfte meinen. Das Gefühl der Verantwortung gegenüber der Welt hat ihn nie ganz verlassen: Bis zum Schluss wird er ihr gerecht, ohne je seine Krankheit als Entschuldigung anzuführen und sich zurückzuziehen. Er kehrt nach Italien zurück, nach Pakistan, Afghanistan und noch einmal Italien: Er arbeitet wieder als Journalist, oder besser als Autor der Briefe gegen den Krieg. Sein Tagebuch beginnt mit kurzen Botschaften an mich, von der »Front«, wie in alten Zeiten.
Auf der Suche nach einem neuen Banner, unter dem er in den Kampf ziehen könnte, findet er den Pazifismus: Nicht weil diese Haltung ihm am meisten gelegen hätte, sondern weil er in der Gewaltfreiheit die einzige Waffe sah, die man dem Krieg in Zeiten der Massenvernichtungswaffen entgegensetzen kann.
Ein Jahr später, im November 2002, geben die Ärzte ihm die Gewissheit, dass sein Tod nahe ist. Die 20 Monate, die ihm bleiben, sind, das mag merkwürdig scheinen, die heitersten. Nicht den Tod fürchtet er, sondern das Chaos, die Irrtümer, die eigene Verwirrung. Er hat begriffen, dass man durch die Arbeit an sich selbst die Welt verändern kann, damit wird der Tod für ihn eine Herausforderung, bei der hohe Ideale im Spiel sind. Aus den dramatischen Bewegungen seiner Reflexionen geht Noch eine Runde auf dem Karussell hervor, ein Buch voll »lächelnder Heiterkeit«. Die emotionale Mühe hingegen, die den Schreibprozess begleitet und am Ursprung jeder Form des Schöpferischen steht, wird in den Tagebüchern sichtbar.
Für Tiziano war der Weg das Ziel. Unentwegte Neugier trieb ihn an. Sein Streben nach Perfektion hinderte ihn daran, sich mit dem zufriedenzugeben, was er zu einem gewissen Zeitpunkt erreicht hatte: Er suchte nach mehr, Besserem, weiter, immer weiter voran … Die Heiterkeit seines Endes entsprang der Überwindung einer unendlichen Unruhe, eines ewigen Ungenügens.
Der Eindruck, den seine Erscheinung in den letzten Jahren auf die Menschen machte, verdankte sich dem Ernst, mit dem er gelebt hatte. Was ihn auszeichnete, war dieses immer in erster Person für alles Einstehen. Er delegierte nichts, fühlte sich mitverantwortlich für alles und jedes, von der schlechten Politik bis zur eigenen Krankheit.
In den letzten Monaten ging er immer noch aufrecht, mit seinem Stock, der weißen Wolljacke aus dem Himalaja und der Würde eines antiken Menschen. So betrat er mit Folco das Sushi-Restaurant im Einkaufszentrum von Sesto Fiorentino oder mit mir das hinter der Piazza della Signoria, wohin er mich zu einem letzten Abendessen führte; und so hielt er auf Saskias Hochzeit seine letzte Rede.
Unzeitgemäß, doch königlich in seiner Erscheinung, demütig nur vor schönen Dingen.
Florenz, 9. April 2014
Tagebücher
1981–1984
Nachdem er fünf Jahre lang in Hongkong gelebt hat, ist Terzani 1980, als das kommunistische China seine Grenzen öffnet, einer der ersten ausländischen Journalisten, die ihren Wohnsitz in der Volksrepublik nehmen. Von Peking aus telegrafiert er an den SPIEGEL: »Habemus officium!« Die Familie und der Hund werden im September nachkommen.
In Peking baut er ein dichtes Netz an Kontakten und Freundschaften auf, wobei ihm bewusst ist, dass er wie alle ausländischen »Gäste« unter Aufsicht schreibt. Nach dem Tod Maos im September 1976 versucht China eine vorsichtige Öffnung zum Westen, während im Inneren der KPCh drastische Abrechnungen stattfinden, aus denen Deng Xiaoping als neuer Mann hervorgeht. Für einen Journalisten ist das eine heikle wie stimulierende Situation. Terzani befindet sich in einer in mehrfacher Hinsicht widersprüchlichen Lage: Er ist ein Italiener, der an einer amerikanischen Universität Chinesisch studiert hat und für ein deutsches Magazin arbeitet … und alles daran setzt, wie ein Chinese zu leben. Er nimmt einen chinesischen Namen an – Deng Tiannuo –, er kleidet sich chinesisch, schickt seine Kinder Folco und Saskia auf eine chinesische Schule, er versenkt sich in eine Kultur, die er aus ganzer Seele liebt. Aber die Wirklichkeit ist »weniger schön als die Träume«. Er bereist jeden Winkel des Landes, von Xinjiang bis Shandong, von der Mandschurei bis zu den Hainan-Inseln und stellt fest, dass das alte China verschwindet, pulverisiert von der Kulturrevolution und erstickt vom Prozess der Modernisierung. Er schildert, was er sieht, ungeschönt, und auch in den Tagebüchern hält er beunruhigende Gefühle fest.
Ab 1981 zeigt der SPIEGEL sich besorgt über die Unverblümtheit seiner Berichte, aber Terzani ändert sich nicht. Beschwerden und Nötigungen lassen nicht auf sich warten, chinesische Regierungsfunktionäre bekunden Missfallen über seine Artikel, die von grenzenloser Neugier diktiert sind. Sie treibt ihn an, alle und jeden zu befragen, in die entlegensten Gebiete zu reisen, manchmal ohne Genehmigung. 1983 nimmt der Druck zu, und Terzani sieht ein, dass er handeln muss. Im Juni schickt er seine Frau Angela und die Kinder wieder nach Hongkong und bleibt allein in Peking zurück. Ende des Jahres zeichnet er erstmals auf einem kleinen Computer digitale Notizen auf, eine echte technologische Innovation.
Im Januar 1984, als er nach dem Tod seines Vaters Gerardo nach Hongkong zurückkehrt, bestellt das chinesische Außenministerium ihn ein, um ihm mitzuteilen, dass seine Arbeitserlaubnis trotz der Verlegenheit, die seine Artikel ausgelöst haben, um ein weiteres Jahr verlängert wird. Aber drei Wochen später, während er von einer Reise in den Süden Chinas zurückkehrt, hält die Sicherheitspolizei ihn am Flughafen Peking fest. Mitten in der Nacht bringt man ihn zuerst in seine Wohnung, wo verschiedene Gegenstände beschlagnahmt werden, dann auf das Polizeipräsidium, wo er befragt, bedroht und formell »konterrevolutionärer Vergehen« bezichtigt wird. Ohne Pass und verpflichtet, absolutes Schweigen über die Sache zu wahren, andernfalls droht ihm die Inhaftierung, wird er gezwungen, wieder und wieder eine Selbstkritik zu schreiben, die seine »gute Einstellung« beweisen soll. Angela organisiert von Hongkong aus eine Hilfsaktion. Beraten durch einen ungarischen Jesuiten in Hongkong und einen Journalisten der KPCh, einen Freund Terzanis, und unter Ausnützung der Kanäle der Tageszeitung La Repubblica gelingt es ihr, die Causa Terzani auf den Schreibtisch des Staatspräsidenten Pertini zu bringen, was die Situation entspannt.
Im Morgengrauen des 5. März trifft Terzani in Hongkong ein, aus der Volksrepublik China ausgewiesen. Das ist ein Schock. Der SPIEGEL steht ihm zur Seite, indem er sofort seinen Artikel über die Ausweisung veröffentlicht sowie im Juni eine Anthologie mit seinen wichtigsten Reportagen aus der Volksrepublik China (Fremder unter Chinesen. Reportagen aus China). Im September, während der Verlag Longanesi den Druck der italienischen Übersetzung unter dem Titel La porta proibita(Die verbotene Tür) vorbereitet, hält Terzani in einer Notiz ein neues Projekt fest, das nie verwirklicht werden wird: »Ein Buch schreiben über das Journalistsein in China. Eine Lektion in Sachen Berufskunde: Wie man sich nicht in die Falle locken lässt, wie man die Maske abnimmt. Die Geschichte der Geschichten, die Geschichte der Reisen, die Kontakte mit den Menschen, die Chinesen als große Hypnotiseure, China als Theater.«
Er kommt nach Hamburg, wo er mit dem SPIEGEL seine Zukunft plant: Mit Standort Hongkong würde er Reportagen über Südostasien und die Philippinen schreiben, wo das Regime von Marcos zu wanken beginnt; ab 1985 sollte er Japan-Korrespondent werden.
März 1981, Peking. In der Nacht fällt eine Einheit der Befreiungsarmee alle klassisch chinesischen Bäume (Trauerweiden) rund um den Regierungssitz im Innern der ehemaligen Kaiserstadt und schafft sie weg. Am Morgen sieht es aus, als wäre nichts geschehen. Die Trauerweiden wurden durch Weihnachtsbäume amerikanischen Typs ersetzt, die mit der chinesischen Tradition nichts zu tun haben.
* * *
Mai 1981, Peking. Das große Problem aller westlichen Intellektuellen, die die Revolutionen verfolgt haben, ist, dass sie sich für die nationale Revolution begeistert haben und dabei vergaßen, dass es die Kommunisten waren, die sie machten.
Das ist das Thema des zu schreibenden Buches.
Das ist die Geschichte unserer Zeit. Die Linke, gefangen gesetzt von der kommunistischen Bürokratie, nachdem sie fasziniert war vom Kampf für Gerechtigkeit.
War es das, was die fortschrittlichen Kräfte von damals wollten? Was wollten wir in Vietnam?
Schauen wir uns ins Gesicht.
Juni 1981, Peking. Ein Mann geht zwischen den zerschlagenen und wieder zusammengekitteten Stelen von Qufu* herum und sagt: »Das hat Mao gemacht, das hat die Kommunistische Partei gemacht …«
Auf dem Markt von Qufu fragt mich ein Bauer, woher ich komme. Ich sage aus Italien, und er: »Ah, das ist ein schönes Land, besser als unseres. Alle Länder sind besser als unseres.«
* * *
1. Oktober 1981, Peking. Feier zum Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China. In den Zirkus gegangen. Die besten Akrobaten, die besten dressierten Hunde, der beste chinesische Bär, der Ball spielt oder einen Kinderwagen schiebt. Aber alles ist ohne Zauber: die faschistische Perfektion der Akrobaten, die Varieté-Beleuchtung … Die Leute kommen und gehen. Sie sind hier, weil die Partei ihnen die Karten gegeben hat, aber es interessiert sie nicht, sie applaudieren nicht, sie amüsieren sich nicht.
Das Leben in China hat die Freude eingebüßt, wenn es sie denn je gekannt hat.
Man tritt in die Nacht hinaus, es müsste Festtagsstimmung sein, aber die Lichter an den Häusern sind schon gelöscht, um zu sparen. Seit Jahren wird kein Feuerwerk mehr veranstaltet, um zu sparen. Vereinzelt radelt jemand mühsam in der grauen Stille des Tiananmen-Platzes durch die Nacht.
China ist ohne Inspiration.
Wir nähern uns immer mehr einer Form des Faschismus ohne Ideologie, es sei denn man betrachtet ein Regime von Disziplin, Ordnung und Stärke, der Denunziation und des Verdachts als Ideologie.
Nirgendwo eine Spur von Ironie, nirgendwo Übermut der Vernunft.
5. Oktober 1981, Peking. Arme chinesische Kommunisten. Sie rühmen sich einer 4000 Jahre alten Kultur*, aber in Wirklichkeit haben sie mit dieser Kultur nichts zu tun. Jede ihrer Manifestationen wird kritisiert, jede Spur davon wurde vernichtet, und wenn sie jetzt restauriert wird, so, um eine Touristenattraktion daraus zu machen. Die Kommunisten überlassen ihr Volk den Segnungen der westlichen Kultur, die mit Coca-Cola und ihren plattesten und schrillsten Symbolen Einzug hält. Ohne Verbindung mit der Vergangenheit, ohne Vision von der Zukunft, zerstören die chinesischen Kommunisten die Geschichte und taumeln auf die Zukunft zu. Alles, was gebaut wird, ist nur für kurze Zeit.
Das alte Peking wird abgeschafft, was an seine Stelle gesetzt wird, wird nur wenige Jahre dauern.
* * *
23. Februar 1982, Peking. Vergangene Woche hat sich ein chinesischer Journalist von der Nachrichtenagentur Xinhua*, zu Besuch im Weißen Haus, beschwert, weil er aufgrund einer alten Verordnung sogar bis auf die Toilette von einem bewaffneten Polizisten begleitet wurde. Während einer Pressekonferenz ist er aufgestanden und hat protestiert: »In meinem Land würde so etwas nie passieren.«
Am 20. Februar ist das mir passiert. In der Stadt Hunyuan wurde ich von drei Polizisten verfolgt, die mich einfangen wollten, um mich zum Essen zu bringen. Sie wollten verhindern, dass ich den Dreck auf den Straßen fotografierte. Hunyuan ist für Fremde geschlossen, man darf nur zum Essen gehen, den Tempel besuchen, der während des Besuchs geschlossen wird, diese riesigen, sauberen und abgeschirmten Gästehäuserder Regierung betreten, wo früher die Herren der Erde wohnten, und wieder abreisen: Das ist die Art, wie sie Fremde wollen.
3. April 1982 auf dem Weg zum Flughafen Peking. Die jungen Leute trösten sich mit dem Gedanken, dass es in 20 Jahren niemanden mehr geben wird, der sagt: »Ich habe die Volksrepublik gegründet, ich habe die Revolution gemacht …« Dann wird es nur noch die Nachkommen der Veteranen geben, es wird Fraktionen geben: »Die Erben der KPCh« und diejenigen, die den westlichen Weg der Modernisierung einschlagen wollen.
Der Kampf zwischen den zwei Fraktionen wird nicht ohne Blutvergießen auskommen.
* * *
8. August 1982, Orsigna. Angela arbeitet an ihrem chinesischen Tagebuch.* Ich versuche, diesen verdammten chinesischen Roman* zu konzipieren und zu schreiben. Es fehlt die Fantasie, um mit dem Ehrgeiz Schritt zu halten. Ich suche und finde Ausreden, ergreife jede Gelegenheit, um mich nicht an diese schreckliche Schreibmaschine zu setzen … Pilze sammeln, ein Kamin, der nicht zieht, der Regen.
Die Wonne der Muße und dann die Angst wegen der vergeudeten Zeit. Später die schmerzliche Erinnerung.
* * *
12. September 1982, Peking. Zurück in China.
Immer am falschen Ende der Welt.
Und doch ist es ein Heimkommen.
Es ist schwer, sich wieder an die Polizei zu gewöhnen, an die versteckten Mikrofone, an das Leise-Sprechen, an das Nicht-Sagen, was man denkt.
15. September 1982, Peking. Viele Ausländer, insbesondere Japaner, weigern sich, in das neue Gebäude von Jianguomenwai zu ziehen, weil sie erfahren haben, dass die Abhöranlagen ausgezeichnet sind. Die Chinesen haben sie in Japan gekauft.
* * *
20. November 1982, Hongkong. Verwirrt im Kopf und im Herzen. Ich betrachte den Kolonialismus der oberflächlichen Frauen von hier, den räuberischen Kapitalismus der fetten chinesischen Herrn, die in ihre Rolls-Royce steigen: Willkommen seien die Kommunisten!
Ich denke an die Kommunisten mit ihren über die Augen gezogenen Mützen, ihren Plastiktüten und denke, das ist das Ende der Freiheit.
Auf welcher Seite stehen?
Dezember 1982, Peking. Dieter aus Hamburg ruft an*, besorgt wegen der Schärfe meines Artikels über Peking. »Wird man ihn annehmen? Wird man dir Probleme machen?«
Na und? Wir sind keine Diplomaten. Wir müssen dieses Metier gründlich machen. Man zahlt uns dafür, dass wir unseren Spaß haben, aber auch dafür, dass wir sagen, was die Diplomaten nicht zu sagen wagen.
Dezember 1982, Peking. Ich entdecke, dass meine Berichte von der Polizei gelesen wurden, insbesondere der mit dem Titel Notes on China. Er ist so wieder hingelegt worden, dass der Titel verdeckt war. Ich frage meine Nachbarin: »Ja, ich habe zwei Männer aus Ihrer Wohnung kommen sehen, während Sie in Chengde waren.«
Der fette »Professor«* sagt, er sei drei Mal von der Polizei angerufen worden. Die erste Frage war, warum ich mich nach den Ferien nicht bei ihm gemeldet habe. Und er, was wusste er davon?
Sie sind immer zu zweit. Es ist klar, die Absicht ist Einschüchterung, man will den Verdacht in uns nähren, dass alle, die problemlos mit uns umgehen, Spione sind. Und vielleicht sind sie es ja auch. Als Ausländer fühlen wir uns, als ob wir die Pest hätten, denn der Kontakt mit uns schafft Probleme.
* * *
März 1983, Peking. »Rabbit« Li* vom Außenministerium, Abteilung Information, nimmt mich beiseite, um mir zu sagen, dass er im Namen der Leser protestiert, sie sind empört über das, was ich über Peking geschrieben habe. »Es stimmt nicht, dass ›jeder Parteisekretär ein Kaiser‹ ist«, sagt er mit Bezug auf den Titel meiner Reportage. Wie konnte ich schreiben, »die Imperialisten haben weniger zerstört als die Kommunisten und sie haben Peking geschützt«?
* * *
17. Januar 1984, Peking.* Um drei Uhr Verabredung im Außenministerium. Es empfangen mich Frau Han (klein und freundlich) und Zhen Wencheng, ehemals Begleiter unserer Journalistengruppe in Kashgar. Zunächst Beileidsbekundungen zum Tod meines Vaters, dann setzen wir uns, und ich sage die Dinge, die ich sagen will.
Ich bin seit vier Jahren hier, halten wir fest. Ich weiß, dass es Leute gibt, die beleidigt sind, dass ich kritische Sachen schreibe, dass ich mit vielen Polizisten gestritten habe, aber ich bin kein Feind dieses Landes. Ich wusste, wo Hu Yaobang* wohnte und habe es nie geschrieben; ich war in Kontakt mit Shi Pei Pu* und habe es nie geschrieben.
Kritisch bin ich, weil ich dieses Land liebe. Kritisch bin ich, weil das mein Beruf ist.
Ich bin bereit zu diskutieren und den Standpunkt von anderen anzuhören.
Ich spreche über eine halbe Stunde lang, dann sage ich, ich könnte noch stundenlang so weitermachen, weil ich das Thema gut kenne, aber vielleicht will Zhen seine Meinung sagen.
Er holt ein Blatt mit Notizen aus der Jackentasche und sagt: »Ja, vielleicht ist die Reihe an mir. Sie beginnen nun Ihr fünftes Jahr hier. Wir haben sehr geschätzt, was Sie über die Freundschaft sagen, und wir danken Ihnen, aber Ihre Arbeit hat tatsächlich bei vielen Funktionären und auch bei einigen Ihrer in Peking akkreditierten Kollegen Verstimmung ausgelöst (bei wem?, frage ich mich). Verdrehung der Tatsachen und einseitiges Urteil tragen nicht zum Kennenlernen und zum Verständnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und China bei. Ihr Visum läuft bald aus. Wir haben beschlossen, es um ein Jahr zu verlängern, aber wir hoffen, Sie werden objektive und weniger verzerrte Dinge schreiben, sowohl über die Innen- als auch über die Außenpolitik Chinas.«
Es scheint auch ihn in Verlegenheit zu bringen, diese Rolle spielen zu müssen, er sucht nach Worten. In einer Stunde haben wir es geschafft, und er wiederholt mit feierlicher Miene seine Beileidsbekundungen zum Tod meines Vaters, und die sind freundlich.
Ich gehe und bin beeindruckt von ihrem Savoir-faire, glücklich, weiter hier zu bleiben, traurig, nicht gezwungen zu sein, eine andere Lösung für mein Leben zu suchen.
Ich lebe in China, und das missfällt mir nicht. Das Problem ist, dass die Linke die Wahrheit akzeptieren muss. Die Tatsache, dass der Traum zu Ende ist, bedeutet nicht, dass China sich verwandelt hat. Das China von heute ist viel wahrhaftiger und realer als das falsche, zusammenfantasierte der Reisenden der Vergangenheit. Auch ich habe Chinesisch studiert, weil ich glaubte, dass hier ein großes menschliches Experiment stattfindet.
Das Problem ist, dass man uns getäuscht hat.
China hat enorme Schwierigkeiten. Ja, jetzt, da man es kennenlernen und entdecken kann, lohnt es sich, hier zu leben.
Die Sache ist die, dass dieses Land aus seinem Zauber gerissen wurde. Es hatte seine Kultur, eine eigene Welt, und der Kontakt mit dem Westen war es, was ihm Stöße versetzt hat. Ein paar Kanonenschüsse hier, ein paar Landungen da, und die Ausländer ergatterten eine »Konzession« nach der anderen.
Es ist doch seltsam, und ich höre nicht auf, mich darüber zu wundern, wenn ich am 1. Mai und am 1. Oktober die Konterfeis dieser vier (Marx, Engels, Stalin und Lenin) auf dem Tiananmen-Platz sehe. Wie ist es möglich, dass das jahrtausendealte China mit seiner immensen Kultur auf der Suche nach einem neuen Weg sich auf diese vier Europäer beziehen muss, von denen einer ein berüchtigter Massenmörder ist?
Und doch ist es so, China rennt hinter uns her.
8. Februar 1984, Peking. Aufzeichnungen während der Inhaftierung. Das Flugzeug bleibt in Tianjin liegen, weil ein Motor Öl verliert.
Zwei Stunden Wartezeit, dann geht es nach Peking.
Gleich nach der Ankunft überprüfen mich die vom Zoll. Sie nehmen mir meine Zollerklärung ab. Das Gepäck kommt, und unter einem Vorwand halten sie mich auf. Als alles vorbei ist, verlangt ein Polizist am Ausgang meinen Personalausweis und fordert mich auf, ihm zu folgen. Er trägt das Gepäck bis ins Obergeschoss, die Rolltreppe ist defekt.
Die zwei Polizisten in dem Raum setzen ein falsches Lächeln auf, dann reden sie in einer Ecke leise miteinander und weichen meinen Fragen aus:
»Sind Sie bewaffnete Polizisten oder vom Büro für öffentliche Sicherheit?«
Die Inhaftierung beginnt um 11 Uhr 20 abends.
Gedanken, Vermutungen, Erschießung, Verschwinden im Gulag.
Leben, um dann ein Buch zu schreiben, das niemanden interessiert.
Drei Leute und ein Kapo kommen in den Raum. Der Älteste spricht, er fragt mich, ob ich »Deng Tiannuo« bin.
Ich sage, ich kann kein Chinesisch.
Er brüllt mich an: »Du kannst es! Du kannst es! Hör auf zu schreiben!«
»Aber ich bin Journalist.«
Er befiehlt mir, zum Büro für öffentliche Sicherheit von Peking zu gehen. Sie hindern mich daran zu telefonieren. Um 00 Uhr 45 kommen wir im Büro an.
9. Februar 1984. Liste der beschlagnahmten Gegenstände:
1. Bronze Buddhas (fünf große, sechs kleine) 11
2. Bronze Tierfigur (klein) 2
3. Silberschachtel 1
4. Räucherschälchen in Bronze 1
5. Grillenkäfig in Bronze 1
6. Kleiner bronzener Wassertopf 1
7. Langer Räucherstäbchenhalter 1
8. Porzellanvase mit zwei Henkeln (rot) 1
9. Porzellanvase cremefarben, zerbrochen 1
10. Porzellanblumentopf (blau und weiß) 1
11. Keramikvase mit zwei Henkeln (cremefarben) 1
12. Porzellanplatten groß und klein 7
13. Porzellankugeln (blau und weiß) 3
14. Weinkelch (blau und weiß) 1
15. Runder Porzellanbehälter (schwarz-weiß) 1
16. Grillenkörbe 2
17. Großes Kupferschloss 1
18. Jadegegenstände 8
19. Holzgegenstände aus hartem und rotem Holz 6
20. Holztauben (eine groß, eine klein) 2
21. Damenuhren (Seiko, schwarzes Zifferblatt) 2
22. Herrenuhren mit Datumsanzeige und drei Zeigern 2
23. Buddhistische Thangka-Malerei 2
24. Gemälde des Vorsitzenden Mao 1
25. Gemälde in Rahmen 2
26. Fotos 16
27. Postkarte des Vorsitzenden Mao 1
28. Rollbild 1
»Deng Tiannuo weigert sich zu unterschreiben. Zeugen: Yue Feng und Wang Guang. Durchsuchung durchgeführt von Liu Yongxiang.«
10. Februar 1984, Peking. Ich treffe diejenigen, die gestern Abend zur Verstärkung gerufen wurden. Alle lächeln verlegen. Ich begrüße sie, als ob nichts geschehen wäre. Der mit dem breitesten Lächeln von allen sagt: »Deng Tiannuo, wie geht es dir? Ausgezeichnet, ausgezeichnet, nicht wahr?«
Ich gebe ihm Recht: »Wirklich ausgezeichnet!«
Und alle lachen noch mehr. Nicht schlecht, die Chinesen!
Höflichkeitsbesuch bei Frau Doss wegen ihres nächtlichen Anrufs. Ihr erster Eindruck war, dass etwas Merkwürdiges im Gange ist. Vielleicht die CIA? Vielleicht der KGB? Weil sie nur meine grauen Haare und schwarze Schatten gesehen hatte. Zum zweiten Mal hörte sie Schreie: »Neal, Neal Ulevich!«* Schon nach dem ersten Schrei hat sie Graziella Simbolotti, Botschaftsrätin bei der italienischen Botschaft, angerufen, und bis zum Morgen sind sie in Telefonkontakt geblieben.
Auch andere haben etwas gehört, hüteten sich aber, irgendetwas zu unternehmen.
Besuch in der italienischen Botschaft, um mich bei Graziella zu bedanken. Sie erzählt mir, dass sie nach dem Anruf von Frau Doss die Nacht am Telefon verbracht hat, um zu verstehen, was vorging. Am Morgen schickte sie Bisogniero von der Botschaft zu mir nach Hause, um sich zu informieren, aber die Köchin und das Dienstmädchen machten erstaunte Gesichter und beteuerten, nichts gesehen zu haben. Dann hat sie Gabriella Giubilei, die Sekretärin des Botschafters, in Hongkong anrufen lassen, um mich zum Abendessen beim Botschafter einzuladen. Das war ein Vorwand, um herauszufinden, ob ich wirklich abgereist war und was Angela wusste. Guter Schachzug.
Als ich zurückkomme, sagt mir xiao Liu*, dass die vom Büro für Öffentliche Sicherheit angerufen haben, um mir mitzuteilen, dass ich um 14 Uhr 30 bei ihnen sein muss.
Nachmittags. Das Verhör beginnt um halb drei, ich bin in Begleitung von Bisogniero und Giorgi von der Botschaft. Der chinesische Kapo sagt, ihre Anwesenheit sei nicht erforderlich und überflüssig. Giorgi erinnert an das Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen von 1963: Unter diesen Umständen ist es ihre Pflicht, einem italienischen Staatsbürger beizustehen.
Der Offizier ergreift das Wort und sagt: »Nach einigen Schwierigkeiten hast du gestern einige Fortschritte gemacht. Jetzt wollen wir deinen Umerziehungsprozess einleiten. Du musst uns die ganze Wahrheit sagen, musst versuchen, dich an alle Einzelheiten zu erinnern, du darfst nicht lügen, so wirst du eine mildere Strafe bekommen. Andernfalls wird deine Strafe sehr hart ausfallen. Wir stellen dir jetzt Fragen, und du musst uns antworten.«
Sie bringen einen Teil der konfiszierten Dinge in den Raum. Der Offizier nimmt den größten Buddha und fragt mich, wo ich ihn gekauft habe.