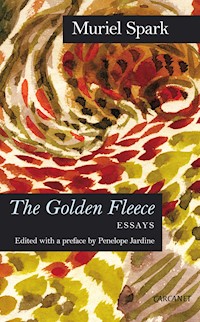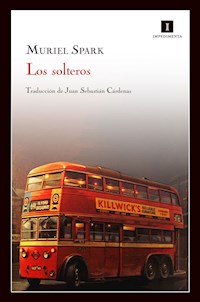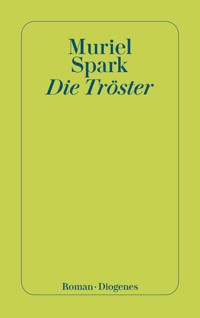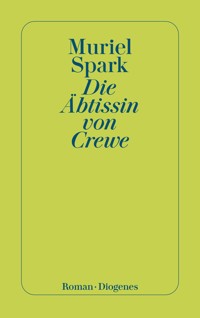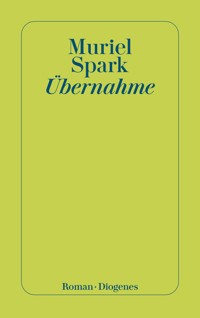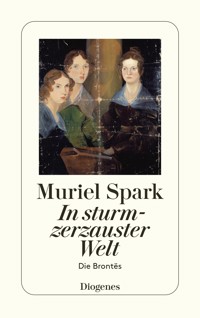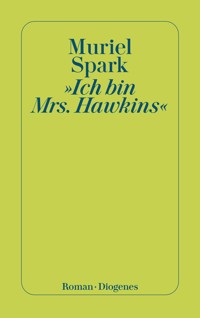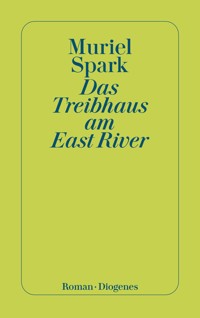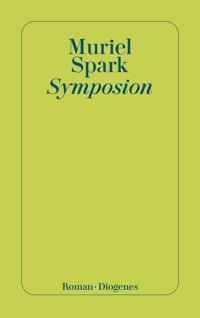
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dinner im Londoner Stadtteil Islington: feinstes Essen, feinste Gäste. Man speist — und parliert über Liebe und Ehe. William und Margaret Damien sind Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Ein Traumpaar, das sich unter ungewöhnlichen Umständen kennengelernt hat – bei Marks & Spencer's am Gemüsestand. Doch noch während man von der Liebe spricht, geht es um Mord.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Muriel Spark
Symposion
Roman
Aus dem Englischen von Otto Bayer
Diogenes
… was die Gelegenheit zu einem Streit
gab, der zuletzt ein so blutiges Ende nahm.
Lukianos: Das Gastmahl nach C.M. Wieland)
In der Hauptsache aber sei es darum
gegangen, sagte er, daß Sokrates sie
zuzugeben genötigt habe, ein und derselbe
Mann müsse sich darauf verstehen, eine
Tragödie und eine Komödie zu schreiben,
und der kunstgemäße Tragödiendichter
sei auch Komödiendichter.
Platon: Symposion nach R. Rufener)
1
Das ist Unzucht!« Seine Stimme stieg in nie erreichte Höhen und schraubte sich immer noch höher, während er das Bild der Verwüstung betrachtete. »Notzucht ist das!«
Es war nicht Notzucht, es war Einbruch.
Und er war Lord Suzy, sein Titel war erblich. Wenn man diesen Umstand eiligen Leuten erklärte, bevor sie ihn kennenlernen sollten, fragten sie manchmal: »Ach ja, was hat er denn?« Wahr ist, daß er nie etwas Besonderes geleistet hatte. Er näherte sich dem gefährlichen Alter von fünfzig Jahren, oft als die männlichen Wechseljahre bezeichnet. Seine zwei vorherigen Ehen und Scheidungen waren vorbeigefegt wie Stürme auf ehedem bewegter See.
Helen, die jetzige Lady Suzy, war zweiundzwanzig. Verschlafen und langbeinig stand sie da und griff sich fassungslos mit beiden Händen in das kurze, dunkle Haar. Sie war knapp ein Jahr mit Brian Suzy verheiratet und hatte in dieser Zeit schon oft an Flucht gedacht. Kennengelernt hatte sie ihren Mann im Schultheater, wohin er gekommen war, um seine Tochter in Tod eines Handlungsreisenden zu sehen, das der Theaterkreis in diesem Jahr zur Aufführung brachte. Helen war eine Mitschülerin von Pearl, Lord Suzys einzigem Kind aus zweiter Ehe. Heute bediente Pearl einen Textcomputer bei den Vereinten Nationen im fernen Manhattan, sie hatte von ihrem »Traumjob« geschrieben und damit Neid und Einsamkeitsgefühle in Helen geweckt. Auch Helens Eltern waren geschieden. Am meisten hatte sie ihren Vater vermißt, und das war, wie sie sagte, wahrscheinlich der Grund, warum sie sich zu älteren Männern hingezogen fühlte und schließlich an Brian Suzy geraten war.
Helen stand noch immer fassungslos inmitten der Verwüstung, während die beiden Polizisten, die sie mitten in der Nacht geweckt hatten, um ihnen zu sagen, daß ihre Haustür sperrangelweit offen stehe und das Türlicht brenne, jetzt gehen wollten. Sie konnten sich gar nicht genug darüber wundern, daß beide Eheleute keinen Ton gehört haben wollten.
»Sieht aber doch ganz so aus, als ob sie Lärm gemacht hätten«, meinte der eine.
Helen ließ die Hände sinken. »Ich habe etwas gehört und doch wieder nichts gehört«, sagte sie. »Das heißt, ich habe etwas geträumt, worin Lärm vorkam, und muß den wirklichen Lärm in diesen Traum eingebaut haben.«
»Das erzählt sie uns jetzt«, sagte Brian. »Zuerst will sie gar nichts gehört haben, jetzt hat sie es im Traum gehört.«
»Kommt auf eins heraus«, meinte der andere Polizist. »Es ist besser, daß Sie nicht heruntergekommen sind. Vielleicht hätten Sie eins über den Schädel gekriegt.«
Nachdem sie fort waren, suchte Helen nach einer heil gebliebenen Flasche zwischen den Scherben. Sie fand noch etwas Portwein. In der Küche, wohin die Vandalen nicht vorgedrungen waren, stand in einem Schrank noch einiges andere an Trinkbarem; sie schnappte sich eine Flasche Brandy und mixte ihren allerneuesten Cocktail.
»Brian!« rief sie. Er saß auf der untersten Treppenstufe, den Kopf zwischen den Händen. Sie brachte ihm ein Glas von ihrem Portwein mit Brandy und setzte sich neben ihn auf die Treppe.
»Notzucht«, sagte er. »Ich fühle mich vergewaltigt.«
»So? – Ich könnte das nicht beurteilen«, meinte sie. »Das Silber haben sie mitgenommen, die Hi-Fi-Anlage und den georgianischen Spiegel. Den Rest haben sie einfach zerdeppert.«
Es war ein viktorianisches Haus, dreigeschossig, und stand an einer ruhigen Nebenstraße zur Camberwell New Road.
»Raubüberfall«, sagte er, schon viel ruhiger als beim ersten Schock.
»Ist denn noch nie bei dir eingebrochen worden?« fragte sie. Sie waren noch nicht lange genug verheiratet, um alles übereinander zu wissen.
»Nein. Mir sind Sachen weggekommen. Diebische Domestiken, in früheren Zeiten. Eigene Leute. Und meiner Mutter hat einmal ein Ring gefehlt. Aber so einen richtigen Einbruch, wie jetzt, den hatte ich noch nie. Am frühen Morgen, zwischen halb drei und drei, und keinen Laut gehört. Gehört hast du ja eigentlich auch nichts. Die hätten nach oben kommen und uns ermorden können.«
»Wir sollten uns eine Alarmanlage zulegen«, sagte sie. »Wir müssen eine haben. Aber die wissen, wie man solche Dinger abschaltet.«
»Silber im Haus zu haben ist ja auch verrückt«, sagte er. »Viel Arbeit, und am Ende wird es einem nur geklaut.«
»Das meiste hat uns meine Familie zur Hochzeit geschenkt«, sagte sie. Sein Silber lag oben in seinem Bad in einem Safe versteckt.
»Ich hasse Hochzeitsgeschenke«, sagte Brian. »Wenn du mit Hochzeitsgeschenken soviel Erfahrung hättest wie ich, ginge es dir auch so.«
»Sie halten die Ehen nicht zusammen, das stimmt«, sagte sie.
»Was ist das für ein Zeug, das wir hier trinken?«
»Hüpfwasser heißt es«, sagte sie.
»Die haben nämlich überall an die Wände gepinkelt«, sagte er. »Gräßlich ist das, wenn sie einem an alle Wände und auf sämtliche Sachen pinkeln. Ein Frevel.«
Die Gastgeberin stellt die Gäste, die sich noch nicht kennen, einander vor. »Lord und Lady Suzy, das heißt Brian und Helen, ich darf euch mit Roland Sykes bekannt machen; Annabel Treece kennt ihr ja schon. Ernst, schön daß Sie da sind … Ernst Untzinger … Ihr habt euch schon einmal gesehen? Gut. Ernst, kennen Sie schon Mr. und Mrs. Damien, William und Margaret …« Der Gastgeber reicht Getränke. Die Abendgesellschaft besteht aus zehn Personen. Das Haus befindet sich in Islington. Der Raum ist Beige in Beige, und man kann ins Speisezimmer sehen, das vorwiegend in Eisvogelblau gehalten ist.
Die anwesenden Damen sind so verschieden, wie es nur geht, die fünf Herren sind einander ähnlicher, trotz unterschiedlichen Alters. Die Gastgeber sind Hurley Reed, ein amerikanischer Maler Anfang Fünfzig, und Chris Donovan, eine reiche australische Witwe Ende Vierzig. Sie leben zusammen. Es ist eine Verbindung zu beiderseitigem Nutz und Frommen.
Eine halbe Stunde später sitzt die Gesellschaft bei Tisch. Einige waren einander bisher unbekannt, aber alles in allem kennen die beiden Gastgeber und ihre acht Gäste sich viel besser, als wir sie vorerst kennen.
Hurley Reed sitzt bei diesem Gastmahl der Zehn am Kopfende der Tafel, zu seiner Rechten Helen Suzy und zu seiner Linken Ella Untzinger. Chris Donovan, die Gastgeberin, eine wundervolle Erscheinung und sehr reich, sieht sich am anderen Tischende schon von Brian Suzy zu ihrer Rechten voll in Anspruch genommen. Die dunklen Augen quellen ihm förmlich aus dem schmalen, dunklen Gesicht. »Und dann«, beteuert Brian, »haben sie noch alle Wände angepinkelt.«
Ernst Untzinger, erfolgreich, braungebrannt und früh ergraut, sitzt links von Chris Donovan. Er ist geschäftlich in London, auf einer seiner vielen Dienstreisen von Brüssel aus, wo er in einem der internationalen Finanzausschüsse der Europäischen Gemeinschaft sitzt. Seine Frau Ella, ihm schräg gegenüber am anderen Tischende, sitzt neben Hurley Reed.
»Alles vollgepinkelt«, sagt Brian Suzy.
Ernst versucht ihn von dem Thema abzubringen, denn soeben wird trockener Champagner in röhrenförmigen Gläsern serviert; die näheren Umstände des Einbruchs bei den Suzys sind für seinen Geschmack hier fehl am Platz.
Der Diener, frisch engagiert von der Butlerschule Top-One, und sein für heute angestellter Gehilfe, ein junger Kandidat der Neuen Geschichte, gehen in ihren weißen Jacketts unbeteiligt um den Tisch herum und schenken ein. Es wäre Ernst unangenehm, wenn sie Lord Suzys Ausdrucksweise mitbekämen, weshalb er sichtlich erleichtert ist, als Brian Suzy nun anfängt, die vermißten und beschädigten Gegenstände aufzuzählen.
»Ich sage ja immer zu Hurley«, meint Chris Donovan, »man soll von seinen Sachen Abschied nehmen, so oft man ihnen den Rücken kehrt. Wer weiß, vielleicht sieht man sie nie wieder.«
Die junge Margaret Damien sieht sehr romantisch aus mit ihren langen, dunkelroten Haaren, einer auffallenden Farbe, aber wahrscheinlich echt. Sie sagt: »Wie heißt es doch in einem Gedicht von Walter de la Mare:
Schau allem Schönen Lebewohl
Zu jeder Stunde …«
Hurley Reed hebt soeben sein Champagnerglas: »Ich möchte jetzt mit euch allen auf Margarets und Williams Zukunft anstoßen.« William Damien lächelt. Alle trinken auf das Wohl der Jungvermählten.
Jetzt unterhält sich Hurley Reed an seinem Tischende mit Helen Suzy zu seiner Rechten. Helen macht ein betretenes Gesicht, denn die Aufzählungen ihres Gatten sind einfach nicht zu überhören.
»Das war letzte Woche« sagt Helen.
»Notzucht«, dröhnt die Stimme ihres Gatten. »Ein Gefühl wie Vergewaltigung.«
Helen blickt auf den Teller Lachsmousse nieder, der soeben lautlos vor sie hingestellt wird. Sie greift nach der Gabel.
Hurley greift nach der seinen, und während er die Partybrötchen an Ella Untzinger zu seiner Linken weiterreicht, redet er weiter mit Helen Suzy. »Haben Sie schon einmal«, fragt er leise, »von der Heiligen Ohnesorge gehört?«
»Ohne was?«
»Eine Heilige aus dem Mittelalter«, sagt er. »Zu ihr pflegten die Leute, Frauen vor allem, um Erlösung von ihren Gatten zu beten. Sie war eine portugiesische Prinzessin, die sich nicht verheiraten lassen wollte. Als ihr Vater einen Mann für sie erwählte, betete sie darum, häßlich zu werden, und ihr Gebet wurde erhört. Sie bekam einen Bart, der den Freier natürlich in die Flucht jagte. Darauf hat dann ihr Vater sie kreuzigen lassen. Man kann sie in der Westminster Abbey sehen, in der Kapelle Heinrichs des Siebten, mit langem Haar und Vollbart.«
»Dann bete ich doch lieber nicht zur Heiligen Ohnesorge«, sagt Helen, während ihr Gatte am anderen Tischende sich allen Beschwichtigungsversuchen erfolgreich widersetzt und fortfährt, seine Verluste zu beklagen. »Womöglich«, sagt Helen, »wächst mir sonst ein Bart.«
»Kaum anzunehmen«, sagt Hurley.
»Dann könnte ich es ja mal nach der Methode Ohnesorge versuchen«, meint Helen.
Ella Untzinger, die links von Hurley sitzt, unterhält sich zwar mit dem jungen William Damien, aber ihre Ohren sind bei dem Gespräch zwischen Hurley und Helen. Ella plaudert mit dem jungen William Damien, ohne selbst viel zu sagen, denn das Thema Diebstahl hat sich durchgesetzt, und William berichtet soeben, wie seiner Margaret auf der Hochzeitsreise in Florenz die Handtasche gestohlen wurde. Ellas lange blonde Haare hängen ihr wie ein dünner Vorhang vor dem Gesicht.
»Unzucht!« tönt Brian Suzys Stimme vom anderen Tischende. »Notzucht!«
»Sind Sie zur Polizei gegangen?« fragt Ella, mit den Ohren nach wie vor bei Hurleys rebellischer Heiliger Ohnesorge.
»Ja«, nuschelt William, der sonst eigentlich nicht nuschelt; jetzt nuschelt er wahrscheinlich, weil er sich langweilt. »Aber wir haben die Tasche nicht wiederbekommen«, erklärt er der Vollständigkeit halber. »Das wichtigste waren die Papiere. Margaret hatte ihren Paß und die Kreditkarte darin, so daß wir aufs Konsulat mußten. Und so weiter.«
»Und das auf der Hochzeitsreise«, sagt Ella. »Schade um die vertane Zeit.«
»Es war eine Erfahrung«, sagt William.
»Ja, aber solche Erfahrungen sucht man gewöhnlich nicht, wenn man ins Ausland reist, es war ja keine schöne Erfahrung.«
»Kann man nicht behaupten.« William wirft einen gelinde verzweifelten Blick zu seiner Frau hinüber, als wolle er sagen: »Soll das hier ewig so weitergehen?« Aber Margaret sieht nicht in seine Richtung. Und seine Nachbarin zur Linken, Annabel Treece, ist von den Leiden Brian Suzys in Beschlag genommen. Annabel hat eine hohe Stirn und ein eckiges Kinn. Sie trägt ein blaues Kleid mit Perlen.
»Wohnen Sie in London?« möchte William jetzt von Ella wissen.
»Wir sind viel in Brüssel, wegen der Arbeit meines Mannes, aber ich hoffe demnächst eine feste Wohnung in London zu finden. Seit kurzem habe ich einen Lehrauftrag an der London University, ich bin Geographin und Kartologin.«
Sie ist also doch keine dumme Gans. Dumm ist an dieser Tafel eigentlich niemand. Hurley und Chris legen auf das intellektuelle Niveau ihrer Gäste immer großen Wert, wenn sie eine Gesellschaft geben. William blickt jetzt schon etwas fröhlicher zu seiner Frau hinüber, die über den Tisch zurücklächelt, während sie eine Gabel Lachsmousse zum Mund führt. Dann wendet sie sich Roland Sykes zu, dem jungen Mann zu ihrer Linken. »Vielleicht«, sagt sie, »haben Einbrüche auch ihr Gutes.«
Roland Sykes mit dem kunstvoll silbergraugetönten Bürstenhaarschnitt meint, ihm sei nicht recht ersichtlich, was an einem Einbruch gut sein könne, außer für die Einbrecher.
»Nach der Lehre mancher Mystiker«, sagt Margaret, »ist es doch die höchste Tugend, seiner liebsten Besitztümer zu entsagen.«
»Ich sehe einen Unterschied zwischen Entsagen und Bestohlenwerden«, antwortet der gescheite junge Roland. »Ohne Moralist sein zu wollen, rein ethisch betrachtet, beinhaltet das Bestohlenwerden immer irgendein Verbrechen, was bei einer freiwilligen Besitzaufgabe nicht der Fall ist.«
Rolands Kusine Annabel Treece versucht derweil ihren Tischherrn Brian Suzy zu trösten, indem sie ihm auseinandersetzt, daß die Leute, die in sein Haus eingebrochen seien, bestimmt geistig minderbemittelt waren, drogenkrank, und darum eher zu bedauern als zu verurteilen.
»Oh, die wußten schon, was sie taten«, sagt Brian. »Sie hätten noch Schlimmeres angerichtet, wenn sie geahnt hätten, was die Sachen wert waren, die sie dagelassen haben. Zum Beispiel haben sie einen Francis Bacon an der Wand hängen lassen. Und die Gitarre meiner Frau.«
»Genau das meine ich ja«, sagt Annabel. »Bezeichnend ist, was sie dalassen, nicht was sie mitnehmen.«
»Vielleicht waren sie nur der Meinung, sie könnten ein Bild wohl nicht so leicht zu schnellem Geld machen«, sagt Brian. »Und es würde mich nicht wundern, wenn sie die Gitarre einzig aus Solidarität mit ihrer eigenen Generation dagelassen hätten.«
»Dann bleibt es eben doch dabei, daß sie offenbar geistig recht beschränkt sind«, sagt Annabel. »Oder vielleicht«, fährt sie fort, »sind sie sogar geschichtsverhaftet.«
Das gibt Brian Suzy Rätsel auf. Annabel ist Produktionsassistentin beim Fernsehen und der Philosophie und Psychologie sehr zugetan, denen sie auch einen großen Teil ihrer Freizeit widmet. Sie hat eine Theorie entwickelt, wonach jeder Mensch psychologisch einem bestimmten Zeitalter verhaftet sei. »Die einen«, klärt sie jetzt Brian auf, »gehören dem achtzehnten Jahrhundert an, andere dem fünfzehnten, andere dem dritten, wieder andere dem zwanzigsten. Jeder praktizierende Psychiater sollte Geschichte studiert haben. Die meisten ihrer Patienten«, erklärt sie, »sind ihrem historischen Zeitalter verhaftet und außerstande, den Anforderungen und Gepflogenheiten unseres Jahrhunderts gerecht zu werden.«
»Dann gehören die Leute, die in mein Haus eingebrochen sind, wohl zur Ära des Neandertalers«, sagt Brian. »Sie haben das ganze Haus vollgepinkelt.« Er spricht gereizt, ja gehässig, denn er ist nicht gewillt, Nachsicht gegenüber den Dieben walten zu lassen, und Annabel ihrerseits ist nicht hübsch genug, um ihm freundlichere Töne zu entlocken.
Die Teller werden abgeräumt, dann kommt der nächste Gang. Der Student, der heute aushilft, tritt ein. Er ist groß und anmutig und hat dunkle Locken über dem schmalen braunen Gesicht, dazu sehr schöne graue Augen, über denen seine Brauen fast aneinanderstoßen. Er bringt eine Servierplatte mit Mastfasan, speckumwickelten Würstchen sowie Erbsen und Teltower Rübchen. Geschickt faßt er das Vorlegebesteck und beginnt bei Helen Suzy. Der reguläre Butler folgt ihm und füllt roten Bordeaux in die Gläser. Nachdem Helen bedient ist, geht der junge Student weiter um den Tisch herum und beugt sich nacheinander über die Damen. Erst danach bedient er, wie es ihm aufgetragen ist, die Herren von einer genau gleichen Platte, die bis jetzt auf dem Anrichtetisch stand. Bis alle mit Fasan und Wein versorgt sind, hat der reguläre Butler eine Platte mit sautierten Kartoffeln auf den Anrichtetisch gestellt. Alles ist zeitlich so abgestimmt, wie es sich gehört, auch wenn es vielleicht niemand merkt. Doch als die sautierten Kartoffeln zu Ernst Untzinger kommen, hört man die Vorlegegabel klappern. Sie fällt zu Boden. »Oh, das macht nichts«, sagt Ernst, »ich kann den Löffel nehmen.« Was er dann auch tut. In Wirklichkeit kam das kleine Mißgeschick aber dadurch zustande, daß Ernst versucht hat, die Hand des jungen Mannes zu berühren, der ihn bedient.
Ella Untzinger spricht inzwischen über William Damien hinweg mit der links von ihm sitzenden Annabel Treece, ohne ihn jedoch ganz von der Unterhaltung auszuschließen. Sie sind vom Diebstahl abgekommen und diskutieren jetzt über Frauenkarrieren.
»Ich mußte einfach eine Arbeit haben. Auch verheiratete Frauen brauchen einen Beruf, das weiß doch jeder«, sagt Ella zu Annabel. »Sie als Ledige brauchen wenigstens niemandem den Schlafanzug nachzutragen, die Anzüge zu bürsten und die Hemden zu bügeln.«
»Das tun Sie alles?« fragt William. »Wenn das stimmt, bin ich doch froh, daß ich geheiratet habe. Allerdings bezweifle ich –«
»Es stimmt, und oft nicht nur im übertragenen Sinne«, sagt Ella.
Annabel sagt: »Es ist erregend für eine Frau, Männerkleidung anzufassen. Aus psychologischer Sicht ungemein befriedigend.«
»Mag sein, wenn man den Mann liebt«, sagt Ella.
»Das kommt hinzu.«
2
Drei Wochen vor dem Dinner bei Hurley Reed und Chris Donovan stand Ernst Untzinger in der möblierten Etagenwohnung, die er als Quartier für seine Dienstreisen von Brüssel nach London gemietet hatte, und ordnete einen Blumenstrauß.
»Wie du weißt«, sagte er zu dem jungen Mann, der auf dem Sofa saß und ihm zusah, »will Ella hier eine Wohnung kaufen. Sie braucht aus beruflichen Gründen eine Bleibe in London. Ich denke, sie wird zwischen hier und Brüssel hin und her pendeln, vielleicht sogar abwechselnd mit mir. Eigentlich eine recht interessante Situation. Ella liebt Iris mit Rosen. Sie passen auch gut zusammen, sofern man sie bekommt.« Er hatte zu Ende gesprochen, da der junge Mann aber nicht antwortete, begann er eine Melodie zu summen. Dann sagte er:
»Weißt du, Luke, Ella und ich haben uns wirklich sehr gern. Immerhin kennen wir uns schon, seit sie sechzehn und ich neunzehn war. Sie ist aus Manchester, genau wie ich.«
Luke sagte: »Ella ist eine feine Frau. Ich würde nie etwas auf sie kommen lassen.« Luke absolvierte einen Postgraduiertenkurs an der London University, nachdem er in Amerika am Rutgers College studiert hatte. Seine Heimat war New Jersey. Er hatte sich stets mit Stipendien durchs Studium geschlagen; sein Taschengeld verdiente er sich damit, daß er mehrmals wöchentlich in Lokalen oder Privathäusern als Bedienung aushalf. In drei Wochen sollte er in Islington auch bei dem Dinner aushelfen, das Chris Donovan und Hurley Reed gaben.
Ein Schlüssel drehte sich im Schloß. »Hallo«, sagte Ella. »Oh, hallo, Luke«, sagte sie. »Was für wunderschöne Blumen.«
Ella war groß und schlank und sehr gepflegt. Ihr sehr blondes, schimmerndes Haar trug sie offen um ihr länglich geformtes Gesicht mit den zwei kleinen, blaugrauen Augen. Sie war zweiundvierzig Jahre alt. Es war offensichtlich, daß sie sich freute, den hübschen jungen Luke zu sehen. Sie küßte zuerst ihn, dann Ernst, der große Genugtuung über ihr Kommen ausstrahlte.
Ella hatte Luke vor ein paar Monaten mit Ernst bekannt gemacht, indem sie ihn zum Abendessen in ihre Wohnung einlud; sie selbst hatte Luke in der Universitätsbibliothek kennengelernt. Ernst war an dem Abend gerade aus Brüssel gekommen. Ihm gefiel der junge Mann, das heißt, er hatte seinen Spaß an ihm, vor allem an seiner Wichtigtuerei mit seinen durch und durch banalen akademischen Leistungen, während er das einzige, womit er sich wirklich hätte brüsten können, betont herunterspielte, nämlich mit wieviel Mut und Eigenständigkeit er seinen Weg durch die Universitäten gemacht hatte.
Ernst war sehr groß und schon teilweise ergraut. Er hatte dichte schwarze Brauen über Augen, die so dunkel schillerten, daß man kaum erkennen konnte, von welcher Farbe sie waren. Er hatte einen großen, schönen Mund, einen noch sehr neuen grauen Bart und eine längliche Nase. Das alles summierte sich zu einer angenehmen Erscheinung. Er war fünfundvierzig Jahre alt. Zunächst hatte er geglaubt, Ella schlafe mit Luke, wenn sie über Tage oder Wochen allein in London war und er in Brüssel blieb. Er hatte daran weiter keinen Anstoß genommen, denn im Grunde hatte er es nur verständlich gefunden. Inzwischen hielt er es nur noch schwerlich für denkbar, daß Luke der Liebhaber seiner Frau war, denn der junge Mann zeigte eine eindeutige Neigung zu ihm selbst.
»Wir sollten uns vorsehen, daß wir ihn nicht zu sehr verwöhnen«, sagte Ella, nachdem Luke, besonders während der Abwesenheiten ihres Mannes, ihr ständiger Gast geworden war.
»Gib ihm kein Geld«, sagte Ernst.
»Gewiß nicht. Er hat auch noch nie darum gebeten«, sagte Ella.
»Gut. Gib ihm zu essen und zu trinken, das genügt. Er kann dafür den Tisch decken und abwaschen.«
»Das tut er meist. Ich hoffe, daß er mir hilft, eine Wohnung zu finden.«
Ernst und Ella hatten ein Kind, eine Tochter, die vor kurzem geheiratet hatte und jetzt in New York lebte. Luke füllte gewissermaßen die Lücke, die sie hinterlassen hatte. Ernst, der so klug war, so sprachbegabt, hatte gute Verbindungen auf dem Kontinent und fühlte sich wohler in Brüssel, doch da nun Ella beschlossen hatte, in London Karriere zu machen, war er es recht zufrieden, bei seinen Besuchen in London, die manchmal bis zu einer Woche dauerten, Luke zu sehen. Recht zufrieden im ersten Monat ihrer Bekanntschaft, doch jetzt, am Ende des zweiten Monats, geriet er förmlich in Ekstase. Da war sie wieder, die alte Tollheit. Die alte Erregung hatte Ernst gepackt: Bei allem, was er tat und dachte, lauerte irgendwo in seinem Hinterkopf der junge Luke; bei wichtigen Sitzungen und Konferenzen, bei Arbeitsessen im kleinen Kreis: immerzu der junge Luke. Ich bin toll nach ihm, toll, dachte Ernst, wenn er in Heathrow hastig seinen Gurt einklinkte und sich ins Verkehrsgewühl stürzte, hin zu Luke, der in der möblierten Wohnung ein und aus ging, und auch Ella. »Was für wunderschöne Blumen.« Manchmal riefen sie den Zimmerservice an und ließen sich etwas zu essen heraufbringen, manchmal kochten sie selbst in der kleinen Küchennische und stellten sich zum Essen an die Küchentheke.
»Bleib zum Abendessen«, sagte Ernst zu Luke.
»Geht nicht«, sagte Luke mit einem Blick auf die Uhr. »Ich muß von acht bis zwölf bei einer Party am Buffet aushelfen.«
»Wie schaffst du dein Studium bei den vielen abendlichen Nebenbeschäftigungen?« fragte Ella.
»Ich brauche nicht viel zu büffeln«, sagte Luke. »Es genügt, wenn ich die Vorlesungen besuche. Ich merke mir alles. Man muß nur Köpfchen haben.«
»Ich kann dich für deine Arbeiterei jedenfalls nur bewundern«, sagte Ernst. »Das würden nicht alle jungen Leute machen.«
»Köpfchen …«, sinnierte Luke, als bewundere er im tiefen Brunnen seines geistigen Auges sein eigenes Spiegelbild – weit entfernt von Ernsts moralischer Bewertung. Er schlürfte ein Bier aus der Dose.
Ella ging den Mantel ablegen. Sie kam in Bluse und Hose zurück und trug jetzt ein paar grellgrüne Schuhe mit zehn Zentimeter hohen Absätzen. Luke sah wieder auf die Uhr. »Ich muß gehen.«
»Was hast du da für eine wunderschöne Uhr! Ist sie neu?« fragte Ella.
»Ja, ziemlich«, sagte Luke. Er küßte Ella, winkte kurz zu Ernst hinüber und ging.
Ella wählte einen trockenen Martini. Sie setzte sich neben Ernst auf das Sofa. »Hm!« machte sie, wobei sie sich vorbeugte und eine Iris in der Vase umsteckte.
»Was ›hm‹?« fragte Ernst.
»Die Uhr«, sagte sie. »Patek Philippe.«
»Sie sah teuer aus«, sagte er bedächtig, ohne sie aus den Augen zu lassen.
»Du solltest es wissen«, sagte Ella.
»Ich weiß es«, sagte Ernst. »Und du weißt es sicher noch besser.«
»Du hast ihm die Uhr geschenkt, Ernst.«
»Nein, ich dachte, du«, sagte er.
»Ich? Du dachtest, ich?«
»Du hast sie ihm also nicht geschenkt?« fragte er.
»Natürlich nicht. Wie käme ich dazu? Wofür? Wenn er sie dagegen von dir hätte, müßte es wohl einen Anlaß dafür geben.« Sie hatte die Füße in den hohen grünen Pumps auf dem Couchtisch übereinandergeschlagen.
»Ich habe ihm überhaupt nichts geschenkt, Ella«, sagte er. »Aber von wem kann er diese Uhr nur haben?« Ernsts Stimme klang beunruhigt. »Etliche tausend Dollar. Das riecht nach Geld.«
»Du hattest gehofft, ich hätte sie ihm geschenkt«, sagte Ella.
»Ich hoffe gar nichts, ich überlege nur«, sagte Ernst.
»Und ich hatte gehofft, sie wäre ein Geschenk von dir«, sagte Ella. »Wenn nicht, macht mir das irgendwie angst.«
»Er hat sie nicht von mir bekommen. Auch mir ist das nicht geheuer, nicht so sehr die Uhr, das Unbekannte daran«, sagte Ernst.
»Wenn du ihm nicht so zugetan wärst, brauchte niemand Angst zu haben«, sagte Ella.
»Wenn wir ihm nicht beide so zugetan wären«, sagte er.
»Du vielleicht mehr als ich«, sagte sie. »So oder so, ich will nichts mit Gefahr zu tun haben. Und Luke in Verbindung mit einem unbekannten reichen Wohltäter bedeutet Gefahr. Was wissen wir schließlich über ihn?«