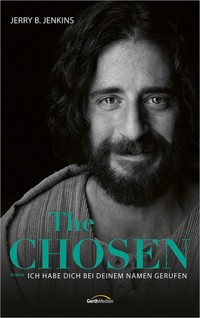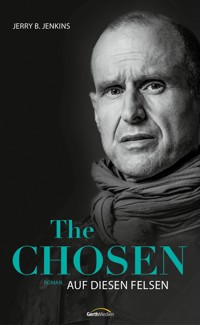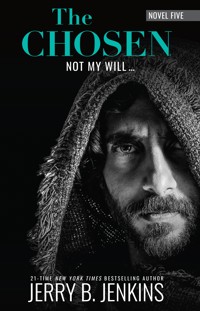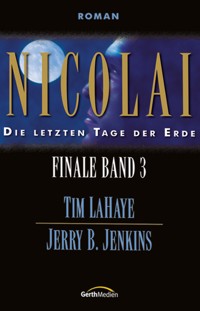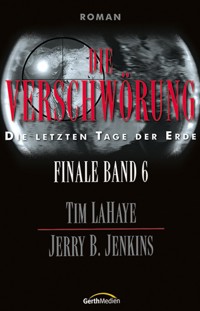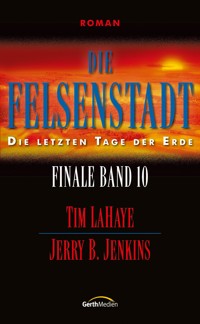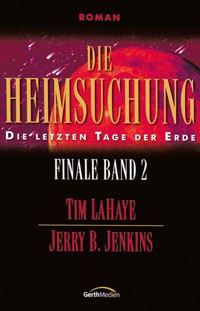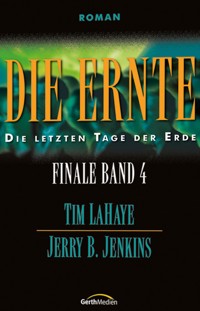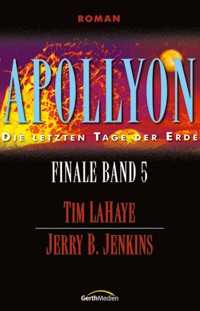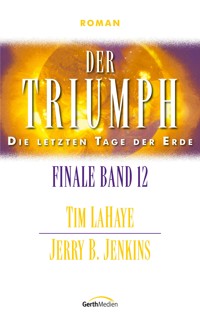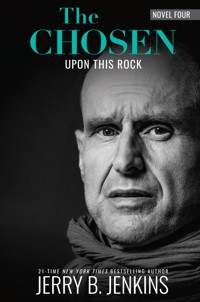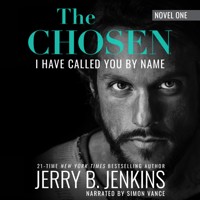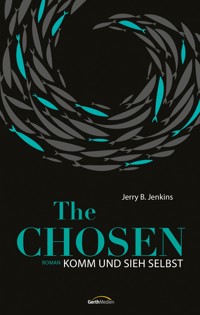
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: The Chosen
- Sprache: Deutsch
Dieser Roman nimmt mitten hinein in die Geschehnisse rund um Jesus und die Menschen, die ihm nachfolgen: Simon Petrus, Johannes, Matthäus und Maria Magdalena lernen den Sohn Gottes immer besser kennen. Doch es gibt auch Rückschläge, Missverständnisse und Streitfragen, die es zu lösen gilt. Außerdem stoßen weitere Personen zu der wachsenden Gruppe um Jesus dazu, die alle ihre eigenen Lebensgeschichten mitbringen: Baumeister Nathanael, der weise und erfahrene Philippus, Simon der Zelot und ein gewisser Judas Iskariot ... Bestsellerautor Jerry B. Jenkins beschreibt das Leben und Wirken von Jesus in enger Anlehnung an die biblischen Berichte. Gleichzeitig aber auch auf eine so lebendige Art und Weise, dass man das Gefühl hat, selbst Teil der Geschichte zu sein. Dieser Roman basiert auf der zweiten Staffel der erfolgreichen TV-Serie "The Chosen".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Jerry B. Jenkins hat als Autor und Co-Autor mittlerweile mehr als 150 Bücher geschrieben. Zu seinen Veröffentlichungen zählen neben Romanen auch mehrere Biografien sowie Sachbücher für Ehe und Familie. Er verbrachte 13 Monate mit Billy Graham, um diesen beim Schreiben seiner Lebenserinnerungen zu unterstützen. Mit seiner Frau Dianna lebt er in Colorado. Sie haben drei erwachsene Söhne und acht Enkel.
Für Arthur Taylor, Pfarrer der Welland Canal Misssion, St. Catharines,Ontario, Kanada. Er ist ein Vorbild für jeden Christen, denn Wort und Tat sind bei ihm eins.
Grundlage dieses Romans ist die TV-Serie The Chosen von Dallas Jenkins. Drehbuch von Ryan M. Swanson, Dallas Jenkins und Tyler Thompson. Regie: Dallas Jenkins.
VORBEMERKUNG
The Chosen wurde von Menschen geschaffen, die Jesus Christus lieben und die Bibel als Gottes Wort betrachten. Wir wünschen uns von Herzen, dass Sie selbst dieses Buch zur Hand nehmen, in die Evangelien eintauchen und Jesus entdecken.
„Nazareth?“, entgegnete Nathanael. „Was kann von da schon Gutes kommen!“ Doch Philippus antwortete ihm: „Komm mit und sieh selbst!“
Johannes 1,46
TEIL 1
Kapitel 1
„… BEVOR ER MICH KANNTE“
Haus von Johannes, Ephesus, A. D. 44
Trauer. Nichts als Schmerz.
Am vierten Tag der Schiwa für seinen Bruder, den großen Jakobus, tut Johannes alles, um sich von seinem Schmerz abzulenken. Jakobus war auf Anweisung von König Herodes Agrippa von Judäa durch das Schwert hingerichtet worden. Der Jesus-Schüler, der immer davon überzeugt war, dass Jesus ihn ganz besonders liebte, hat seine wenigen Notizen aus der Zeit mit dem Rabbi aufbewahrt. Angetrieben durch diese jüngste Tragödie will er sie jetzt ausarbeiten, bevor ihm und seinen Kameraden dasselbe Schicksal widerfährt wie Jakobus. In seinem Bericht will er ihre Erlebnisse aus der Zeit mit dem Rabbi ganz genau schildern, und zu diesem Zweck hat Johannes die Freunde zu sich eingeladen, die zusammen mit ihm und seinem Bruder drei Jahre lang mit Jesus durch das Land gezogen sind. Diese drei Jahre haben einen bleibenden Eindruck bei ihnen allen hinterlassen. Kein Mensch könnte das jemals vergessen! Gemeinsam wollen sie ihre Erinnerungen austauschen. Die Gemeinden, die ganze Welt soll davon erfahren.
Im größten Raum seines bescheidenen Heimes hat Johannes Stühle und Bänke aufgestellt. Aber werden die anderen überhaupt kommen, an einem Abend wie diesem? Gemeinsam hatten sie selbstverständlich an der Beisetzung des großen Jakobus teilgenommen und waren am Abend an der Seite Marias, der Mutter von Jesus, und Johannes’ geblieben. Kann er von ihnen erwarten, dass sie während der siebentägigen Trauerzeit noch ein zweites Mal kommen? Das ist viel verlangt, trotzdem hat er sie darum gebeten, aber nicht nur, um ihm und Maria Trost und Unterstützung zu geben.
Dunkle Wolken sind am späten Nachmittag aufgezogen, und jetzt zucken Blitze über den dunklen Abendhimmel. Wenn seine Freunde nicht bald eintreffen, werden sie in einen Regenguss geraten. Vorsichtig öffnet Johannes die Haustür. Ein eisiger Windstoß zwingt ihn, sie festzuhalten, damit sie nicht gegen die Wand schlägt.
„Geduld“, mahnt Mutter Maria. Sie legt sich einen Schal um den Kopf. „Sie kommen bestimmt. Du weißt, dass sie kommen werden. Der Abend ist doch gerade erst angebrochen.“
Seit man ihren Sohn am Kreuz hingerichtet hat – vor langer Zeit –, lebt diese Frau mit der besonderen Ausstrahlung bei Johannes. Noch am Kreuz hatte Jesus zu ihr gesagt: „Das ist jetzt dein Sohn!“ Und zu Johannes: „Sie ist jetzt deine Mutter!“
Und so ist es tatsächlich. Maria ist für Johannes zu einer Mutter geworden, er liebt sie und weiß, dass sie ihn ebenfalls liebt. Die Jahre und der Kummer haben ihre Haare grau werden lassen, aber er liebt jede Falte in ihrem klaren, heiteren Gesicht.
„Mach die Tür zu“, sagt sie und legt ihm sanft die Hand auf die Schulter.
Johannes kommt ihrer Aufforderung nach. Ein Windstoß bringt die Kerze auf dem Fenstersims zum Verlöschen. Ganz plötzlich setzt der Regen ein.
„Oh nein“, stöhnt er.
„Mach dir keine Sorgen“, beruhigt Maria ihn. „Die Männer sind an jedes Wetter gewöhnt …“
„Aber Maria aus Magdala wird bei ihnen sein …“
„Sie ist eine erwachsene Frau!“, erwidert sie lächelnd. „Und ganz bestimmt auf alles vorbereitet. Sieh nur zu, dass das Feuer hell brennt, und stell dich darauf ein, schmutzige Füße zu waschen.“
Eine Stunde später sind alle da, haben den Regen aus ihren Gewändern geschüttelt, ihre Füße sind gewaschen, und sie haben sich nacheinander am Feuer aufgewärmt. Johannes hat es leidgetan, dass er ihnen diese Strapaze zugemutet hat, aber nun ist er erleichtert und er freut sich auf die Begegnung. Die Stimmung ist nicht viel anders als am ersten Abend der Schiwa, aber die Freunde fühlen sich sichtlich nicht so recht wohl, wissen nicht, was sie sagen, was sie tun sollen.
„Heute Abend möchte ich nur reden“, beginnt er, um ihnen die Befangenheit zu nehmen.
Die Stimmung ist gedrückt, und er muss laut sprechen, um das Prasseln des Feuers und das Heulen des Windes zu übertönen. Er sitzt vor ihnen am Tisch, die im Windzug flackernden Kerzen werfen ihr Licht auf die Seiten, die er vor sich ausgebreitet hat. „Ich möchte einfach Fragen stellen und mir Notizen machen.“
„Über deinen Bruder?“, platzt Matthäus heraus.
„Ganz ohne Frage sind mein Herz und meine Gedanken bei ihm“, erwidert Johannes, „aber nein. Ich möchte über Jesus reden. Petrus, fangen wir mit dir an, wenn es dir recht ist. Schildere mir doch noch einmal deine erste Begegnung mit ihm.“
Petrus lächelt. Sein Bart ist mittlerweile von grauen Strähnen durchzogen. „Du meinst, bevor er meinen Namen geändert hat? Hmm. Das erste Mal? Das weißt du doch, Johannes. Du warst auch da.“
„Erzähl’s noch mal.“
Petrus seufzt. „Ich war mit Andreas’ altem Fischerboot draußen auf dem See und hatte eine miese Nacht.“ Er blickt hoch. „Zuerst wusste ich gar nicht, dass er es war. Weißt du noch? Ich dachte, er wäre der Römer, der mein Leben ruinieren wollte.“ Lächelnd schüttelt er den Kopf.
„Und was ist dann passiert?“
Simon Petrus berichtet, wie er die Hilfe des Mannes zuerst abgelehnt, dann seinen Rat aber doch angenommen hatte, und wie sein Boot unter der Last der vielen Fische, die er gefangen hatte, beinahe gekentert wäre. Er hatte sich Jesus vor die Füße geworfen und gefleht: „Geh fort! Fort von mir! Ich bin ein sündiger Mensch.“ Aber Jesus hatte ihm darauf geantwortet, er solle keine Angst haben, sondern mit ihm gehen und ein Menschenfischer werden.
Thomas ist der Nächste. „Es war der Moment, als ich dachte, mein Lebenswerk sei zerstört und damit auch mein guter Ruf.“ Er kann sich ein strahlendes Lächeln nicht verkneifen, und Johannes findet das irgendwie tröstlich in einer Zeit, die der Trauer vorbehalten ist. Während Thomas berichtet, wie Jesus Wasser in Wein verwandelte und so ein Hochzeitsfest rettete und damit auch den Ruf von Thomas und Ramah, schreibt Johannes mit.
Jetzt ist Nathanael an der Reihe. „Meine erste Begegnung mit ihm? Philippus sagte einfach nur: ‚Du musst mitkommen. Komm und sieh selbst.‘ Und das habe ich getan.“ Er hat den Blick eindringlich auf Johannes gerichtet. „Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll … aber er … er hat mich erkannt, bevor er mich kannte.“ In tiefem Schmerz hatte Nathanael kurz zuvor unter einem Feigenbaum gesessen. Der Rabbi hatte ihn dort gesehen, und er kannte ihn mit Namen.
„Jetzt ich?“, fragt Andreas lächelnd. „Ich habe neben Johannes dem Täufer gestanden …“
„Ja, dem gruseligen Johannes“, wirft Simon Petrus ein. Möglicherweise hat er vergessen, wo er ist und was der Anlass für ihre Zusammenkunft ist.
„… Und plötzlich war er da. Wie aus dem Nichts. Johannes war außer sich. Und er sagte nur: ‚Seht!‘“
„… ‚ich esse noch eine Heuschrecke!‘“, frotzelt Petrus.
Andreas versetzt ihm einen Rippenstoß.
Typisch für Simon Petrus, denkt Johannes.
Thaddäus sitzt neben Johannes und Jakobus dem Kleineren. „Meine erste Begegnung – er hat einfach nur dagesessen und zusammen mit den anderen Handwerkern Witze gerissen. Und zu Mittag gegessen.“ Bei der Erinnerung muss er lächeln, doch sofort wird er wieder ernst.
„Ich war gerade auf dem Weg nach Jerusalem“, berichtet der kleine Jakobus. Ganz unvermittelt ist es um seine Fassung geschehen. „Es tut mir leid. Es fällt mir nur so schwer, über all das zu sprechen. Denn dann merke ich, wie sehr ich ihn vermisse.“
„Aber es ist wichtig. Wir müssen darüber reden“, erwidert Johannes.
„Ich weiß. Es ist nur – mit anderen spreche ich jeden Tag über ihn. Aber mit euch ist das etwas anderes. Ihr habt ihn alle gekannt. Da fällt es mir sehr viel schwerer.“
Jetzt wendet sich Johannes an Maria aus Magdala, die ihm gegenüber am Tisch sitzt. Sie ist jetzt eine reife Frau, immer noch von dieser sanften Schönheit, die sich erst entfalten konnte, nachdem sie von den Dämonen befreit worden war. „Erzähl doch noch mal, wie es war, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast.“
Sie lächelt verlegen. „Das war in einer Taverne.“ Maria nickt. „Er hat seine Hand auf meine gelegt.“ Sie blickt kurz in die Runde. „Das hört sich jetzt seltsam an. Vielleicht lassen wir diesen Teil lieber weg. Die Leute wundern sich sonst noch.“
„Ich weiß noch nicht, was ich verwenden werde“, erklärt Johannes. „Ich schreibe erst mal alles auf. Lieber erst einmal sammeln und später sortieren.“
„Gut“, erwidert sie und berichtet von ihrer Begegnung mit dem Fremden, den sie am Ende als ihren Befreier, ihren Erlöser erkannte. Er hatte sie mit ihrem richtigen Namen angesprochen und ihr Leben von Grund auf verändert.
Johannes beschäftigt inzwischen der Unterschied zwischen dem Matthäus, der vor ihm sitzt, und dem Steuereintreiber, der er gewesen war, als Jesus ihn in seine Nachfolge rief. Immer wieder erstaunlich! Damals trug Matthäus kostbare Kleidung, die er sich mühelos leisten konnte, und sein jugendliches Gesicht war ohne Bart und glatt gewesen. Jetzt hat er einen Vollbart, und seine Kleidung ist genauso einfach und zerschlissen wie die der anderen.
„Es war der vierte Tag der dritten Woche des Monats Adar …“, beginnt Matthäus. „Irgendwann zur zweiten Stunde.“
Immer noch derselbe alte Matthäus. „So genau muss es nicht sein.“
Matthäus fährt zusammen. „Warum nicht? Mein Bericht wird sehr genau sein.“
Das wundert Johannes nicht. Auch Matthäus arbeitet an einem Bericht, und Johannes ist schon gespannt, ob sich darin der detailbesessene Autor wiederfinden wird. Doch im Augenblick lauscht er genüsslich der Geschichte von Matthäus. Staunend war er dem Ruf des Meisters gefolgt. Sein römischer Leibwächter hatte es nicht fassen können, dass er einfach alles zurückließ, um sich Jesus anzuschließen.
Jesus’ Mutter Maria hat sich Johannes bis zum Schluss aufgehoben. Erschöpft lässt sie sich ihm gegenüber am Tisch nieder. Er stellt ihr dieselbe Frage wie den anderen.
„Meine Antwort ergibt vielleicht keinen Sinn“, beginnt sie.
„Versuch es, Mutter.“
„Ich kann mich kaum noch an Zeiten erinnern, in denen er nicht da war.“ Sie unterbricht sich und mustert Johannes nachdenklich. „Da war dieser eine kleine Tritt.“
Johannes nimmt ein neues Papyrusblatt von seinem Stapel, der Stift aus Schilfrohr kratzt darüber, als er schreibt. „Und dann?“
Maria zögert, schaut ihn an. „Mein Sohn, warum tust du das alles? Warum jetzt?“
„Weil wir alle älter werden, und unsere Erinnerungen …“
„Ich meine, warum jetzt, während der Schiwa?“
„Weil alle versammelt sind. Ich will ihre Erinnerungen festhalten, damit …“
„Du solltest trauern. Um den großen Jakobus.“
Johannes weicht ihrem Blick aus. „Das wird auch noch anderen von uns passieren. Und wer weiß, wann ich die anderen wiedersehe, und ob überhaupt? Ich habe es nicht eilig und will ja kein ganzes Buch schreiben, aber ich möchte alles Geschehene festhalten, solange wir, die es miterlebt haben, noch zusammen sind.“
„Will Matthäus nicht auch etwas schreiben?“
„Er schreibt nur auf, was er auch gesehen hat oder was Jesus ihm persönlich erzählt hat. Aber ich habe Dinge erlebt, die Matthäus nicht erlebt hat. Ich war einer seiner engsten Vertrauten. Er hat mich geliebt.“
„Er hat euch alle geliebt.“ Sie lächelt. „Du hast nur öfter das Bedürfnis, darüber zu reden, als die anderen.“
Das kann Johannes nicht abstreiten.
„Das, was ich erlebt habe, behalte ich lieber in meinem Herzen“, seufzt Maria etwas wehmütig, und Johannes schreibt sogar das auf. „Wenn man alles, was Jesus getan hat, aufschreiben wollte, gäbe es auf der Welt nicht genügend Platz für die Bücher, die geschrieben werden müssten.“
Verwundert schaut Johannes sie an. „Hmm. Eine Art Absicherungserklärung vorab. Das ist gut. Das halte ich fest. Verstehst du, Mutter, wenn ich das alles nicht aufschreibe, geht es für die Nachwelt verloren. Jakobus würde mir ganz bestimmt zustimmen.“
Sie schweigt wieder. „Womit willst du anfangen?“, fragt sie schließlich.
„Mit dem Anfang natürlich. Ich bin nur nicht sicher, mit welchem.“
„Seiner Geburt?“, fragt sie.
„Noch früher.“
„Seinen Vorfahren?“
„Das wird sicherlich Matthäus übernehmen.“
„Wie wäre es mit den Prophezeiungen? Der Verheißung an Abraham?“
Johannes nickt. „Ich dachte tatsächlich an Abraham. Aber auch davor ist noch so vieles geschehen.“
„Was war vor Abraham?“
„Noah.“
„Und vor Noah?“
„Der Garten.“
„Dann fang doch mit dem Garten an“, schlägt sie vor.
„Aber die Menschen sollen wissen, dass er so viel mehr war als das, was wir erfassen können. Was war vor dem Garten? ‚Denn am Anfang war die Erde noch formlos und leer …‘“
Ein Donnergrollen lässt Johannes aufschrecken. Er schaut aus dem Fenster. „Wenn ich den Donner höre, muss ich an euch beide denken“, bemerkt Maria. Jesus hatte Johannes und seinen Bruder gern „die Donnersöhne“ genannt.
Johannes schüttelt den Kopf. „Unglaublich, was er alles in Kauf genommen hat. Und wenn die Menschen sich nicht mehr an den Klang seiner Stimme erinnern, gibt es nur noch Worte.“
„Er sagte, es sind nicht nur Worte, weißt du noch?“, erwidert Maria. „,Himmel und Erde werden vergehen‘ …“
„,Aber meine Worte werden niemals vergehen.‘“
„Sie sind ewig“, fügt sie hinzu.
Ein weiterer Donner rollt, und Maria erhebt sich langsam. „Dir fällt schon was ein.“ Sie geht um den Tisch herum und massiert seine Schultern. „Aber lass dir Zeit.“ Sie drückt ihm einen Kuss auf den Hinterkopf. „Ich gehe schlafen.“
Und während Johannes noch aus dem Fenster schaut, holen die anderen ihre Umhänge. Die Last des Tages und die Erinnerung an seinen Bruder sind beinahe mehr, als er ertragen kann. Wortlos umarmt er die Freunde und nickt.
Nachdem der Raum sich geleert hat, setzt Johannes sich wieder vor seine Papyrusseiten. Und plötzlich ist er wieder im verachteten Samaria, ausgerechnet! Auf einem steinigen Acker folgt er den Fußspuren seines Bruders. Ein dickes Seil ist um seine Taille gebunden, und er müht er sich mit einem mit Steinen beladenen Karren ab, dessen Räder mit langen Spitzen versehen sind, um die Erde aufzubrechen.
Kapitel 2
VERLOREN
Samaria, 13 Jahre früher
Jeder Schritt ist eine Qual. In der erbarmungslosen Sonne sind die Tuniken von Johannes und Jakobus mittlerweile von Schweiß getränkt. Warum sind sie überhaupt hier und beackern dieses mit Unkraut überwucherte Stück Land, das wer-weiß-wem gehört und sich gegen alle ihre Bemühungen zur Wehr zu setzen scheint? Einerseits empfindet es Johannes als eine Ehre, denn schließlich hat Jesus selbst ihn mit dieser rätselhaften Aufgabe betraut. Andererseits kann er immer noch nicht verstehen, warum sich der Meister überhaupt noch in diesem gottverlassenen Gebiet aufhält – einer Gegend, die die Juden seit Generationen verabscheuen. Alle hatten Jesus gewarnt, ihn hinterfragt und ihm geraten, um Samaria einen großen Bogen zu machen.
Johannes ist selbst erstaunt über seine Gedanken. Seit er sich entschlossen hat, dem Rabbi zu folgen, haben sich seinem Denken neue Horizonte erschlossen. Er schüttelt den Kopf, dass er dieses Gebiet gottverlassen genannt hat. Das stimmt ja nicht mehr, oder?, korrigiert er sich. Denn wenn Jesus der ist, für den er und die anderen ihn halten, dann ist der Messias gekommen. Dann hat der Göttliche etwas im Sinn, sogar mit einem Ort wie diesem. Und wie gewöhnlich wird Jesus sie irgendwann darüber aufklären.
Doch für den Augenblick trottet Johannes erst einmal hinter seinem Bruder Jakobus über den Acker. Der zieht den mit einem großen Stein beschwerten Pflug und zwingt ihn in den Boden. Und so gern Johannes weiter seinen Gedanken nachhängen würde – Gedanken von der Art, wie Jesus sie in ihm wachgerufen hat –, ist doch alles, woran er denken kann, wo er jetzt lieber wäre: überall, nur nicht hier. „Ich würde jetzt lieber nach einem langen Wochenende auf dem See den Frachtraum sauber machen!“
„Ihh!“, erwidert Jakobus. „Du würdest einen Monat lang stinken. Ich würde lieber jedes Loch in Vaters Segeln flicken.“
Johannes lacht. „Und dir dabei vermutlich die eigenen Hände zusammennähen.“ Er beugt sich hinunter, um Steine aufzusammeln und auf die Wiese hinter dem schmalen Stück Land zu schleudern, das sie in der vergangenen Stunde gepflügt haben. „Ich würde lieber mit einem Schwertfisch kämpfen.“
Jakobus legt den unhandlichen Pflug ab und wirft ein paar Steine zur Seite. „Du würdest zu ihm ins Wasser steigen?“
„Ich meinte, an einem Angelhaken. Aber ich würde ihn mit bloßen Händen aus dem Wasser ziehen, wenn ich dafür diese Leute nicht mehr sehen müsste.“
„Du weißt schon, warum der Schwertfisch so heißt, oder? Er hat ein Schwert im Gesicht“, bemerkt der große Jakobus. Beide bücken sich, um Samen in den Boden zu legen.
„Wir haben Glück gehabt, Bruder.“ Johannes lacht. „Weil wir das Feld bestellen dürfen, während die anderen versuchen, mit dem Rabbi in Sychar mitzuhalten.“
„Das war kein Glück“, erwidert Jakobus ernst. „Er hat uns ausgewählt. Steckst du den Samen zwei Daumen tief in die Erde?“
„Ja, ja, und die Reihen drei Handbreit auseinander.“ Johannes richtet sich auf. „Warum hat er uns wohl für diese Arbeit ausgewählt?“
Nachdenklich mustert Jakobus seinen Bruder. „Wir leisten gute Arbeit. Und er weiß ganz genau, dass wir keine Samariter mögen.“
„Johannes überlegt.“ „Vielleicht mag Jesus uns ganz besonders.“
Jakobus lächelt. „Ja, das wird es sein.“
Johannes bemüht sich um einen belanglosen Tonfall, aber er meint es ernst. „Warum, glaubst du, mag er mich am liebsten?“
„Aus denselben Gründen wie ich, mein Lieber. Du bist keine Gefahr für irgendwen, weder körperlich noch geistig.“
„Ah, danke, Bruder … Moment mal …“
„Mich würde interessieren, für wen wir das hier einsäen. Jesus hat gesagt, davon würden Generationen satt.“
„Reisende vielleicht“, vermutet Johannes. „Menschen wie wir, die auf der Durchreise sind.“ Er wiederholt, was Jesus gesagt hat: „,Gastfreundschaft ist nicht nur etwas für die, die ein Zuhause haben.‘“
Jakobus kann ein Lächeln nicht unterdrücken. „Kündige bloß nicht deinen Job für heute.“
„Leider zu spät.“
„Ha! Ja, für mich auch. Komm schon, weiter geht’s. Ich will schließlich diese Arbeit behalten.“
Sie nehmen ihre mühsame Tätigkeit wieder auf. „Da unterhalte ich mich lieber eine ganze Minute lang mit Matthäus.“
„Und ich höre mir lieber Andreas’ Witze an.“
•••
Thomas, seine Freundin Ramah, die Winzerin, und ihr Vater Kafni gelangen an eine Weggabelung im ländlichen Samaria und bleiben stehen. Sie sind zu Fuß unterwegs, Kafni führt einen schwer beladenen Esel am Zügel. Ramah vertieft sich in die Karte. „Sychar liegt auf der anderen Seite des Ebal“, erklärt sie.
Sie diskutieren, welchen Weg sie am besten nehmen. Thomas ist der Meinung, sie sollten sich nach Süden halten, „denn wenn wir weiter nach Westen gehen, dann stoßen wir auf Sebaste, und das ist eine feindliche Stadt.“
„Der schnellste Weg führt zwischen dem Gerizim und dem Ebal hindurch“, versichert Kafni.
„Und der gefährlichste“, wendet Thomas ein.
„Wir umgehen die Städte“, schlägt Ramah vor.
Thomas lächelt. „Auf den Straßen kannst du den Städten nicht ausweichen. Deswegen gibt es die Straßen ja, sie verbinden Städte.“
„Du wirst meine Tochter ganz bestimmt nicht durch die Wildnis zerren.“
„Kafni, ich habe dir mein Wort gegeben, dass ich Ramah beschützen werde.“
„Kannst du dich denn selbst beschützen?“
Thomas seufzt. Wie soll er das formulieren? „Bei allem Respekt …“
„Ihr wollt nach Samaria gehen“, sagt der alte Mann, „und eine Gruppe Männer suchen, die ihr nicht einmal kennt.“
„Eine Frau ist auch dabei“, wirft Ramah ein.
„Eine Frau, die mit Männern herumzieht. Widersprich mir nicht, Mädchen. Das ist reiner Wahnsinn.“
Thomas wirft Ramah einen langen Blick zu. Sie deutet auf eine Gruppe anderer Reisender. „Vielleicht kennen sie den Weg.“
„Shalom!“, ruft Thomas.
Zwei Jungen kommen näher. „He, was fällt dir ein, unsere Mutter anzusprechen, Jude!“, fährt einer der beiden ihn an.
Die drei wollen keinen Ärger und ziehen weiter.
•••
Spät am folgenden Morgen
In einer Herberge am Marktplatz von Sychar hat Simon Neuigkeiten für Andreas, den kleinen Jakobus, Maria aus Magdala und Matthäus. „Thaddäus hat schon fünfzig Leute gezählt, und es kommen immer mehr. Ist Jesus so weit?“
„Er ist noch in seiner Kammer“, erwidert Andreas.
„Er brauchte einen Moment für sich“, ergänzt Maria.
Simon schüttelt den Kopf. „Ja, aber die Leute wollen mehr hören.“
„Er spricht seit Sonnenaufgang zu den Menschen“, wendet Jakobus der Kleinere ein. „Er brauchte eine Pause.“
Andreas bietet an, Jesus etwas Wasser zu bringen.
„Ich dachte, die meisten wären nach der ersten Ansprache gegangen“, merkt Maria an.
„Ja, sind sie auch. Aber nur, um ihre Verwandten und Freunde zu holen“, erwidert Simon. „Und jetzt sind es dreimal so viele wie vorher.“
Matthäus sitzt ein wenig abseits und fädelt mit einem Stift Perlen auf einen kleinen Rechenrahmen. „Sychar hat ungefähr zweitausend Einwohner.“
„Frauen und Kinder nicht mitgerechnet“, ergänzt Maria.
„Zu dieser Jahreszeit ist es zwölf Stunden am Tag hell“, fährt Matthäus fort. „Und er sagte, wir würden zwei Tage bleiben, das sind vierundzwanzig Stunden, die Anzahl der Menschen, die wir pro Stunde erreichen, ist acht … Komma … drei … drei … drei … der …“
„Wie viel ist ‚Komma drei‘ eines Menschen, Matthäus?“, fragt Simon.
„Simon!“, schimpft Andreas.
„Es werden immer mehr Menschen da draußen, und wir müssen überlegen, was wir machen sollen.“
Maria schlägt vor: „Warum erklären wir Jesus nicht einfach die Situation und lassen ihn entscheiden?“
„Das wird er doch ohnehin tun“, meint der kleine Jakobus.
„Ich sag’s ihm“, bietet Andreas an und macht sich mit einem Becher Wasser auf den Weg.
„Wie groß ist die Stadt? Wie viele Stadien breit?“, fragt Matthäus. Über diese Frage muss Simon lachen.
„Die Spalte beinhaltet die Anzahl der erreichten Quadratellen pro Stunde.“
Dieser Kerl, denkt Simon kopfschüttelnd. „Spalten? Quadratellen pro Stunde?“
„Sein Einsatz muss sorgfältig überdacht werden“, erklärt Matthäus.
Simon schaut ihn an, todernst jetzt. Noch immer kämpft er gegen seine Abneigung gegen diesen Mann und seine frühere Tätigkeit an. „Niemand denkt sorgfältiger darüber nach als ich.“
Andreas kommt zurück. „Er ist weg.“
„Was soll das denn heißen?“, fragt Simon.
„Er ist weder in seinem Zimmer noch sonst irgendwo im Haus. Ich habe die Straße …“
„Wir haben ihn verloren?“
„Also, vielleicht nicht verloren“, erwidert Andreas mit einem Seitenblick auf den kleinen Jakobus.
„Gut, Jakobus“, entgegnet Simon, „du suchst im Süden der Stadt. Andreas und ich im Norden. Maria, sag Thaddäus, er soll die Leute im Blick behalten.“
Matthäus erhebt sich. „Und was ist mit mir?“
Ja, denkt Simon. Was ist mit dir? Vor gar nicht allzu langer Zeit hast du unsere jüdischen Brüder erbarmungslos mit Steuern geknechtet. „Du bleibst hier“, bestimmt er. „Falls er zurückkommt.“
„Ich bin bald zurück, Matthäus“, beruhigt Maria ihn, und Simon wundert sich, warum sie stets so freundlich zu diesem Mann ist. „Ich bleibe in der Nähe“, fügt sie noch hinzu.
Sie dreht sich um und will sich entfernen, während Matthäus vor sich hinmurmelt: „Wenn ich hierbleibe, ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass ich Jesus zuerst finde.“
Sie lächelt. „Da haben wir’s doch.“
Kapitel 3
SUCHE NACH JESUS
Simon fragt sich, wie es dazu kommen konnte. Kann man den Messias wirklich verlieren? Oh, sicher, er ist selbstständig und lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Man wird Jesus ganz sicher aufspüren, und er wird wohlauf und munter sein, aber das mindert Simons Sorge keineswegs. Er muss Jesus finden. Simon und Andreas schieben sich durch das dichte Gedränge auf dem Marktplatz von Sychar. „Hast du den Lehrer aus Galiläa gesehen, den Mann, der gestern hier angekommen ist?“, fragen sie jeden, dem sie begegnen. „Er hat auf dem Marktplatz geredet. Mein Meister, er ist so groß, trägt einen Bart und lange Haare. Nein? Den Lehrer?“
Auf der anderen Seite des Marktplatzes ist der kleinere Jakobus auf der Suche. „Der Mann, den man Jesus aus Nazareth nennt – ist er hier vorbeigekommen?“
„Hast du den Lehrer gesehen, Jesus?“
Simon erkennt eine Weinverkäuferin, die am Tag zuvor in der Menschenmenge gestanden hat. „Du hast nicht zufällig den Lehrer gesehen?“
„Er ist hier vorbeigekommen“, erwidert sie. „Wird er wieder sprechen?“
Andreas wählt seine Worte mit Bedacht. „Er hat etwas zu erledigen. Wo ist er hin?“
Sie deutet die Straße entlang. „In diese Richtung.“
Sie wenden sich zum Gehen. „Ich wollte gerade zum Marktplatz und meine Freundin mitbringen“, ruft sie ihnen nach.
„Er wird da sein“, versichert Simon ihr. „Er wird wieder sprechen. Du wirst nicht enttäuscht sein.“
•••
Etwas weiter die Straße hinunter liegt Jesus unter einem auf Steinen aufgebockten Karren und untersucht die Unterseite. Der Besitzer, ein Afrikaner, sieht ihm dabei zu. Jesus ruckelt an verschiedenen Teilen und prüft, ob sie festsitzen. „Gut“, erklärt er. „Alles wieder in Ordnung. So müsste es gehen.“
„Dann war es also tatsächlich die Achse“, seufzt der Afrikaner. „Ich hab’s meinem Bruder ja gesagt, es ist die Achse.“
„Manchmal ist einfach ein frischer Blick nötig. Jetzt reich mir mal das Pech, und er ist wieder so gut wie neu.“
Der Mann reicht Jesus Eimer und Pinsel. „Du bist handwerklich sehr geschickt. Du solltest in der Stadt bleiben und eine Werkstatt eröffnen.“
Die Vorstellung amüsiert Jesus. „Wirklich?“ Er nickt. „Eine Werkstatt.“
Eine Frau in Begleitung einiger Freundinnen stürmt begeistert auf ihn zu. „Rabbi!“, ruft sie. Sie wendet sich zu ihren Begleiterinnen um und scheucht sie fort. „Schnell, holt die anderen!“
Jesus erkennt Photina, die Frau, der er am Jakobsbrunnen begegnet ist und der Mensch, dem gegenüber er zum ersten Mal seine wahre Identität offenbart hat. Sie lacht und ist offensichtlich erfreut, ihn zu sehen.
„Diese Frau“, bemerkt der Afrikaner, „wird dich jedem einzelnen Samariter im Land vorstellen.“
Jesus lacht. „Das hoffe ich doch.“
Er lächelt sie an, und sie weiß offenbar nicht, was sie sagen oder tun soll. Verlegen neigt sie den Kopf zur Seite, schlägt die Hände auf den Rock und wischt sich schließlich über Gesicht und Nacken. „So heiß“, sagt sie entschuldigend.
•••
Allein in der Herberge rutscht Matthäus unruhig auf seinem Stuhl herum und streicht über die aufwendig gearbeitete Tunika, die ihn an die Zeit erinnert, als er noch im Geld schwamm. Es klopft am Tor, und er springt auf. Ist das Jesus?
Hastig reißt er die Tür auf. Drei Menschen, die er nicht kennt, stehen davor – ein junger Mann, eine hübsche junge Frau und ein älterer Mann. „Shalom“, grüßt der junge Mann.
Matthäus runzelt die Stirn. Es ist ein Gebot der Höflichkeit, zu antworten. „Shalom“, erwidert er zurückhaltend.
Der junge Mann mustert ihn. „Dich kenne ich nicht“, erklärt er.
„Vielleicht habt ihr euch in der Tür geirrt“, entgegnet Matthäus und will das Tor wieder schließen.
Der junge Mann drückt es wieder auf. „Warte mal. Wir suchen Jesus.“
„Das tun alle“, erklärt Matthäus, schließt das Tor und geht zurück zu seiner Bank.
Doch von draußen hört er Maria aus Magdala: „Oh, da seid ihr ja. Thomas und Ramah, richtig?“
Erneut öffnet Matthäus das Tor, dieses Mal lächelt die junge Frau. „Ja. Maria?“
„Gutes Gedächtnis“, freut sich Maria und umarmt Ramah. „Wie schön, dass ihr da seid!“
„Schön, dich wiederzusehen, Maria“, begrüßt Thomas sie und verneigt sich.
Kafni räuspert sich.
„Das ist Ramahs Vater Kafni.“
Maria lächelt ihn an, doch er ignoriert sie und betritt den Innenhof.
„Entschuldigung“, formt Thomas mit den Lippen.
Kafni schaut sich genau um und mustert Matthäus, grüßt ihn aber nicht. „Wo sind denn alle?“, erkundigt sich Ramah, nachdem sie eingetreten sind.
„Sie suchen Jesus“, erklärt Maria.
„Hat er sich verlaufen?“, fragt Thomas.
„Er verläuft sich nie“, entgegnet sie. „Vielleicht brauchte er nur eine Pause. Die Leute aus der Stadt belagern ihn regelrecht. Er hat viele Herzen berührt.“
„Das glaube ich gern“, erwidert Thomas. „Dein Freund wollte sicher nicht unhöflich sein.“
Maria übernimmt die Vorstellung.
„Ihr habt an eine fremde Tür geklopft“, beschwert sich Matthäus, „und als der Bewohner öffnete, hast du gesagt: ‚Dich kenne ich nicht.‘ Ist das etwa höflich?“
Thomas zeigt sich betroffen. „Unsere Reise war anstrengend“, versucht er schließlich zu erklären. „Es war nicht leicht, euch zu finden. Und erst die Samariter! Du meine Güte! Ich dachte, die bringen uns um.“
„Samariter und Juden sind seit jeher Feinde“, merkt Matthäus an.
„Das ist mir bekannt“, erwidert Thomas gleichmütig. „Wir wussten, dass die Reise anstrengend wird, aber man kann beinahe den Eindruck gewinnen, dass es Jesus einem bewusst schwer macht, ihm zu folgen.“
„Ich bin nur gekommen“, wirft Kafni ein, „um ihm zu danken, dass er den Ruf meines Weinbergs – und eures Geschäfts – gerettet hat. Nicht dass ihr großen Wert darauf legen würdet.“
Thomas wendet sich an Matthäus und Maria. „Ich bin froh, dass wir euch endlich gefunden haben. Aber warum seid ihr nicht …“
„Draußen und auf der Suche nach ihm?“, unterbricht ihn Matthäus. „Ich bin hiergeblieben. Es ist am wahrscheinlichsten, dass er hierher zurückkommt.“
„… nicht weiter außerhalb der Stadt untergekommen, wollte ich sagen. Worauf stützt du die Annahme, dass er dorthin zurückkommt, wo man ihn zuletzt gesehen hat? Ist es nicht wahrscheinlicher, dass er zu seiner nächsten Verabredung geht?“
„Er hat keinen Terminplan.“
„Oh!“, kommentiert Thomas. „Vielleicht könnte ich ihm bei der Planung helfen. Ich kann gut mit Zahlen umgehen und organisieren.“ Sein Blick wandert zu Ramah. Sie nickt. „Präzision ist meine Stärke.“
Matthäus will seine eigenen Vorzüge anpreisen, doch in diesem Augenblick treffen der große Jakobus und Johannes ein, schmutzig von Kopf bis Fuß. Ihre Gewänder sind durchgeschwitzt. „Ah, ihr habt es geschafft!“, freut sich Jakobus und reicht Thomas die Hand.
„Schön, euch wiederzusehen“, begrüßt ihn Johannes, während er ihm ebenfalls die Hand schüttelt.
Thomas zuckt zusammen und starrt auf seine Hand.
„Oh, das tut mir leid“, entschuldigt sich Johannes. „Es war ein langer Tag.“
„Wir haben auf dem Feld gearbeitet“, erklärt Jakobus.
•••
Mittlerweile ist Jesus auf den Marktplatz zurückgekehrt und sofort wieder von einer Menschentraube umringt. Einige haben sich Stühle mitgebracht, andere schlendern über die Laufplanken. Von einem kleinen überdachten Verkaufsstand aus beobachtet Neriah, Photinas fünfter Ehemann, die Vorgänge. Bevor sie Jesus am Brunnen begegnete, wollte sie sich von ihm scheiden lassen, um einen neuen Liebhaber zu heiraten.
„Denn wir wissen“, führt Jesus gerade aus, „dass Gott sich mehr um die Kranken sorgt als um die Gesunden. Seht es doch einmal so – gibt es vielleicht Schafhirten unter euch?“
Ein langhaariger junger Mann mit einem Stab meldet sich. „Hier.“
„Ah!“, erwidert Jesus. „Es ist eine Ehre, dich hier zu haben. Hirten haben einen besonderen Platz in meinem Herzen.“
Jakobus der Kleinere kommt humpelnd an. Auf der anderen Seite des Marktplatzes treffen völlig außer Atem Simon und Andreas zusammen mit Thaddäus ein. Simon ist sichtlich erleichtert.
„Wer kümmert sich gerade um deine Herde?“, fragt Jesus den jungen Hirten.
„Mein Bruder. Wir wechseln uns ab.“
„Wie viele Schafe?“
„Einhundert, Meister.“
„Nehmen wir an, eines hätte sich verirrt. Was tust du?“
„Ich würde natürlich nach ihm suchen.“
„Natürlich! Aber was ist mit den anderen neunundneunzig?“
„Ich müsste sie zurücklassen. Ich darf das eine Schaf nicht verlieren.“
„Hmm. Und wenn du es findest?“
Der junge Mann strahlt ihn an. „Ich würde es mir über die Schultern legen und nach Hause tragen. Und ich würde vor Freude tanzen!“
Jesus lacht. „Und was würdest du deinen Freunden sagen, die sich Sorgen um dich gemacht haben?“
„Ich würde ihnen sagen: ‚Los, freut euch mit, denn ich habe mein verlorenes Schaf gefunden.‘“
Jesus wendet sich der Menschenmenge zu. „Habt ihr das gerade gehört? Er freut sich mehr über das eine Schaf, das er wiedergefunden hat, als über die neunundneunzig, die nicht verloren gegangen sind. Genauso will auch mein Vater nicht, dass nur ein Mensch verloren geht. Und deshalb sage ich euch: Im Himmel freut man sich mehr über einen Sünder, der sich finden lässt, als über die neunundneunzig, die denken, dass sie keine Umkehr nötig haben.“
Die Menge hängt an Jesus’ Lippen und hört so aufmerksam zu, dass Simon ganz fasziniert ist. „Schau sie dir an …“, flüstert Andreas.
„Ja“, gibt Simon zurück. „So gebannt, wie sie zuhören, kann man Juden nicht von Samaritern unterscheiden.“
•••
Langsam legt sich die Abenddämmerung über das Land, und Melech, der Besitzer des Feldes, das der große Jakobus und Johannes tagsüber unter Einsatz aller Kräfte gepflügt haben, schickt sich an, aus dem Haus zu gehen. Er müsse sein schlimmes Bein bewegen, sagt er zu seiner Frau und seiner siebenjährigen Tochter. „Wohin willst du?“, will seine Frau wissen.
„Ich gehe nur kurz mal über den Acker, Chedva“, erklärt er und macht sich von ihrem einfachen Haus auf seinen selbst gezimmerten Krücken auf den Weg.
„Schaffst du das denn allein, Vater?“
„Das geht schon, Rebekka. Ich gehe langsam.“
Überwältigt von Scham über seine Armut und darüber, dass er im Augenblick nicht in der Lage ist, die Situation irgendwie zu verändern, humpelt Melech in kleinen Schritten los. Sein Bein hat er mit einer provisorischen Schiene aus Holz und Leder geschient, die er und seine Frau hergestellt haben. Er fühlt sich so hilflos und wertlos und fragt sich, ob sich so wohl das Ende anfühlt. Wie Chedva in den nächsten Tagen etwas Essbares auf den Tisch bringen will, weiß er nicht. Bestimmt hat ihr dürftiges Abendessen heute ihre letzten Vorräte an Mehl und anderen Grundnahrungsmitteln bereits aufgebraucht. Ohne mich wären sie besser dran.
Aber was ist denn das? Im schwindenden Licht des Tages traut er seinen Augen kaum. Das Stück Land, das brachlag, ohne auch nur den Schimmer einer Hoffnung, dass irgendetwas dort wachsen könnte, sieht ganz anders aus als am Tag zuvor, als er sich noch gefragt hat, ob er es wagen könnte, eine Hilfskraft zu bitten, es zu bestellen. Denn bezahlen könnte er erst, wenn die Ernte eingebracht wäre. Blinzelnd humpelt Melech näher.
Das ergibt keinen Sinn für ihn! Was vorher ein karger Streifen ausgedörrtes Land gewesen war, liegt nun vor ihm mit feuchter, schwarzer Erde, die fachmännisch gepflügt wurde. Ungläubig geht er noch ein Stück näher heran. Irrt er sich, oder ist auf dem Acker sogar schon ausgesät worden? Wer tut denn so etwas?
Sein Blick richtet sich zum Himmel. Womit habe ich das verdient? Nein, ich habe es nicht verdient. Ganz und gar nicht! Ihm kommen die Tränen. Soll er es wagen, Frau und Tochter davon zu erzählen? Nein. Vielleicht stellt sich das alles ja als ein grausamer Traum heraus?
•••
Herberge in Sychar
In unbehaglichem Schweigen sitzen Thomas, Ramah und ihr Vater an einem Tisch im Vorraum und nippen an ihren Wasserbechern, als Jesus und einige seiner Schüler eintreffen, ganz erfüllt von den Eindrücken des langen Tages und begeistert darüber, was sie erlebt haben. „Habt ihr die Frau mit ihrem kleinen Mädchen gesehen?“
„Simon auf jeden Fall“, antwortet Jakobus der Kleinere.
Simon zuckt die Achseln. „Ich bin eben nah am Wasser gebaut.“
„Ich auch“, erklärt Andreas. „Man denkt, man ist es nicht, und dann …“
Die drei am Tisch erheben sich. „Shalom!“, ruft Thomas.
„So, du hast es wirklich geschafft!“, begrüßt Simon sie. „Willkommen.“
„Aber sicher doch“, sagt Jesus lächelnd. Er geht auf Thomas zu und umarmt ihn. „Es freut mich sehr.“
„Mich auch, Rabbi. Erinnerst du dich noch an Ramah?“
„Wie könnte ich sie vergessen? Dann willst du dich uns also auch anschließen?“
Sie zögert. „Nun, Rabbi, das ist mein Vater Kafni.“
„Ach ja, der Mann mit dem Weinberg, der so guten Wein für meine Freunde geliefert hat! Shalom.“
Kafni fällt es sichtlich schwer, herzlich zu bleiben. „Danke für die lobenden Worte.“
„Ich nehme an, du willst mit mir sprechen, ja?“
„Wenn es die Zeit erlaubt, nun, dann würde ich dir gern ein paar Fragen stellen.“
„Welcher gute Vater würde das nicht wollen? Ich möchte Folgendes vorschlagen, wenn du einverstanden bist. Wir sind beide sehr erschöpft, nicht? In diesem Haus gibt es genügend Zimmer, und deshalb sollten wir uns jetzt erst einmal ausruhen. Und morgen früh werden wir uns unterhalten. Wie klingt das?“
„Ich … ich … ich denke, das wäre möglich.“
„Dann ist das abgemacht“, bestimmt Jesus. „Ich danke dir.“ Er legt Kafni eine Hand auf die Schulter, und der Mann erstarrt. „Wir freuen uns, dass ihr bei uns seid. Wenn ihr mich jetzt für den Augenblick entschuldigt, ich muss mit ein paar Männern reden, die heute wirklich ganz ausgezeichnete Arbeit geleistet haben.“
Simon tritt vor. „Wir begleiten dich, Rabbi.“
Jesus sieht aus, als müsse er ein Lächeln unterdrücken. „Wenn ihr meint.“ Er tritt durch einen Vorhang in die Küche, Simon, Andreas, Jakobus der Kleinere und Thaddäus auf seinen Fersen. Dort treffen sie Johannes und den großen Jakobus an. Verschwitzt und schmutzig sitzen sie am Tisch und schaufeln Essen in sich hinein. Überrascht blicken sie auf.
„Da sind wir schon“, erklärt Jesus.
„Was ist los?“, fragt der große Jakobus mit vollem Mund.
„Ich habe allen erzählt, was für großartige Arbeit ihr heute geleistet habt. Ihr müsst am Verhungern sein.“
„Äh, ja, ähm“, erwidert Johannes ein wenig verlegen. „Wir hatten tatsächlich Hunger.“
Jesus lacht. „Stärkt euch ruhig. Kommt wieder zu Kräften, und danach beschreibt den anderen bitte, was ihr getan habt. Ich hoffe, alle wissen zu schätzen, was Johannes und der große Jakobus heute getan haben. Gute Nacht, Freunde.“
Auf dem Weg nach draußen und außer Hörweite der anderen schlägt Jesus Simon auf die Schulter. Seufzend wandert Simons Blick zu Andreas. Diese beiden haben schon wieder eine Sonderstellung zuerkannt bekommen. Die Brüder heben ihre Becher und bemühen sich um einen Ausdruck demütigen Stolzes, als wollten sie Simon sagen: „Genau. Hast du gehört?“
Aber es ist tatsächlich das Letzte, was Simon hören will. Die Wahrheit ist – und das weiß er: Vermutlich wird es nie so weit kommen, dass er das hören will.
Kapitel 4
DER AUFTRAG
Sychar, am nächsten Morgen
Jesus hat Johannes und dem großen Jakobus eine neue Aufgabe zugewiesen und sie gebeten, den Rest der Gruppe mitzunehmen. Simon, der ein wenig verschnupft darüber ist, dass er nicht weiß, was los ist, und dass er nicht das Sagen hat, findet sich inmitten der anderen wieder, die den beiden Brüdern durch Gassen und enge Straßen und Steintreppen hinauf und hinunter durch die Stadt folgen.
„Wohin gehen wir?“, erkundigt sich Matthäus bei Andreas.
„Ich weiß auch nicht mehr als du. Jesus hat ihnen einen Auftrag gegeben, und wir sollen sie begleiten. Ich verstehe es auch nicht.“
„Sie haben was von Pflügen und Steine bewegen gesagt. Sind sie jetzt die Anführer?“
„Keine Ahnung“, erwidert Andreas lächelnd. „Es klang jetzt nicht viel schwerer als Fischen, aber …“
„Ich habe noch nie körperlich gearbeitet“, gesteht Matthäus und erntet einen fassungslosen Blick von Andreas, der sich so etwas kaum vorstellen kann. „Ich denke, wir müssen ihnen wohl einfach folgen.“
„Die Liste der Dinge, die er tun könnte, ist lang“, sagt Simon zu Thomas. „Zuerst wäre da die Leprakolonie im Westen. Sie haben ihn gebeten, zu ihnen zu kommen.“
Maria, die hinter Simon geht, erläutert: „Sie dürfen ja die Stadt nicht betreten, also haben sie keine Gelegenheit, ihn zu hören.“
„Das Gesetz schreibt vor, vier Ellen Abstand zu den Leprakranken zu halten“, führt Andreas aus. „Und das gilt für Juden und Samariter gleichermaßen.“
Der große Jakobus, der zusammen mit Johannes die Gruppe anführt, dreht sich zu ihnen um. „Und welchen Abstand müssen wir dann zu den Samaritern halten?“
„Wir sind auch schon dichter an Leprakranken gewesen, Andreas“, entgegnet Johannes.
„Ich sage ja nur, dass es eventuell Probleme geben könnte, wenn er gegen das Gesetz verstößt.“
„Und heute Abend“, teilt Simon Thomas mit, „sind wir beim Stadtkämmerer eingeladen. Zeitgleich haben wir aber auch noch eine Einladung zum Abendessen im Haus des Hohepriesters von Sychar. Das könnte schwierig werden.“
„Wieso?“, fragt Matthäus, der sich auf dem Weg durch die geschäftige Stadt ein Tuch vor den Mund hält.
„Der Glaube der Samariter und der der Juden unterscheiden sich stark“, erklärt Andreas. „Er könnte versuchen, ihm die Worte im Mund umzudrehen.“
„Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus davor Angst hat“, hält der große Jakobus dagegen.
„Ich meine ja nur …“
Maria wirft Ramah einen vielsagenden Blick zu. „Wir könnten woanders hingehen“, schlägt sie vor, „wo die Menschen ihm wirklich zuhören wollen, statt sich über seine Worte zu streiten.“
„Wenn er den Priester dort überzeugt“, gibt Matthäus zu bedenken, „würde seine Botschaft auch dann noch weitergegeben, wenn wir schon lange wieder weg sind.“
„Überlassen wir das doch dem Meister, ja?“, wiegelt Simon ab. Er wendet sich an Thomas. „Was denkst du? Abendessen beim Kämmerer oder beim Hohepriester?“
„Weder noch!“, erwidert Johannes bestimmt.
„Aber mit wem dann?“, beharrt Thomas.
„Du weißt doch“, antwortet Simon, „es gibt genug Leute, die mit ihm sprechen wollen.“
„Ja, aber“, wendet Johannes ein und dreht sich zu den anderen um, „er will das Abendessen ausrichten.“
„Das ist der Auftrag“, erklärt der große Jakobus, als sich die anderen um ihn sammeln.
„Ach ja?“, erkundigt sich Simon amüsiert und verschränkt die Arme vor der Brust. „Das ist der Auftrag? Und ihr zwei genießt das richtig, dass ihr Bescheid wisst und die anderen nicht, ja?“
„Pah!“, hält Johannes dagegen und zeigt mit dem Finger auf ihn. „Das musst du gerade sagen, Simon.“
„Was soll das heißen?“
„Er hat uns über seine Pläne informiert“, erwidert der große Jakobus, „also, Matthäus, verteil das Geld entsprechend. Thaddäus, besorg Brot für zwölf …“
„Dreizehn“, korrigiert Johannes.
„Dreizehn Leute.“
„Gesäuert?“, fragt Thaddäus. „Ungesäuert, Roggen, Dinkel?“
„Eine Auswahl, was immer du willst“, erwidert Johannes. „Du kannst entscheiden.“
Matthäus reicht ihm die Münzen. „Dreizehn“, hakt Simon nach. „Wer sind die anderen?“
„Jakobus“, richtet sich Jakobus an seinen kleineren Namensvetter, „kauf eine Lammkeule mit Haxe und Endstück – nein, zwei Lammkeulen.“
„Wir haben nur …“, gibt Matthäus zu bedenken.
„Andreas! Trauben, Johannisbeeren, Kirschen, wenn es die gibt.“
„Wenn das so weitergeht“, beharrt Matthäus, „haben wir nicht mehr genug für …“
„Zu Beginn dieser Reise“, fällt Johannes ihm ins Wort, „hat auch niemand erwartet, dass wir einen Sack voll Gold finden, nicht wahr? Wir setzen es sinnvoll ein! Simon …“
„Sehr wohl, Meister“, erwidert der mit triefendem Sarkasmus, sodass Johannes innehält.
„… drei Schläuche Wein.“
Simon ist versucht, eine scharfe Erwiderung zu geben, schluckt sie aber hinunter. „In Ordnung.“
Matthäus reicht ihm einige Münzen, aber Simon zögert, bevor er sie entgegennimmt. Dass er jetzt einmal von Matthäus Geld bekommt? Er kann immer noch nicht begreifen, warum Jesus diesen Mann unbedingt dabeihaben will.
„Matthäus, schwarzer Pfeffer, Schnittlauch, Salz, Olivenöl.“
„Bei solchen Ausgaben“, wendet Matthäus ein, „werden wir es nie nach Judäa schaffen.“
„Hab Vertrauen, Matthäus“, macht Johannes ihm Mut. „In ihn. Maria, du kaufst Lauch, Knoblauch und Zwiebeln, in Ordnung?“
Die anderen ziehen los, um ihre Besorgungen zu machen, doch Simon bleibt zurück. „Und was macht ihr beide inzwischen?“
„Wir halten uns von den Straßen fern“, erwidert Johannes.
„Warum?“
„Wegen Samarias größtem Problem …“
Der große Jakobus führt Johannes’ Gedanken zu Ende. „… zu viele Samariter.“
•••
Simon steuert den Stand einer Weinverkäuferin an und verlangt drei Schläuche Wein.
„Welche Sorte?“, fragt sie.
„Roten? Etwas mit Nelkenaroma, denke ich“, sagt Simon.
„Simon!“
Als er sich umdreht, sieht er Photina auf sich zukommen. „Da bist du ja!“, begrüßt sie ihn. „Ich habe schon überall nach euch gesucht!“
„Du hast Glück, wir sind alle hier auf dem Markt.“
„Und was tut ihr? Wird er hier sprechen?“
„Wir kaufen ein, ist es zu glauben?“
Sie wendet sich zu der Weinverkäuferin um. „Dieser Mann, er hat mir …“
„Er hat dir alles gesagt, was du getan hast, ja, wir haben ihn auch schon gehört. Und wegen dem, was er gesagt hat, glauben wir, dass er der Gesalbte ist. Du muss das uns nicht immerzu wiederholen, Photina.“
Verlegen, als könnte sie gar nicht anders, zuckt Photina die Achseln.
Die Weinverkäuferin reicht Simon seine drei Weinschläuche und greift nach einem vierten. „Nein“, wehrt er ab, „ich brauche nur drei.“
„Der geht aufs Haus“, erklärt sie. „Ein Geschenk für ihn.“
„Simon“, beginnt Photina, „ich habe hier eine Nachricht.“ Leise lachend reicht sie ihm eine kleine Schriftrolle und drängt ihn, sie zu lesen.
Es ist eine Einladung zum Abendessen bei ihr und ihrem Mann Neriah. Sie strahlt.
„Alle?“, fragt Simon.
„Ja.“ Sie ist den Tränen nahe.
„Aber wir sind zehn Personen.“
Sie schüttelt den Kopf, als sei das ohne Bedeutung. „Bitte!“
Kapitel 5
EHRLICHKEIT
Später am selben Vormittag
Im Küchenbereich des Gasthauses sitzt Kafni allein am Fenster und betrachtet mit wachsendem Unmut die Schatten draußen. Schon bald muss er sich auf den Heimweg machen. Er fühlt sich von dem Wanderprediger unhöflich behandelt. Der Mann hatte ihm versprochen, am Morgen mit ihm zu sprechen, auch wenn Kafni zugeben muss, dass sie keinen genauen Zeitpunkt vereinbart hatten.
Seine Tochter ist früh mit den anderen und der Anhängerschar des sogenannten Rabbis aufgebrochen in Richtung Stadtzentrum, um irgendwelche Besorgungen zu machen. Und so wartet er, und obwohl er hungrig ist, schenkt er dem Brot und der Schale mit Früchten keine Beachtung. Er hat etwas Wichtiges zu tun, und das ist nicht Essen. Seit dem Tag ihrer Geburt ist Ramah sein Herzblatt, und auch wenn sie jetzt schon volljährig ist, fühlt er sich immer noch für sie verantwortlich. Sie liebt Thomas, das ist nicht zu übersehen, und sie fühlt sich offensichtlich auch hingezogen zu diesem gefeierten Propheten. Kafni kann nicht sagen, was ihn mehr beunruhigt. Thomas kennt er und bewundert ihn in mancher Hinsicht sogar. Aber Thomas ist fest entschlossen, sich diesem Jesus anzuschließen. Warum konnte der junge Mann nicht zu Hause bleiben und für Ramah und sich eine konventionelle Zukunft planen?
Kafni kann nicht aufbrechen, darf es nicht, bevor er nicht getan hat, weswegen er hergekommen ist, aber es hält ihn kaum noch auf seinem Schemel. Er hätte schon längst unterwegs sein sollen, und doch sitzt er immer noch untätig und vor Wut schäumend hier herum.
Endlich taucht Ramah auf. Er ist erleichtert, und dieser Jesus täte jetzt gut daran, ebenfalls zu erscheinen. Normalerweise hätte er sich bei ihrem Eintreten erhoben, aber heute bleibt er einfach sitzen und blickt sie erwartungsvoll an.
„Verzeih, Vater“, entschuldigt sie sich. „Es war ein erlebnisreicher Morgen. Ich mache dir Haferbrei.“
„Was macht er eigentlich die ganze Zeit?“, fragt Kafni, während sie sich an die Arbeit macht. „Ich will doch nur kurz mit ihm sprechen.“
„Er sagte, es sei nur ein kurzer Gang. Ich bin sicher, dass er gleich da ist, Vater.“
Kafni erhebt die Stimme. „Ich muss ihm ein paar Dinge sagen. Du hast Glück, dass ich mitgekommen bin. Ich hätte auch Nein sagen können. Ich kann nicht für Thomas entscheiden, soll er eben leichtsinnig sein, aber du … Ich will mit ihm reden.“
„Ich weiß“, erwidert sie, während sie die Zutaten zusammenmischt. „Ich bin dir sehr dankbar.“
Er mustert sie. „Haferbrei“, sagt er leichthin. „Bald wirst du jede Weise kennen, ihn zuzubereiten, denn das ist alles, was du zukünftig essen wirst, wenn du keine Arbeit hast und deine Familie verlässt.“
Sie zieht die Augenbraue in die Höhe, als wollte sie etwas erwidern, doch in diesem Augenblick tritt Jesus durch die Tür. „Kafni, guten Morgen. Danke für deine Geduld.“
Kafni erhebt sich alles andere als geduldig.
„Ich musste vor unserem wichtigen Gespräch noch ein paar Leute treffen“, fährt Jesus fort. „Hattest du es bequem letzte Nacht?“
Was kann er antworten? „Ja. Obwohl ich sagen muss, dass ich nicht gut geschlafen habe.“ Er wirft seiner Tochter einen Blick zu.
„Mhmh. Ich weiß, wie es ist, wenn man sich um jemanden sorgt, für den man sich verantwortlich fühlt. Ich bin kein Vater. Aber ich kann mir vorstellen, dass all das hier dich beunruhigt.“
Kafni würde dieses Gespräch lieber unter vier Augen führen. Er deutet zur Tür. „Könnten wir …?“
„Sicher.“ Und nach einem beruhigenden Blick in Ramahs Richtung geht er mit Kafni hinaus auf die Gasse.
„Erlaube mir zunächst, dir zu sagen, warum ich hier bin“, beginnt der ältere Mann. „Ich möchte dir danken für das, was du auf der Hochzeit getan hast. Du hast den Ruf meines Unternehmens gerettet und ebenso den meiner Tochter und den von Thomas. Ramah und Thomas beharren darauf, dass du ein Wunder getan hast. Nun gut. Ich bin ein alter Mann. Ich muss bald wieder zurück und habe nicht viel übrig für Unklarheiten. Darum will ich offen sein. Das alles hört sich an wie Blasphemie, und es widerstrebt mir zu glauben, dass ein Mann aus Naza…, also, dass ein Mensch ein Wunder vollbracht haben soll. Und es widerstrebt mir, meiner Tochter meinen Segen dafür zu geben, dass sie uns verlässt. Aber ich stehe in deiner Schuld, und aus diesem Grund sind wir jetzt hier.“
„Danke für deine Ehrlichkeit.“
„Ich kann dir weder meinen Glauben noch meine Ergebenheit schenken“, fährt Kafni fort, „und das Einzige, was ich noch habe, nachdem meine Tochter gegangen ist, ist meine Ehrlichkeit.“ Seine Stimme beginnt zu zittern, und er wendet den Blick ab.
Jesus nickt, und auch ihm steigen Tränen in die Augen. „Ich verstehe. Ich verlange viel von denen, die mir nachfolgen, doch ich verlange wenig von denen, die es nicht tun.“
Kafni ringt um Fassung. „Ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe alles gesagt, was ich zu sagen hatte.“
Er dreht sich um. Ramah hat in einiger Entfernung gewartet, und er drückt ihr einen kleinen Beutel mit Münzen in die Hand. Sie will ablehnen, aber er lässt sich nicht abweisen. Kafni nimmt ihre Hände, drückt seine Stirn an ihre und umfasst ihre Schultern. Schließlich löst er sich von ihr und nimmt sein Bündel und seinen Wanderstab auf.
Ramah folgt ihm nach draußen zum Vorplatz, wo Thomas den Esel des Mannes bereits bepackt hat. Kafni legt noch sein Bündel dazu, dann blickt er Thomas ins Gesicht. „Ich habe dich immer für deine harte Arbeit geschätzt“, sagt er zu dem jungen Mann. „Und obwohl dein Vater starb, hast du dich gut gemacht. Aber das hier ist purer Wahnsinn, und das wisst ihr auch. Wir sehen uns wieder, wenn du um die Hand meiner Tochter anhältst.“
Thomas schüttelt den Kopf. „Kafni, ich …“
„Nein, so naiv bin ich nicht. Du vielleicht schon“, fügt er lächelnd hinzu, „aber ich nicht. Und wenn dieser Tag kommt, weiß ich nicht, was ich antworten werde.“ Von Gefühlen überwältigt, hält er inne. „Pass gut auf sie auf.“
Thomas nickt.
„Shalom“, sagt Kafni zum Abschied und zerrt den Esel an Thomas und Ramah vorbei, die ihm sehnsüchtig nachschaut und sich dann zu Thomas umwendet, während die Tränen ihr über die Wangen rinnen.
Kapitel 6
DER SCHLECHTE SAMARITER
Stadtrand von Sychar, Dämmerung
Auch wenn Simon seine Frau Eden, die in Kapernaum geblieben ist, schmerzlich vermisst, worauf er sehr gut verzichten kann, ist das Fischen – zumindest auf das Fischen von Fischen. Das war eine endlose, knochenharte und überaus geruchsintensive Arbeit. Und egal wie geschickt und erfahren er war, der Erfolg war immer abhängig von den Launen der Natur.
Jesus hat versprochen, ihn zu einem Menschenfischer zu machen, und er kann nicht leugnen, dass dieses Abenteuer die Erfüllung seiner kühnsten Träume ist – und weit mehr. Oh, sicher, es war nicht immer einfach, und dieser Ausflug nach Samaria setzt ihm gewaltig zu.
Mit gemischten Gefühlen begleitet Simon den Rabbi, seine Schüler, Maria aus Magdala und Ramah zu dem Stück Land, das die Brüder Johannes und Jakobus am Tag zuvor gepflügt haben. Auf der einen Seite gehen ihm die Worte Jesu, die er auf dem Marktplatz zu den Menschen gesprochen hat, immer noch nach. Geschickt hatte er einen Hirten aus der Gegend mit einbezogen. An dem Beispiel von einem verirrten Schaf hatte er deutlich gemacht, dass ein verlorener Sünder Gott genauso viel bedeutet wie einem Hirten ein verlorenes Schaf. Brillant. Aber auf der anderen Seite kann Simon sich mit einigen Dingen nur schwer abfinden. Zum Beispiel, warum es den Anschein hat, dass Jesus Jakobus den Größeren und Johannes bevorzugt, wo Simon selbst doch mit ganzer Hingabe der Sache dient, mehr als alle anderen. Und dann die Unbekümmertheit, mit der Jesus einen dreckigen Hund an seiner Seite akzeptiert – diesen Steuereintreiber Matthäus.
Sicher, Matthäus hat alle, nicht nur die Römer, in Erstaunen versetzt, als er, ohne zu zögern, sein Luxusleben aufgegeben hat. Irgendwie schien er Jesus als jemanden erkannt zu haben, der seiner Liebe würdig ist. Aber hat dieser Mann wirklich bereut, dass er seine jüdischen Brüder so abscheulich behandelt und sich mit den Römern zusammengetan hat, um auch den kleinsten Bereich ihres Lebens mit Steuern zu belegen? Wie konnte ein Mann, der sein eigenes Volk wie Abschaum behandelt hat, um sich selbst die Taschen zu füllen, sich überhaupt noch einen Juden nennen?
Trotzdem, Jesus muss es ja wissen. Simon hegt nicht den leisesten Zweifel daran, dass er der Messias ist, darum hofft er darauf, dass bald alles klar werden wird und dass auch Matthäus zur Rechenschaft gezogen wird. Ist das vielleicht Heuchelei? Nein, bestimmt nicht. Er weiß ja, wer er selbst war und was er getan hat. Voller Scham ist er vor Jesus auf die Knie gefallen und hat ihn angefleht: „Geh fort von mir! Ich bin ein sündiger Mensch!“