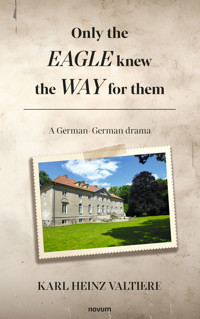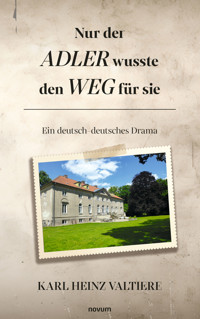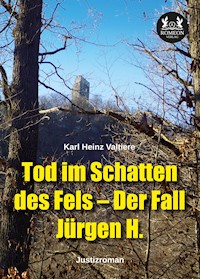
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Romeon-Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 1957 wurde ein achtjähriger Junge Opfer des seitdem so genannten Drachenfelsmörders. 60 Jahre später bringt ein erfahrener Kriminalist in seinem Ruhestand Licht in das Dunkel des ungeklärten Mordfalls und des sorgfältig gehüteten Ergebnisses der polizeilichen Ermittlungen. Die Schilderung des Kriminalfalls und der Recherchen zur Arbeit der Strafverfolgungsbehörden beruht in Gänze auf Tatsachen. Die maßgeblichen Dokumente sind in Originalfassung abgedruckt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tod im Schatten des Fels – Der Fall Jürgen H.
1. Auflage, erschienen 3-2023
Umschlaggestaltung: Romeon Verlag
Autor: Karl Heinz Valtiere
Layout: Romeon Verlag
Karten: openstreetmap.org
ISBN: 978-3-96229-655-1
www.romeon-verlag.de
Copyright © Romeon Verlag, Jüchen
Das Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung und Vervielfältigung des Werkes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks und der Übersetzung, sind dem Verlag vorbehalten. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Verlages darf das Werk, auch nicht Teile daraus, weder reproduziert, übertragen noch kopiert werden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle im Buch enthaltenen Angaben, Ergebnisse usw. wurden vom Autor nach bestem Gewissen erstellt. Sie erfolgen ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Verlages. Er übernimmt deshalb keinerlei Verantwortung und Haftung für etwa vorhandene Unrichtigkeiten.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de/opac.htm abrufbar.
Tod im Schatten des Fels –
Der Fall Jürgen H.
Justizroman
von Karl Heinz Valtiere
Inhalt
1. Kapitel Rhöndorf,Frühling 2018
2. Kapitel Bad Honnef,Sommer 2018
3. Kapitel Köln, Winter 1974
4. Kapitel Düsseldorf, Winter 1974
5. Kapitel 44
6. Kapitel Rhöndorf, Herbst 2018
7. Kapitel Rhöndorf, Winter 2018
8. Kapitel Rhöndorf, Sommer 2019
9. Kapitel Rhöndorf, Frühling 2020
10. Kapitel Münster, Herbst 1980
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel 126
15. Kapitel Düsseldorf, Winter 1980
16. Kapitel Rhöndorf, Sommer 2021
17. Kapitel Düsseldorf, Sommer 1983
18. Kapitel Düsseldorf, Herbst 1983
19. Kapitel Kaiserswerth, Frühling 1984
20. Kapitel Rhöndorf, Frühling 2022
21. Kapitel Köln, Frühling 1985
22. Kapitel Düsseldorf, Sommer 1988
23. Kapitel Kaiserswerth, Winter 1989
24. Kapitel 1990 – 2015
25. Kapitel Rhöndorf, Winter 2022/23
26. Kapitel
1. Kapitel Rhöndorf,Frühling 2018
Es war ein strahlend schöner Frühlingstag im April des Jahres 2018, als er sich endlich zu diesem ersten notwendigen Schritt in die Vergangenheit entschloss. Er hatte viel zu lange damit gewartet. Erst die Erkenntnis, dass mit fortschreitendem Alter alles nur noch schwerer wird, hatte ihm den nötigen Schub gegeben, dieses Vorhaben nun als Pflichtaufgabe anzugehen.
Er stellte das Auto auf dem Parkplatz am Ziepchens-Brunnen in Rhöndorf ab und fand sofort wieder den Weg für den Aufstieg zum Drachenfels. Die Ortschaft war so, wie er sie im Gedächtnis hatte, nur noch schöner. Die sorgfältig restaurierten und bemalten alten Fachwerkhäuser strahlten Wohlhabenheit aus, die Bürger fröhliche Weltoffenheit. Der Wohnort des ersten Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland hatte seinen rheinisch-optimistischen Charme der Nachkriegszeit nicht verloren. Wie oft und wie sorglos war er hier allein, mit seinem Vater oder mit Freunden in seiner Kindheit herumgelaufen! Es war die Zeit der 1950er Jahre, als Kinder und Heranwachsende von ihren Eltern allenfalls die Warnung vor Fundmunition mit auf ihre Touren ins Siebengebirge oder an den Rhein bekamen und sich ihre Wege selbst suchen durften.
Nur langsam kam er den kurzen, steilen Anstieg bis zum Ulanendenkmal hinauf; so mühsam hatte er das nicht in Erinnerung. Dafür wurde man hier aber, oberhalb der Bebauungsgrenze von Rhöndorf, mit der weiten Sicht auf das Rheintal und nach Westen hin bis in die Eifel belohnt. Heute Nachmittag lag bei klarem, blauem Himmel ein üppiger Glanz über diesem friedfertigen Landstrich. Er erinnerte sich daran, wie damals Musik von Tanzveranstaltungen aus Restaurants heraufgeschallt war, als die Menschen nach dem Krieg langsam wieder Geselligkeit suchten.
Der Weg schlängelte sich jetzt weniger steil an der Dr. Max-Horster-Hütte vorbei in den Wald, von links stellte sich mehr und mehr das dunkle Felsmassiv des Drachenfels in den Weg. Durch das Buschwerk rechts neben dem Weg konnte er nach Osten hin Teile der Wolkenburg-Felswand erkennen; jetzt musste die Abzweigung nach rechts zum Stürtzplatz und zum Steinbruch kommen. Gespannt musterte er das vor ihm liegende Gelände, aber es war nur die nach links abbiegende Wegrichtung zum letzten Steilhang den Drachenfels hinauf auszumachen. Irritiert ging er den Weg wieder ein Stück hinab und wiederholte langsam den Aufstieg, während er das Buschwerk rechts des Wegs scharf beobachtete. Und da konnte er es sehen: In der Böschung am rechten Wegrand war unter einem Busch eine leichte Delle nach unten sichtbar. Er arbeitete sich durch das Grün und stand in einem kaum noch erkennbaren, vom Weg rechts wegführenden Korridor zwischen Bäumen und Büschen. Vorsichtig folgte er dem überwucherten alten Pfad den Hang nach Osten hinab. Jetzt konnte er durch Bäume und Unterholz auch den Stürtzplatz erkennen, auf dem früher die im Steinbruch herausgehauenen Felsquader gelagert wurden. Diesen Platz hatte man später als Gedenkstätte an den Bonner Geologen Dr. h.c. Bernhard Stürtz gestaltet, der sich Ende des 19. Jahrhunderts erfolgreich für eine Beendigung des Steinbruchbetriebs am Drachenfels eingesetzt hatte. Geröll, Baum- und Wildwuchs überdeckten inzwischen den Platz und nur mit Mühe fand er den alten Gedenkstein. Die Inschrift war noch lesbar: Dem treuen Freunde des Siebengebirges Geologen Bernhard Stürtz, Dr. phil. H.c.. Das früher in den Stein eingebettete Flachrelief seines Kopfes war herausgebrochen. Was war nur geschehen, dass jetzt so unmissverständlich die Zugänglichkeit dieses Orts verhindert und die Erinnerungen hieran dem Verfall überlassen wurden? War es etwa der gleiche Grund, der ihn heute hierhin getrieben hatte, nämlich das abscheuliche, nie gesühnte Verbrechen im Steinbruch?
Langsam bewegte er sich weg vom Stürtzplatz zum nördlich gelegenen Hanggelände, wo sich durch hochragende Felsen hindurch der Zugang zu dem kleinen Steinbruch befand. Das letzte Mal war er hier vor mehr als sechzig Jahren gewesen und noch immer hatte er den Moment vor Augen, als er sich ein halbes Jahr nach der Tat getraut hatte, mit seinem Vater in den engen Felsdurchgang zum Steinbruch hineinzugehen. Die damals noch nackten Felswände und die herumliegenden Bruchsteine waren jetzt großflächig mit Moos, Schlingpflanzen und Unkraut überwachsen; die Natur schaffte es auch hier, dem Ort wieder ein tröstlicheres Antlitz zu geben. Dennoch überkam ihn Beklommenheit, als er hinter dem Felsdurchgang zu dem durch Geröll und Hangabrutschungen kaum noch zugänglichen Abbaugelände hinüberblickte. Kein Vogel war zu sehen, auch die Sonne schien hier schon am Nachmittag nicht mehr. Es herrschte die gleiche unheimliche Stille wie damals, dies war immer noch der verbotene, lebensfeindliche Ort jenseits der weltoffenen, fröhlichen Seite des Drachenfels. Hier war der achtjährige Junge gestorben, von seinem Mörder feige erstochen, nachdem er sich heftig gegen dessen Schläge gewehrt hatte.
Langsam legte sich seine Erregung, als er von dem Ausflug in ihr behagliches Haus aus der Jahrhundertwende, das am Berghang des Frankenwegs in Rhöndorf lag, zurückgekehrt war. Hierhin waren sie vor drei Jahren nach dem Ende ihrer Berufszeit umgezogen. Die Heimat seiner Jugend war für ihn der Fluchtpunkt aus seiner nicht mehr stimmigen Arbeitswelt geworden, in der man von ihm erwartete, Neues möglichst kritiklos zu bejubeln und Bewährtes möglichst widerstandslos abzuschaffen. Als er aus dem Fenster seines kleinen Arbeitszimmers im ersten Stock nach Nordwesten zum Drachenfels hinübersah, musste er daran denken, dass maßgeblich er es gewesen war, der auf diesen Hauskauf gedrängt hatte. Seine Frau bevorzugte stattdessen ein Haus in größerer Nähe zum Ortskern Bad Honnef, um im Alter keine langen Wege in Kauf nehmen zu müssen. Es war der romantische, direkte und unverbaubare Blick auf die Südostseite des Drachenfels, mit dem er sie seinerzeit argumentativ überrollt hatte. Nach dem heutigen Ausflug dorthin musste er sich aber eingestehen, dass ihn bei der Kaufentscheidung wohl weniger der landschaftliche Reiz als sein Unterbewusstsein in die dauerhafte Nähe zum ungelösten Rätsel seiner Jugend gezogen hatte. Er musste diese Sache nun endlich zu Ende bringen, um einen befreienden Schlussstrich zu ziehen; wer weiß, wie lange er das bei diesem über 60 Jahre alten Fall noch konnte.
Als er an seinem Schreibtisch Platz genommen, ein Blatt Papier und einen Bleistift herausgeholt hatte, kehrte das Gefühl der jahrzehntelangen Routine zurück, die er sich beim Angehen vor ihm liegender Problemfelder, gleich welcher Kategorie, erworben hatte. Und so schnell wie früher hatte er als Ergebnis eine Recherche- und Vorgehensliste vor sich. Als Erstes musste er wieder die im Internet verfügbaren Hinweise auf den Fall zusammentragen, auf die er schon in den 1980er Jahren über bestimmte Suchwörter, an die er sich noch genau erinnern konnte, gestoßen war. Erst danach war es sinnvoll, die Print-Medien des hiesigen Gebiets auszuwerten, und als Drittes wollte er den Versuch nicht scheuen, vielleicht noch greifbare, frühere Freunde im Ort über möglicherweise nachträgliche Erkenntnisse zu dem Fall zu befragen. Die über Jahrzehnte angesammelten Fakten und Nachrichten müssten es dann eigentlich erlauben, den genauen Hergang der Tat, die Maßnahmen der Polizei und die erzielten Ermittlungsergebnisse nachzuzeichnen. War dieser Punkt erreicht, konnte er bei seinen Aufklärungsversuchen offensiver werden und den Gründen dafür nachgehen, dass der Täter trotz zahlreicher Hinweise und neuer Techniken bis heute offenbar nicht überführt worden war.
Sofort nach dem Frühstück des folgenden Tags begann er mit der Internet-Recherche, für die er sich den ganzen Tag Zeit nehmen wollte. Mithilfe seiner aufgestellten Reihe von Suchwörtern versuchte er an die Meldungen der Medien und der Polizei zu diesem Fall zu kommen. Doch es war kaum zu glauben – nach Durchsicht zahlloser Seiten, die sich auf seine damals noch weiterführenden Suchwörter geöffnet hatten, erzielte er diesmal keinen Treffer mehr, weder mit dem seinerzeit in der Lokalpresse bekannt gegebenen, vollen Namen des ermordeten Jungen »Jürgen H.«, noch mit den Worten »Jungenmord Drachenfels«, »Mord im Steinbruch Drachenfels«, noch mit anderen Wortkombinationen. So wie beim gestrigen Besuch des Tatorts kam in ihm spontan das Gefühl auf, dass hier Kräfte am Werk waren, die alle Hinweise und Spuren auf dieses ungelöste Verbrechen vernichten, zumindest unterdrücken wollten. Dass der Namen des Mordopfers nicht mehr aufrufbar war, erschien wegen des Persönlichkeitsschutzes noch erklärlich; weshalb aber waren alle weiteren Meldungen gelöscht? Sollten hier etwa zielgerichtet jegliche Hinweise auf das Verbrechen vernichtet worden sein, damit ein unrühmliches Kapitel der Polizeiarbeit –ganz im Sinne des Täters – geschlossen werden konnte? Er würde später diesem Verdacht nachgehen müssen.
2. Kapitel Bad Honnef,Sommer 2018
Das war nun schon das vierte Mal, dass der alte Herr vor der Tür stand. Frau Schmidthofer begrüßte ihn wieder freundlich und führte ihn zu seinem Platz in der Ecke des Redaktionsraumes der Lokalzeitung in Bad Honnef. Heute wollte er die beiden Halbjahresbände 1957 der »Bad Honnefer Volkszeitung« einsehen, nachdem er zuvor schon alle sechs Bände von 1954 bis 1956 durchsucht hatte. Sie begannen, ihn hier zu belächeln, weil dies eine ihnen wohlbekannte Situation war. Ältere Leser glaubten, sich an Berichte oder Meldungen aus grauen Vorzeiten felsenfest zu erinnern, die es dann aber nicht, nicht hier oder nicht zum angegebenen Zeitpunkt gegeben hatte. Doch dieser Herr, der sich als ehemaliger Rechtsanwalt vorgestellt hatte, war besonders hartnäckig geblieben und hatte immer wieder betont, dass er den Jungen, der damals in seiner Nähe gewohnt haben soll, selbst gekannt hätte und dass dieses Verbrechen über Jahrzehnte hinweg ganz Honnef bewegt hätte. Er hatte ihnen Näheres über den Mordfall von 1954 oder später erzählt, was sie in der Redaktion aber nicht interessierte, weil sie wirklich Wichtigeres zu tun hatten. Da es diese Zeitungsjahrgänge nicht in digitalisierter Form gab, war ihm aber die persönliche Einsichtnahme vor Ort gestattet worden.
In seiner Erinnerung hatte der Mord im Herbst oder Winter stattgefunden; deshalb blätterte er stets die Bände von hinten nach vorne durch. Heute saß er nun schon wieder über zwei Stunden hier, ohne fündig zu werden. Inzwischen war er bei den Ausgaben von März und Februar 1957 angekommen, als er plötzlich mit lautem Ausruf »Da ist es!« aufsprang. Es dauerte dann nur noch eine Stunde, bis er sich von allen Meldungen in diesem Zeitraum Notizen gemacht hatte. Jedes Detail seiner Erinnerungen wurde durch die Pressemeldungen bestätigt. Er konnte nicht umhin, Frau Schmidthofer das stolz zu berichten und ihr für ihren Langmut zu danken.
Damit fühlte er endlich Boden unter den Füßen, nachdem er selbst schon Zweifel an seiner Erinnerungsfähigkeit wegen seiner langen Abwesenheit von seiner früheren Heimatstadt bekommen hatte.
Mit neuem Elan konnte er an den folgenden Tagen seine Sammlung der Presseberichte auch aus anderen Zeitungen komplettieren, nachdem jetzt der 20. Februar 1957 als der exakte Zeitpunkt des Verbrechens feststand. Als wenig ergiebig erwiesen sich die Nachfragen bei früheren Freunden und Bekannten über deren Wissensstand zu dem Fall. Er wusste noch genau, wie sich diese im Jahr 1957, als er gerade 12 Jahre alt geworden war, alle maßlos über die Tat aufgeregt hatten. Damals war auf einmal Angst bei den sonst so unternehmungslustigen Jungen eingekehrt und man vermied die Streifzüge durchs Siebengebirge. Heute erinnerten sich einige überhaupt nicht mehr daran, die meisten der übrigen verwechselten den Fall mit ganz anderen Mordfällen, und nur bei einem einzigen waren noch so genaue Kenntnisse des Falls wie bei ihm vorhanden. Dieser versicherte ihm, dass es zumindest in den letzten 30 Jahren keinerlei Neuigkeiten oder neue Polizeimeldungen in dem Fall gegeben habe. Damit konnte er seine Recherchen zur Nachrichtenlage einstweilen abschließen und sich daran machen, aus den vorliegenden Polizeiangaben eine Zusammenfassung zum Tathergang und zu den damaligen Ermittlungsergebnissen zu erstellen. Das sollte dann seine Basis für weitere Aufklärungsversuche zum Fall werden.
Nachrichtenlage zum Mordfall Jürgen H.
Der achtjährige Jürgen H. verließ Mittwoch, den 20. Februar 1957, gegen 14 Uhr die elterliche Wohnung in der Luisenstraße in Bad Honnef. Er schaute erst eine Fernsehsendung bei Nachbarn an, besuchte anschließend seine am Mühlenweg in Rhöndorf wohnende Großmutter und danach seine Tante. Gegen 16.15 Uhr wurde er in der Nähe des damaligen Rheinhotels Bellevue gesehen, wo er mit einem Jungen spielte und gegen 16.30 mit diesem vom Mühlenweg in die Rhöndorfer Straße einbog. Kurz vor 17 Uhr wurde Jürgen letztmals lebend am Ziepchen-Brunnen in Rhöndorf gesichtet; dort forderte er einen anderen Jungen auf, mit ihm spielen zu gehen.
Der Junge wurde zwei Tage später, am Freitag 22. Februar 1957, in dem ehemaligen Steinbruch hinter dem Stürtz-Platz zwischen Drachenfels und Wolkenburg tot aufgefunden. Die Leiche wies tödliche Verletzungen durch Messerstiche an Kopf und Brust, Spuren von Schlägen mit einem stumpfen Gegenstand und fünf bis sechs Narben aus früheren Verletzungen am Rücken auf. Seine linke Faust hielt einige bis zu 17 cm lange, braungraumelierte und kürzlich geschnittene Haare umklammert, die er offenbar dem Täter im Kampf ausgerissen hatte. Die Polizei stellte weiter fest, dass der Täter einen Unfall durch Absturz von einer der Felswände des Steinbruchs hatte vortäuschen wollen; denn die Leiche wurde vom Platz des Mordes an eine unterhalb einer Felssteilwand liegende Stelle verbracht. Am Tatort wurde ein 30 cm langer Hammer gefunden, dessen neuer Metallkopf einige Meter neben dem in einem Gebüsch liegenden, blutverschmierten Holzstiel lag. Mit dem offenbar dem Täter gehörenden Hammer wurden aber nicht die Schläge gegen den Jungen ausgeführt.
Einen Tag später, am Samstag 23. Februar 1957, berichtete die Honnefer Volkszeitung von der Aussage eines 9-jährigen Mädchens, das Jürgen H. mit einem brillentragenden Mann auf der Löwenburgstraße in Rhöndorf, von welcher der Aufstieg zum Drachenfels abgeht, gesehen habe. Die Zeitung relativierte die Aussage mit der Bemerkung, »bekanntlich sind jedoch Kinderaussagen mit Vorsicht zu genießen«. Die Lokalpresse berichtete außerdem von der Aussage der Familie des Mordopfers, dass Jürgen H. sehr misstrauisch gewesen sei und kaum mit einem Fremden mitgegangen wäre.
Zehn Tage nach der Tat berichtete die Lokalpresse von der Beerdigung des Mordopfers auf dem Friedhof in Bad Honnef. Fast 500 Menschen hätten dem Jungen ihr letztes Geleit gegeben.
Zwei Wochen nach der Tat meldete die Polizei die Festnahme eines Tatverdächtigen aus Heidebergen (Bonn-Holzlar), in dessen Wohnung ein Messer aufgefunden wurde, dessen Klinge zu den Stichen am Mordopfer passe. Der festgenommene 43-jährige Mann sei verschiedener Straftaten verdächtig, leugne jedoch hartnäckig. Eine Woche später folgte dann die Meldung, dass dieser Mann freigelassen wurde, weil sich der Verdacht nicht bestätigt habe.
Die Lokalpresse erinnerte außerdem daran, dass sich in diesem Fall gewisse Parallelen zu dem Mord an der 15-jährigen Annemarie Scholten ergäben. Diese war 1951 in einem Steinbruch bei Eudenbach (Siegkreis) aufgefunden worden. Auch damals habe der unbekannte Mörder versucht, das »grausige Geschehen« als Unfall darzustellen.
Am 12. März 1957, also mehr als drei Wochen nach der Tat, gab die Kriminalpolizei bekannt, dass ihr von einem Mann berichtet worden sei, der am Tattag nach 17 Uhr aus Richtung des Burghofs am Drachenfels kommend sich an dem kleinen Springbrunnen an der alten Pumpenstation gegenüber der Drachenburg die Hände gespült und sich dann in auffälliger Hast auf dem abwärts führenden Weg am Schwimmbad vorbei entfernt habe. Dieser Unbekannte sei 1,80 Meter groß, etwa 45 Jahre alt, schlank, bartlos gewesen, habe eine Hornbrille getragen und sei mit einem schwarzgrauen Wintermantel mit aufgesetzten Taschen und mit einer dunklen, feingestreiften Hose, unten umgekrempelt, und mit dunklen Halbschuhen, Größe 42, bekleidet gewesen. Ein dunkelbrauner Filzhut und eine hellbraune Akten- bzw. Kollegtasche hätten die Kleidung vervollständigt.
Zum Wetter am Tattag 20. Februar 1957 berichtete die Lokalpresse, es sei schlecht und die Wege zum Steinbruch seien in schlüpfrigem Zustand gewesen, sodass kaum mit Spaziergängern auf dem Weg zum Steinbruch habe gerechnet werden können.
Als er sich die Fakten des Falls durch den Kopf gehen ließ, konnte er den der Presse gegenüber gezeigten Optimismus der Polizei, den Täter schnell zu überführen, sehr gut nachvollziehen. Hier gab es zahlreiche klare Spuren und sonstige zielführende Ermittlungsansätze. Es gab die Haare des Täters, die in der Hand des Jungen aufgefunden worden waren und schon nach damaligem Stand der Kriminaltechnik aufgrund ihrer Struktur bestimmten Personen zugeordnet werden konnten. Dann gab es den vom Täter zurückgelassenen Hammer, an dem sich möglicherweise auch dessen Fingerabdrücke befanden, zu denen die Polizei wahrscheinlich aus ermittlungstaktischen Gründen nichts der Presse gegenüber bekannt gegeben hatte. Darüber hinaus war davon auszugehen, dass der Täter Blut des Opfers an seiner Kleidung hatte, sodass bei Tatverdächtigen gezielt hiernach gesucht werden konnte. Die Zeugenaussage zu dem am Tattag am Burghof des Drachenfels gesichteten Mann schließlich wies eine Reihe von so charakteristischen Merkmalen auf, dass seine spätere Identifizierung sehr wahrscheinlich war.
Doch es war kein Durchbruch in diesem Fall zu verzeichnen. Noch zwanzig Jahre später berichtete die Polizei von ihren Bemühungen, die aber allesamt im Sande verlaufen waren. So waren bis dahin Spuren auch bis nach Holland verfolgt worden; man war lange Zeit der These nachgegangen, dass sich der Täter unter den damals zahlreichen Besuchern befunden haben könnte, die mit dem Schiff von Holland nach Königswinter gekommen waren. Danach endeten die Polizeimeldungen zu dem Fall, sodass er davon ausgehen konnte, dass es seitdem keine neuen Erkenntnisse der Polizei mehr gegeben hatte. Dies erschien ihm allerdings sehr merkwürdig, denn noch bei seiner polizeilichen Stabsarbeit im aktiven Dienst hatte er die Welle der überraschenden späten Aufklärungserfolge aufgrund der Fortschritte in der DNA-Technik miterlebt. Um hier mit der Aufklärung weiterzukommen, musste er sich deshalb unmittelbar mit der Bonner Polizei in Verbindung setzen. Er spürte, wie sein früherer Beruf ihn wieder einholte.
3. Kapitel Köln, Winter 1974
Hier oben mit dem herrlichen Blick über den Rhein zum Stadtteil Poll hinüber versank ein wenig die lärmende Betriebsamkeit dieser Großstadt unter ihr. Stefanie Steinert genoss die frische, kühle Luft am offenen Fenster des Wohnzimmers ihrer Mietwohnung in einem Altbau am Oberländer Ufer in Köln-Marienburg. Das fahle Licht dieses Novembertags des Jahres 1974 stimmte sie schon zur Mittagszeit auf den Abend ein.
»Jetzt sollten wir aber langsam fahren, Frank, sonst kommen wir in den Stau auf der A3«, rief Stefanie ihrem Mann in seinem Arbeitszimmer nebenan zu, der wieder kein Ende finden konnte. Am Wochenende zu arbeiten, war bei ihm langsam zur Gewohnheit geworden, nachdem er beim Landgericht Düsseldorf einen furiosen Berufsstart hingelegt hatte. Einerseits war sie froh darüber, weil diese Entwicklung ganz im Sinne ihres Vaters war, andererseits bemerkte sie aber schmerzlich den Abbau gemeinsamer Zeiten mit ihrem Mann. Ihre Eltern waren ihrer Klage darüber damit begegnet, dass sie durch dieses Opfer den unverzichtbaren Beitrag für eine außergewöhnliche Richterkarriere ihres Mannes mit besten Zukunftsaussichten für sie beide leiste. Außerdem baue sie als Ärztin ja eine eigene und auch ausfüllende berufliche Existenz auf.
Nachdem Frank sich nun endlich auch umgezogen hatte und sie mit Blumen bewaffnet in ihren VW eingestiegen waren, fand Stefanie zügig den Weg aus dem Zentrum von Köln heraus über die Rheinbrücke auf die Autobahn Richtung Düsseldorf. Ihre Eltern, von denen sie heute wieder eingeladen waren, besaßen eine kleinere Villa in Kaiserswerth am Leuchtenberger Kirchweg in unmittelbarer Rheinnähe. Noch pünktlich kamen sie am Spätnachmittag an und Frau Korbach, der gute Geist im Haushalt ihrer Eltern, führte sie sofort in die Bibliothek, wo man bei Einladungen in kleinerem Rahmen üblicherweise den Aperitif einnahm.
Die Begrüßung fiel heute besonders herzlich aus. Sein Schwiegervater Wilhelm kam spontan auf ihn zu und Frank hatte das Gefühl, dass dieser sonst so formbedachte Mann ihn am liebsten umarmt hätte. »Frank, mein Junge, da seid ihr ja endlich, wir haben Euch viel zu lange nicht gesehen«, rief er ihm zu und begrüßte erst nach ihm seine Tochter, die sich schon Mutter Hildegard zugewandt hatte. Zusammen gingen sie zu den beiden weiteren Gästen, die bereits vor dem Kamin saßen. »Ich brauche Euch ja nicht vorzustellen, Ihr kennt Euch lange genug«, meinte Wilhelm, und sie nahmen Platz neben dessen langjährigem Freund und Bundesbruder Konrad Weigelt mit seiner Frau Claudia. Frank und seine Frau waren von den Schwiegereltern noch nie mit anderen als den Weigelts eingeladen worden, insbesondere nicht mit Berufskollegen Wilhelms. Denn Wilhelm hielt, wie andere hohe Justizbeamte auch, private Kontakte im Kollegenkreis für verpönt, weil durch persönliche Beziehungen die Gefahr einer Belastung für das dienstliche Verhältnis entstehen konnte.
Die ungewöhnlich gute Stimmung seines Schwiegervaters übertrug sich auf die kleine Gesellschaft und sofort wurde das junge Paar über Neuigkeiten ausgefragt. Stefanie berichtete vom Ende ihrer Facharztausbildung und der nachfolgenden, unbefristeten Festanstellung in ihrem Kölner Krankenhaus, wozu ihr das Ehepaar Weigelt, das Stefanie wegen ihrer wohlerzogenen Zurückhaltung sehr mochte, herzlich gratulierte. »Und sonst so gibt es nichts Neues, Steffi?«, fragte Mutter Hildegard in ihrer lebenspraktischen, manchmal aber auch plumpen Art, unter besonderer Betonung des »sonst so«, was die Kategorie der möglichen Neuigkeit andeuten sollte. Alle belächelten die Frage, kommentierten sie aber nicht mehr, weil bekannt war, dass sich Hildegard sehnlichst ein Enkelkind wünschte. Etwas genervt atmete Stefanie hierauf nur tief durch, und Frank war froh, dass Wilhelm ihr durch Themenwechsel zur Hilfe kam. Wie schon bei ihrer Ankunft fiel ihm auf, dass seinen Schwiegervater heute etwas stark bewegte. Er sollte auf der Hut sein, dass sie nicht wieder von ihm, diesem an sich herzensguten Mann überfahren wurden.
Frank kannte Wilhelm von Harlinghusen seit 1970, als er sich auf Drängen von Stefanie endlich zu einem Anstandsbesuch bei ihren Eltern in Kaiserswerth bereit erklärt hatte. Der große, sportliche, schwarzhaarige Frank hatte die schlanke und brünette Stefanie, die nahezu seine Größe erreichte, während seiner Referendarzeit in Köln kennengelernt und wollte, als er gehört hatte, wer ihr Vater war, dem Präsidenten des Oberlandesgerichts Düsseldorf möglichst aus dem Weg gehen. Seine Erfahrungen mit Freundinnen bis dahin hatten ihn gelehrt, dass die Intensität der Kontrolle der Väter über das Leben ihrer Töchter in direkt proportionalem Verhältnis zur gesellschaftlichen Stellung des Vaters stand. Als kleiner Nachwuchsjurist konnte er sich dem wohl kaum entziehen, sodass der freiheitsliebende Frank Probleme auf sie beide zukommen sah. Das Verhältnis zu den Eltern war dann auch anfangs sehr kühl, hatte sich später aber verbessert, als Stefanie ihre Eltern unmissverständlich damit konfrontiert hatte, dass sie diesen und keinen anderen Mann wolle. Allerdings gab es immer wieder Irritationen durch die Einflussversuche der Eltern auf das junge Paar, die Frank mit zunehmender Unterstützung von Stefanie konsequent abwehrte. 1971 hatten sie geheiratet, nachdem er sein Assessorexamen erneut, wie schon das Referendarexamen, mit Spitzennote absolviert hatte. Nach dem Examen hatte er eigentlich erst seine angefangene Dissertation bei einem bekannten Bonner Staatsrechtsprofessor zu Ende bringen und danach in die Richterlaufbahn eintreten wollen. Als er von seinen Plänen der Justizverwaltung seines Kölner Oberlandesgerichts berichtete, machte man ihm aber, um ihn umgehend der Justiz zu sichern, das verlockende Angebot, sofort beim Landgericht Düsseldorf in die Richterlaufbahn einzusteigen; er könne dann ja seine Dissertation neben der Richtertätigkeit weiterführen. Auch Stefanie sprach sich für diese Alternative aus, weil er so eine feste berufliche Verwendung im Kölner Raum hatte und sie hier ihre erste gemeinsame Wohnung beziehen konnten. So hatte er dann die Richterstelle bei der 1. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf angetreten. Von da an konnte man Franks Verhältnis zu seinen Schwiegereltern als normal bezeichnen, nachdem diese verdaut hatten, dass ihre Tochter mit der Trauung den Familiennamen ihres Mannes unter Verzicht auf ihren adligen Geburtsnamen angenommen hatte.
Das Gespräch drehte sich jetzt um die frühere Messerklingenfabrik in Solingen, die Konrad Weigelt vor Kurzem verkauft hatte, weil er sich zur Ruhe setzen wollte. Er und Wilhelm gehörten dem Geburtsjahrgang 1912 an und kannten sich schon seit der Schulzeit. Sie hatten sich auch nicht aus den Augen verloren, als Konrad Maschinenbau in Aachen und Wilhelm Jura in Freiburg und Bonn studierten. Beide heirateten Mitte der 1930er Jahre, fanden nach dem Krieg ihre Heimat im Rheinland wieder, und die Familien pflegten regelmäßigen Kontakt. Wilhelm, der vor dem Krieg Rechtsanwalt war, fand 1946 den Weg in die Justiz, als vom NS unbelastete Juristen für den Neuaufbau der Justiz gesucht wurden. Dort machte er eine beispiellose Karriere. Er begann beim Landgericht Köln, wechselte 1955 zum dortigen Oberlandesgericht und wurde 1965 Vizepräsident, danach Präsident des Oberlandesgerichts Düsseldorf. Als sich 1948 die Ankunft von Stefanie ankündigte, wurde Claudia Weigelt, die kinderlos blieb, von Hildegard als Patentante auserkoren. Dieser Rolle berühmte sich Claudia auch noch, als Stefanie schon längst erwachsen war, weil sie das Mädchen wegen der strengen Eltern oft bedauerte und sich die Position als ihre Fürsprecherin erhalten wollte.
»Übrigens – wir haben noch etwas zu feiern, liebe Claudia, lieber Konrad«, wechselte Wilhelm unvermittelt das Thema, »bei Frank hat sich auch etwas getan. Er ist jetzt vorzeitig zum Landgerichtsrat und Richter auf Lebenszeit ernannt worden. Seine Probezeit wurde abgekürzt wegen seiner beiden vorzüglichen richterlichen Beurteilungen.« Wilhelm strahlte vor Stolz und auch Frank lächelte verbindlich, obwohl ihm derartige Herausstellungen nicht lagen. Er wusste zwar, dass Stefanie ihrer Mutter die Neuigkeit von der Lebenszeit-Ernennung schon vor einer Woche telefonisch mitgeteilt hatte, aber woher kannte sein Schwiegervater die nicht genannten Details zu den Beurteilungen? Er spürte wieder das über ihm wachende Kontrollauge und wurde missmutig, zumal das auktoriale Auftreten Wilhelms etwas den Eindruck vermittelte, als sei er im Hintergrund mitverantwortlicher Lenker des Erfolgs seines Schwiegersohns. Diese Wendung missfiel ihm gründlich.
Mittlerweile hatte Frau Korbach das Essen aufgetragen und man ging ins Esszimmer, das mit großem Fenster zur Rheinseite nach Westen hin angelegt war und eine breite Sicht auf den ruhig und langsam vorbeiziehenden Schiffsverkehr eröffnete. Frank beteiligte sich jetzt nicht mehr an der weiterhin regen Unterhaltung und stocherte etwas lustlos im Essen herum. Die neben ihm sitzende Stefanie merkte sofort, dass etwas nicht stimmte, und versuchte, ihn ins Gespräch zu ziehen.
»Frank, stell Dir vor, meine Eltern haben uns für den Sommerurlaub in ihre Ferienwohnung in Davos eingeladen, ist das nicht toll?«, eröffnete sie ihm.
»Da kann ich jetzt aber noch gar nichts zu sagen, weil ich nicht weiß, wann ich Urlaub nehmen kann«, reagierte Frank hinhaltend.
»Uns steht der ganze Zeitraum der Gerichtsferien von Mitte Juli bis Mitte September zur Disposition, Frank, wir richten uns da voll nach Euch, ich weiß ja, wie eingespannt Du bist«, setzte Wilhelm nach, der Franks Antwort schon hatte kommen sehen und sich argumentativ offensichtlich vorbereitet hatte.
»Wir können Euch erst einmal nur ganz herzlich für diese Einladung danken, Wilhelm«, erwiderte Frank nach kurzer Überlegung, »ich muss das in unserer Kammer klären, ich rufe Dich dann an«, zog Frank sich aus der Klemme.
»Ich kenne Euren Kammervorsitzenden Dr. Sieveking gut, ein sehr hilfsbereiter, umgänglicher Mann, der wird Dir den Urlaub bestimmt ermöglichen«, Wilhelm ließ nicht locker.
»Wie auch immer, wir müssen das erst intern klären, dann sprechen wir drüber, nicht wahr, Steffi?«, band Frank die weitere Diskussion ab, und Stefanie, der die aufgetretene Spannung nicht verborgen geblieben war, pflichtete ihm bei. Da ließ dann auch Wilhelm los und der weitere Abend verlief reibungslos.
Auf der Heimfahrt nach Köln machte Frank dann aber seiner Verärgerung Luft und erklärte ihr die Gründe dafür. Stefanie verteidigte ihren Vater, der heute offensichtlich sehr stolz auf ihn gewesen sei und ihnen beiden eine Freude hätte machen wollen. Sie sei so lange schon nicht mehr in der Schweizer Wohnung gewesen. Der Abend ging etwas missgestimmt zu Ende.
4. Kapitel Düsseldorf, Winter 1974
»Können wir dann anfangen?«, eröffnete Landgerichtsdirektor Dr. Sieveking am Dienstagmorgen der folgenden Woche die turnusmäßige Kammerberatung. Es waren die Fälle vorzubereiten, die am Mittwoch zur mündlichen Verhandlung oder zur Entscheidung der 1. Zivilkammer des Düsseldorfer Landgerichts anstanden. Im Arbeitszimmer des Kammervorsitzenden hatte sich neben Steinert auch der weitere Beisitzer Dr. Henzel mit dem ihm zugeteilten Referendar eingefunden. Die Besprechungen liefen meist im lockeren Ton ab; Dr. Sieveking vermied einen amtlichen oder gar autoritären Führungsstil.