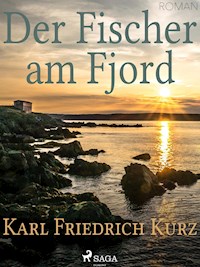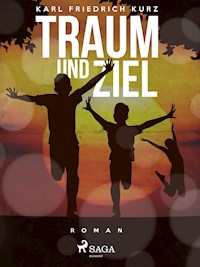Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Tyremoen auf der Insel Tyra gibt es keine Märchen und Wunder. In dem Ort, der nur aus drei Höfen und einer Kätnerhütte besteht, gilt der als reich, der statt drei Kühen fünf im Stall hat. Hofbauer Finn besitzt das größte Haus, sieben Kühe, sogar ein Pferd, aber nur eine Tochter. Für Monrad, den Häuslersohn, ist die verwöhnte, lustige Hjördis schon als Kind die Prinzessin seiner Träume, ein heimlich begehrtes Wunder seiner Kindheit. Ein zweites Wunder schickt eines Tages der Staat mit Lehrer Klagg, der ab da zweimal im Jahr gute Stimmung verbreitet. Monrad ist fasziniert von seinem Geigenspiel. Der musikalische Junge spielt bald selber und sein Instrument und die Musik werden für ihn zur Sprache seiner Seele. Als seine Mutter stirbt, kommt der schmächtige Fünfzehnjährige auf den Hof von Finn, der heimlich selber über diesen Tod trauert. Hjördis, zu einem frühreifen, fordernden Mädchen herangewachsen, verdreht nicht nur Monrad den Kopf. Während die Dörfler Jahr für Jahr ihrem einfachen Leben mit Gottvertrauen nachgehen, bricht in der Jugend vom Dorf das heiße Feuer der ersten Liebe aus. Gnadenlos wird der Wettstreit von Ove und Monrad um Hjördis, die zwischen beiden hin und her springt. Eines Tages beschließt Ove, alles das, was Monrad etwas bedeutet, in die Luft zu sprengen: die Hütte seiner Mutter, seine Geige und ihn am besten mit.Das einfache, leidenschaftliche Leben eines Dorfes fernab jeglicher Zivilisation: eine überwältigende Parabel für falsche Märchen, kleine Wunder und die Kunst, zu leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tyra, die Märcheninsel
Karl Friedrich Kurz
45.-49. Tausend
Tyra, die Märcheninsel
© 1935 Karl Friedrich Kurz
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711518403
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Die birkenrute
Der Hofbauer Finn Moen hat sein altes Boot auf die Felsen gezogen und umgekehrt. Es ist eine gesegnete Wärme in der Luft; ein hoher Himmel. Vom Meer herein fächelt eine leichte Brise — der weiche freundliche Windhauch, den man Havgul nennt und der seit undenklichen Zeiten ein sicheres Zeichen für ständiges Wetter gewesen. Und da liegt nun das Boot mit seinen langen Planken — nicht anders als ein großer toter Fisch.
Der Felsen ist glatt und rein wie ein Teller. Es muß wirklich eine Freude sein, ein altes hinfälliges Boot auf diesen Felsen zu ziehen. Hier kann es trocknen.
Der Bauer kommt mit einem großen, schmierigen Topf daher und mit einem langschäftigen schwarzen Pinsel; er macht ein prasselndes gelbes Feuerchen mit trockenen Wacholderzweigen und Treibholz; und streicht die verwitterten, vielfach mit Nägeln und Kupferplättchen geflickten Planken mit Teer an …
Das alles stimmt friedlich und froh. Die Luft ist mit Teergeruch und feinen Rauchschleiern erfüllt, und das Leben scheint leicht und munter zu fließen; ähnlich wie der Elv, der hinter dem blanken Felsen hervorplätschert und sich dann auf einmal, gleichsam in jähem Erstaunen, im großen Meer spurlos verliert …
Dann wird es Sonntag. —
Ein wirklicher Feiertag voller Güte. Das Meer dehnt sich glatt, von seiner eigenen Schönheit gesättigt, und der Himmel strömt nichts als blaues Wohlwollen aus. Der Hofbauer Finn Moen sitzt in ungeheuer rotem Wollhemd in seiner Stube, hinter dem Fenster, freut sich über die Feiertagsruhe und die himmlische Sanftmut und singt mit tiefer, wallender Stimme Psalmen und andere geistliche Lieder. Er hält mit seinen beiden großen Händen das Kirchenbuch, und seine Seele ist angefüllt mit Glaube und Dankbarkeit.
Es stört den Bauer zuerst nicht sonderlich, daß Ottny beim großen gußeisernen Ofen ewas mehr Lärm macht als nötig und durch außerordentlich laute Seufzer bekundet, daß ihr Herz nicht ganz im Einklang steht mit den Vorgängen des Lebens.
Ottny kocht Grütze. Ach, es ist keine Feiertagsgrütze aus weißem Weizenmehl oder Grieß, kein Leckerbissen. Es ist nur graue Hafergrütze, kein Genuß — nichts als Nahrung.
Der Hafer wuchs draußen auf dem kleinen Acker und wurde in der kleinen Mühle hinten am Elv gemahlen. Herrgott, und die Mühle steht ja dort und lehnt sich schief und jämmerlich schwach gegen die hohe Birke… Als diese Mühle erbaut wurde, war die Birke ein schlankes Bäumchen, das niemand beachtete. Mit den Jahren wurde sie aber zu einem starken Baum, der allmählich die eine Bohlenwand hob und zur Seite stieß. Jetzt klammert die winzige Mühle sich in Todesangst an dem dicken, vermoosten Stamme fest.
Wie sollte man nur erwarten, daß diese Andeutung einer Mühle irgendwie gutes Mehl mahlen könnte! Aber sie mahlt. Wenn man ihr das Wasser übers Rad laufen läßt, ächzt und stöhnt sie zuerst verzweifelt, und hernach rasselt sie ganz gewaltig und dreht wahrhaftig immer noch den schweren Stein. Manchmal wird sie förmlich wild und gefährlich vor Altersschwäche. Und wenn man sie dann im Zaum hält und bändigt, gibt es reichlich Sand im Mehl.
Sand im Mehl? Oh, das hat sicherlich noch keinem Menschen von Tyremoen geschadet. Diese Menschen kamen zur Welt, wuchsen auf und starben — die Mühle hat einen guten Anteil an ihrem Leben; aber nie an ihrem Tode …
Ottny kann sich nicht länger bezähmen.
„Ich wundere mich nur“, beginnt sie, „was du mit Karen am Hammer unternehmen willst …“
Der Bauer Finn weiß doch selber, daß das im Grunde eine verdammt eklige Angelegenheit ist. Er klappt das Gesangbuch zu, nimmt die Brille ab und putzt die Gläser zwischen bloßem Daumen und Zeigefinger. Dann legt er das Buch auf den Schrank im Stubenwinkel und die Brille aufs Buch. Er hält sich das eine Nasenloch zu und bläst mächtig durchs andere gegen den Ofen hin. Das macht er alles nur aus innerer Unsicherheit, nur um Zeit zu gewinnen; er hat doch gar nicht die Absicht, sein Weib Ottny damit zu ärgern.
„Was sollte ich denn unternehmen?“ fragt er. „Ich werde gar nichts unternehmen.“
Ottny ist hingegen nicht das Weib, das nur mit dem Pfannendeckel rasselt und hernach dem Schicksal und dem Hofbauern freien Lauf läßt. Nein, das Weib Ottny ist jetzt wütend über diesen Bauern Finn, der in seinem roten Wollhemd hinter dem Fenster sitzt und Psalter singt und sich eine jede Fliege über die Nase wandern läßt.
„Karen hat ihren Pachtschilling auch gestern nicht gebracht“, sagt Ottny, schaut den Ofen mit ihren kleinen dunklen Augen grimmig an und schnauft.
„Wie hätte sie ihn denn bringen sollen?“ fragt der Bauer vom Fenster her. „Wenn sie doch im Winter ihre Kuh verlor und überhaupt nichts als Unglück erleben mußte …“
Die Bäuerin Ottny redet weiter den Ofen an und behauptet: „Karen hat noch eine Kuh … Und sie hat den Pachtschilling auch letztes Jahr nicht gebracht. Und sie wird ihn, soviel ich von der Sache verstehen kann, nie mehr bringen.“
„Nimm es nur mit Ruhe und Geistesgegenwart, meine gute Frau! Letztes Jahr.? Da kam doch Thorgeir weg … Hat Karen denn nicht schon ohnedies Schlimmes genug zu tragen?“
„Und Monrad? Da geht nun dieser Schlingel herum und tut nichts Nützliches … ein fauler Laban … ein Faultier …“
„Monrad ist ja kaum elf Jahre alt, und nicht stark — der Herr im Himmel allein mag wissen, wovon dieser Junge soweit emporgewachsen ist …“
Hierauf feuert Ottny ihre große Kanone los.
„Wovon sie leben, fragst du? He? … Hast du, Finn, ihnen vielleicht nicht selber einen Sack Mehl ins Haus getragen? … Du bist mir ein Bauer! Ich kann dir nur noch das eine sagen: unsere Hjördis, unser eigenes, leibliches Kind, wird einmal von diesem Hof vertrieben werden — durch deine Verschwendung und Leichtfertigkeit.“
„Bist du verstört? — Nein, jetzt übertreibst du. Es war übrigens nur ein halber Sack — es war wohl nicht einmal völlig ein halber Sack … eine Handvoll Mehl … Wir sind doch Christenmenschen, Weib! Und wir sollen keine Untiere sein. Dürfen wir denn unsere Nachbarn verhungern lassen?“
Damit hört dieser Streit natürlich noch lange nicht auf. Im Gegenteil, das wäre ja erst ein verheißender Anfang. Ottny ist im Laufe der Zeit alt und scharf geworden; und sie war schon als Jungfrau nicht mild, sondern hielt vor allem auf ihre eigene Sache.
Die Leute sagten: Ottny? Sie ist zu trocken … ein Dürrfisch durch und durch! Darum kann sie auch keine Kinder kriegen … Vor lauter Geiz …
Dieses Gerede ging jahrelang am Strande von Tyremoen. Aber schließlich bekam Ottny doch noch ein Kind. Ein einziges nur; aber ein hübsches, fröhliches Kind, Hjördis. Dieses Töchterlein ist jetzt zehn Jahre alt und schon so vollkommen, daß es den häuslichen Sinn der Mutter offen verspottet und in allen Teilen lieber zum Vater hält.
Aber vielleicht ist Ottny doch nicht gar so schlimm, wie die Leute glauben. Sie ist vielleicht nur etwas zu durchsichtig in ihrem Wesen und macht nicht viel Aufwand mit unnützer Tugend.
Der Hofbauer Finn Moen denkt nun bei sich selber: Was hilft es denn, seine Seele mit Andacht und Feierlichkeit zu erlaben und Gottvater dankbar zu sein für das schöne warme Wetter und die Hafergrütze und alles das übrige? Da rumort nun dieses scharfe Weib am Ofen herum und reizt mich auf zu Zorn und Sünde …
Und der Bauer denkt weiter: Es ist ganz hoffnungslos, Ottny auf andere Gedanken zu bringen! Und wenn sie jetzt gar auf die Vorratskammer geht, möchte sie leicht auf den Gedanken verfallen, die gedörrten Schafskeulen zu zählen. Ja, und dann dürfte der Fall eintreten, daß eine davon fehlt …
Nach dieser Überlegung meint der Bauer, es könnte in der Tat gar nichts schaden, einen kleinen Gang über die Hauswiese zu machen. Vielleicht, daß die Schafe sich wieder durch den Zaun gebrochen haben oder daß das alte Gatter oben an der Mauer umfiel. Ein Bauer hat doch mancherlei, worauf er achten muß. Finn erhebt sich mit einem Seufzer und verläßt die Stube.
„Wo ist jetzt aber mein anderer Holzschuh?“ fragt der Bauer Finn gleich darauf von der Haustür her.
„Dein Holzschuh?“ fragt Ottny, „den wirst du wohl mit allem anderen verschenkt haben, du Finn-Bauer!“
Davon kann natürlich keine Rede sein. Der Bauer steht auf der blankgescheuerten Steintreppe vor der Tür. Er steht auf der steinernen Treppe, auf die er nicht wenig stolz ist. Kein anderes Haus in der Tyremoen hat eine Haustreppe. Darum ist Finn auch der größte Mann hier. Er hat sieben Kühe im Stall und das einzige Pferd auf viele Meilen im Umkreis. Oh, er ist ein wahrer Häuptling und Anführer. Er hält sich auch eine Zeitung, die er alle zwei, drei Wochen im Briefhaus auf Fagarö abholt. Eine wirklich gedruckte Zeitung — und wenn Finn zu den Nachbarn etwas sagt, dann gilt es, und seine Worte wägen schwer vor Weisheit und Fortschritt. Keiner wagt gegen Finns Willen zu handeln. Keinem würde es auch nur einfallen, eine solche hohe und stolze Steintreppe vor seine Haustür zu bauen. Es sind zwar nur hohe Schieferplatten, und die Stufen sind wahrscheinlich nicht einmal von derselben Höhe — aber gleichwohl …
Doch der Holzschuh ist fort.
„Der Teufel salze und rupfe und brate mich!“ ruft der Bauer Finn.
Hei, wie sein rotes Wollhemd zornig leuchtet! Wie es funkelt in diesen lichten Sonntagmorgen hinein!
Eine Schar Kinder spielt unten an einer Wasserlache. Es sind viele Kinder. Gottvater, der ja alle Dinge regiert, mag wissen, durch welche Mirakel und Fügungen so viele Kinder in die paar grauen Häuser von Tyremoen kommen konnten, an diesen entlegenen, weltvergessenen Strand.
Die Kinder bei der Wasserlache reden laut und machen viel Lärm mit Hilferufen und dröhnenden Kommandoworten. Wahrscheinlich spielen sie Schiffbruch und sind eifrig dabei, die erzürnten Elemente walten zu lassen. Plötzlich bemerken sie aber das unglaubhaft rote Wollhemd an der Tür und lassen Schiff und Sturm im Stich und fliehen. Mit einem Schlage sind sie weg; so vollkommen verschwunden, daß man gar nicht mehr an sie zu glauben vermag.
Auf der Wasserlache aber schwimmt ein Holzschuh. Das müß wohl der andere Holzschuh des Hofbauern Finn sein. Es wurde ein sauberes Loch in seinen Boden gebohrt. Natürlich — wo hätte man denn sonst den Mast hineinstecken sollen? Es wurden runde Löcher in das Vorderleder geschnitten. Selbstverständlich sind das die Kajütenfenster. Und an der Ferse ist ein Ruder befestigt. Und das Ruder kann man sowohl nach Steuerbord als nach Backbord drehen. Großartig!
Der Hofbauer Finn Moen aber flucht immer fürchterlicher und achtet nicht länger auf den blauen Frieden des Sonntagmorgens.
„Der Hund versetze und schneuze mich! — Hast du denn jemals so etwas gesehen?“
Ganz gewiß wendet der Bauer Finn sich mit dieser Frage an den strahlend lachenden Himmel, ja vielleicht an den lieben Gott selber. Er ist jetzt so wütend, daß er alle unsichtbaren Gewalten auffordert, ihm beizustehen, die Übeltäter zu strafen und völlig zu vernichten.
Die Bäuerin Ottny hat indessen gewittert, daß außerhalb ihrer Stube ungewöhnliche Dinge geschehen. Kaum daß der Bauer das Schiff aus Seenot gerettet, steht sein Weib auch schon hinter seinem Rücken und flüstert ihm, wie der böse Geist selber, finstere Eingebungen ins Ohr.
„Das hat kein anderer getan als er, Monrad, kannst du verstehen!“ flüstert Ottny. „Dieser Laban … Kein anderer hat so tolle Gedanken wie er. Hehe! Und jetzt kannst du deine Zehen zu den Löchern hinausstrecken, Bauer!“ höhnt Ottny.
„Nein — aber meine selige Seele!“ staunt der Bauer ganz überwältigt. „Nein, zum Teufel — und das versteh’ ich nicht länger … Wie können sie denn nur so etwas erfinden, möcht’ ich wissen … Mit einem splinterneuen Schuh …“
So lassen die beiden ihre Gedanken zusammenfließen und führen ein Gespräch. Und Ottny wird es nicht müde, ihrem Bauern weitere Eingebungen ins Ohr zu flüstern.
„Sei du nur froh, du, Bauer, daß sie dich in deiner Einfalt nicht selber aus deinem Bette hervorziehen und dir Löcher in den Bauch bohren.“
„Nein, nein“, sagt der Bauer Finn. „Und dieses geht unbedingt zu weit!“
„Und wenn ich ein Mann wäre wie du, Finn“, flüstert Ottny, unhemmbar in ihrer finsteren Versuchung, „ja, wenn ich der erste Mann wäre an diesem Strande, würde ich mir solches niemals gefallen lassen. Ich würde mir jetzt eine schickliche Birkenrute vom Baum dort schneiden; und damit würde ich die Jugend zu Gehorsam und Achtung vor dem Alter erziehen …“
Dieser Rat scheint dem Bauer Finn Moen wahrlich gut. Er klettert sogleich auf die Birke und wählt bedachtsam, wie es in seiner Natur liegt, eine passende Birkenrute aus — ei, eine ganz ausgezeichnete Birkenrute, die nur zu diesem Zwecke seit Jahr und Tag heranwuchs und auf den Augenblick wartete, geschnitten zu werden, um so ihren Platz auszufüllen im Weltgetriebe.
Es muß doch eine Gerechtigkeit geben zwischen Himmel und Erden!
Aber als der Bauer Finn vom Baum herunterrutscht, bleibt seine Hose an einem alten Aststumpf hängen. Des Bauern Sinn ist ganz und gar bei der Gerechtigkeit und Strafe; er merkt es nicht — und darum wird ihm auf einmal die Hose unter seinem warmen Leib zerrissen. Das ist zu allem Überfluß noch die Sonntagshose.
Der Himmel aber lächelt immer in heiterer Bläue und spiegelt sich im blanken, selbstzufriedenen Wasser. Die ganze Natur scheint unentwegt in strahlendem Humor.
Der Hofbauer hingegen ist zu dieser Zeit in seinem tiefsten Herzen erschüttert. Er denkt: Ich werde es ihnen aufstreichen — sowohl für den Schuh als auch für die Hose! Herrgott — denn dieses ist ja rein unmöglich. Und ich kann es unter keinen Umständen länger dulden.
Und so schnitzelt er nun die Birkenrute zurecht und säubert sie mit seinem guten Dolchmesser, gibt ihr die richtige Länge und läßt sie durch die Luft pfeifen. Und dabei freut er sich. Und eine bessere Birkenrute pfiff wahrlich niemals durch die Luft. Sie zittert förmlich vor Begehrlichkeit.
Ja, denkt der Bauer Finn, auf diese Art und Weise mag es schon gehen — dieses ist wirklich eine vorzügliche Rute …
Er fährt mit dem Fuß in den mißhandelten Holzschuh. Und als seine Zehen sogleich in natürlicher Größe zu den Löchern hervorschauen, schüttelt der Bauer sein Haupt.
„Ja, dieses Mal muß etwas geschehen!“ sagt er zu seinem Weib Ottny. „Ich werde sie gründlich verhauen, sollst du wissen …“
„Ja — und das magst du nur glauben“, spottet Ottny.
„So? Oder vielleicht nicht?“
„Nein, Bauer, du wirst sie überhaupt nicht erwischen. Sie schlüpfen doch in alle Löcher wie Ratten und Mäuse und solches Zeug.“
In dieser Beziehung hat nun Ottny, die lebenskluge Frau, allerdings recht. Wenn hier etwas geschehen soll, so muß es mit großer Schlauheit und Überlegung geschehen. Der Hofbauer Finn setzt sich also wieder hinter das Fenster, die geladene Birkenrute schußbereit über den Knien.
Nun ist seine ganze Sonntagsfreude futsch. Es kommt ihm schon so vor, als wärme die Sonne nicht mehr richtig. Es kommt ihm so vor, als lachten die grauen Möwen — strichen nur ihm zum Spott und Ärgernis über das glatte strahlende Wasser hin, und lachten. Dem Bauern kommen Gedanken. Nun hat er gestern wirklich und wahrhaftig und völlig im geheimen, wie es die Schrift haben will, ein gutes Werk vollbracht. Heute wird es ihm derart gelohnt. Das ist wahrlich so rätselhaft, daß ein ehrlicher Bauer hinter seinem Fenster sitzen kann und in hilfloser Verblüffung über den Lauf der Dinge sein Haupt schütteln muß.
„Du — du — Finn — Bauer!“ zischt das Weib Ottny. „Hast du denn keine Augen im Kopf?“ Und sie zeigt mit ihrem knöchernen Finger hinunter: „Jetzt — ja jetzt kannst du sie nehmen!“
Da hat also das Schicksal wohl doch eine vernünftige Laune gehabt. Da hat nun die Gerechtigkeit einmal über einen gekränkten Bauern gewacht und dafür gesorgt, daß die Übeltäter bestraft werden können. Das Schicksal hat die Kinder mit lauen Lüften und Sommerwärme dazu verleitet, ihr erstes Seebad zu versuchen. Da das rote Hemd des Bauern Finn in der ganzen Landschaft unsichtbar blieb, vergaßen die Kinder sehr bald die Schiffskatastrophe und das Wüten der Naturgewalten. Und dort unten baden sie jetzt.
Das paßt alles vortrefflich und hätte sich gar nicht besser fügen können. Ihre Kleider liegen am Strande. Zu beiden Seiten stehen hohe Felsen, gleich Gefängnismauern. Weiter oben liegen große Steinblöcke, dunkles Erlengebüsch steht da. Diese Gegend ist zu Hinterhalt und Überfall wie geschaffen. Sie riecht förmlich nach Blutvergießen und Hinrichtung.
Ja. Und hiermit soll es nun vollzogen werden.
Ottny streift ihrem Bauern den braunen Werktagskittel übers rote Wollhemd. Finn Moen greift in die Tasche, findet eine schwarze Tabaksrolle und beißt davon, um genügend Mut und Entschlossenheit zu gewinnen, einen unmenschlich großen Priem ab. So zieht er los mit seiner gierigen Birkenrute und spuckt gewaltig. Er schleicht sich hinter Stein und Busch heran. Jetzt ist er unten.
Er liegt hinter einem dunklen Erlengestrüpp. Nur wenige Schritte vor ihm hüpfen die gelben nackten Kinder — Gott bessere es! —, schmale, magere Kinderleiber mit dünnen Gliedern und allzu dicken Bäuchen. Die Schulterblätter stehen ihnen wie kleine Engelsflügel aus dem Rücken hervor — wie erbärmliche, kahlgerupfte Flügelstümpfchen. Man kann im harten Sonnenlichte alle die gebogenen Rippen zählen.
„Tröste mich — wie mager sie doch alle sind!“ seufzt der Bauer Finn.
Und nun stellt er sich vor, wie er im nächsten Augenblicke hinter den Zweigen hervorspringen wird. Er stellt sich sehr genau vor, wie seine geschmeidige Birkenrute auf diese nackten, ausgemergelten Kinderleiber niedersausen wird … Da schießt ihm plötzlich das Wasser in die Augen. Und der Himmel verdunkelt sich. Und das Meer rauscht wie von unendlichen Tränen. Und der Bauer Finn schluckt …
Der Bauer Finn drückt in tiefer Beschämung sein Gesicht ins Gras, und er schlägt mit seiner Birkenrute auf den Boden; und er bohrt mit seiner ungeheuer großen Zehe ein Loch in den Sand.
„Ja, bessere mich! Was soll aber nun das bedeuten?“ fragt das Weib Ottny oben am Fenster. „Ja, sieh nun den Bauer — dort liegt er genau wie jeder andere Seehund! Er ist nicht einmal imstande, ein paar Kinder zu züchtigen…“
So redet Ottny vor sich hin und verachtet solches Übermaß unmännlicher Weichheit.
Wenn aber der Bauer da liegt und mit seinem Stock auf den Erdboden klopft, merken es natürlich die Kinder bald. Sie holen ihre Kleider und laufen davon. Und deshalb wird es nichts aus dem Strafgericht. Der Bauer begibt sich ins Haus zurück.
„Das sieht dir wieder vollkommen ähnlich in deinem Größenwahn“, sagt Ottny.
„Meinst du das?“ fragt Finn. „Nun sollst du aber doch nicht glauben, daß ich weniger wütend bin als vordem. Nein—schinde und brenne mich—, das ist durchaus nicht der Fall. Sondern dieses ist die Ursache: wie konnte er sie denn schlagen, wenn sie splitternackt dastanden? Nein, Weib! Es wird dir niemals gelingen, einen Unmenschen aus mir zu machen!“
„Nein“, sagt das Weib zum gußeisernen Ofen. „Nein, nein — denn er ist nämlich ein Kujon und Feigling, dieser Bauer Finn …“
„Glaubst du vielleicht das?“ fragt der Bauer leise und unheimlich.
Und wie ihm so der Rücken Ottnys nichts als kalte Verachtung und giftige Aufreizung entgegenströmt, ärgert er sich noch mehr über die Tücken des Lebens. Auf einmal kann er nicht anders und muß jetzt seine Birkenrute schwingen. Da hilft alles nichts — und er trifft damit wahrlich das Weib Ottny.
Finn sagt: „Dieses ist für dein unchristliches Maul — und dieses ist also für meine Sonntagshose!“
Das Weib Ottny wird sogleich beleidigt, heulte auf und begibt sich in die Kammer, seinen Zorn abfließen zu lassen.
Der Bauer Finn, durch seine eigene Tat überwältigt, verläßt ebenfalls die Stube. Da brennt natürlich die Hafergrütze im Topf gründlich an und verbreitet Rauch und üble Düfte …
Der Himmel aber lacht unverdrossen weiter, und das Meer dehnt sich und wird nicht müde, zu strahlen in eitler Selbstbewunderung. Die Kinder sind unter das umgekehrte Boot gekrochen.
„Was wollte denn Finn am Strande?“ fragt Harald.
In Haralds großen Augen spiegelt sich der weite Himmel und das Meer darunter. Er versucht mit seinem Messer einen Riß im Boot zu erweitern. „Warum lag er da und klopfte mit dem Stock auf den Boden?“ fragt er.
Die Kinder raten hin und her. Sie meinen, daß die Erwachsenen sich manchmal recht töricht benehmen und ganz unbegreifliche Taten verrichten. Am allerwenigsten achten sie den Bauer Finn mit seinem roten Hemd, dem großen Bart und der Steintreppe.
„Jetzt wollen wir ‚Haus‘ spielen“, schlägt ein Mädchen von fünf Jahren vor. „Wir spielen Kinderkriegen und Taufefest“
Aber nein, die anderen haben heute zu solchem keine Lust.
„Monrad soll eine Geschichte erzählen“, befiehlt Hjördis.
Monrad erzählt eine Geschichte. Oh, eine vornehme Geschichte vom Königsschloß und von der Prinzessin, die aus fernem Lande gekommen ist, den Kronprinzen zu heiraten. „Aber er will sie nicht haben“, sagt Monrad.
„So. Will er vielleicht nicht?“ fragt Hjördis.
„Nein, denn er liebt ja schon eine andere.“
„Eine andere?“
„Ja. Er liebt die Prinzessin Hjördis von Tyremoen. Jetzt hat er sich heimlich aus dem Schloß geschlichen und auf den Weg gemacht …“
Diese Geschichte gefällt den Kindern. Aber Hjördis bezweifelt sie.
„Das lügst du! Er kann doch nicht davonschleichen. Denn alle Leute im ganzen Reich kennen ihn …“
„Er wird sich wohl eine große blaue Brille aufgesetzt haben, wie Lehrer Klagg“, sagt Monrad.
Aber Hjördis darf sogar ihrer Mutter, der scharfen Ottny, die Stange halten. Sie ist ein mündiges Mädchen und von klarem Wirklichkeitssinn erfüllt.
„Jetzt glaube ich aber, Mensch …!“ ruft Hjördis und lacht.
„… Er segelte mit seinem großen Schiff nordwärts“, erzählt Monrad. „Und er kam bis an den Hernessund. Da stand auf dem Felsen bei Skarholmen ein Riese. Und der Riese schleuderte einen Stein, so groß wie ein Haus. Und er traf des Prinzen Schiff. Er hatte drei Augen …“
Die Geschichte gefällt den Kindern immer besser. Aber Hjördis lacht … „Hihihi! Und der Riese, das bist wohl du, Monrad …!“
Da bekommt Monrad heiße Ohren, und sein Blick verschleiert sich. Er schweigt verwirrt und schamvoll.
Und damit ging diese Geschichte aus. Sie war vielleicht noch nicht zu Ende. Sie wurde nur abgebrochen …
Handel und seefahrt
Man muß wissen, daß Tyremoen ein kleiner Ort ist: drei Höfe und eine Kätnerhütte.
Hinter Finn Moens Stall, ein wenig den Berghang hinan, liegt das Gehöft Olaj Höigaards. Fünf Kühe und ein Schweinchen, dazu ein Dutzend Schafe. Dort ist der blonde stämmige Ove zu Hause. Ove, der einzige Sohn und Erbe, Ove, der nicht länger ein Kind ist. Hinter Höigaard und noch ein Stück weiter den Hang liegen die mageren Wiesen und steinigen Äcker von Sörbö.
Jon Sörbö ist klein und grau. Er mag jetzt vierzig Jahre alt sein, und war schon mit zwanzig klein und grau — ein schmutziges Graubraun, das nicht nur die Haare, sondern den ganzen Mann überzogen hat. Jenny, sein Weib, hat einen unförmlichen Bauch und einen Herzfehler. Den Herzfehler hatte Jenny, wie man mit Bestimmtheit weiß, schon als unschuldiges Mädchen. Das mit dem Unterleib hingegen mag mit dem Kindersegen zusammenhängen — Gott weiß es. Diese Eheleute bekamen ihre Kinder gewöhnlich paarweise geschenkt. Weder Jon noch Jenny können das recht begreifen, und beide sind im Grunde empört darüber. Und beide behaupten, es sei niemals ihre Schuld. Sondern es sei eine Heimsuchung, sagen sie. Und wenn es Schicksal ist, kann man nichts dagegen machen. Jon droht sogar, den Staat um Unterstützung anzugehen.
„Denn — bitterer Tod—“ sagt Jon, „wenn es so weitergeht, kann ich es bald nicht mehr aushalten. Ich bin nicht in der Lage, für ein ganzes Regiment zu sorgen.“
Aber Jenny weist ihn dann jedesmal zurecht und sagt: „Du sollst dich nicht versündigen, Mann! Und du sollst dich nicht auflehnen gegen die Vorsehung! Vergiß auch nicht, daß die Kinder mit jedem Tage heranwachsen und größer werden. Mit der Zeit können wir das ganze Espedal roden und neuen Boden gewinnen und mehr Korn und Kartoffeln pflanzen …“
Diese Jenny war doch alle Tage ihres Lebens zuversichtlich und von heiterem Sinne. Sie liebte ihre Kinderschar; und es gelang ihr bis zum heutigen Tage, sie zu nähren und zu kleiden. Und das ist sicherlich ein lebendes Wunder und in jedem Falle etwas mehr als ein Kunststück.
Es gibt einen Weg in Tyremoen. Der ist vielleicht zweihundert Schritte lang und führt genau von der hochmütigen Steintreppe Finns an den Strand hinunter. Damals, als Finn sich das Pferd kaufte, legte er in Vermessenheit gegen den Himmel auch noch diesen Weg an und opferte den ganzen langen Streifen Wiesland. Der Bauer Finn muß wohl heimliche Reichtümer gesammelt haben, daß er sich das alles miteinander leisten konnte und darüber nicht völlig zugrunde ging.
Und dann ist auch noch der Elv da — ein lebendiges Wasser mit grober Stimme. Ein ganz hitziger Bach, dessen Anfang man in den blauen Bergwänden dort hinten sehen kann, in einem langen Schaumstreifen, dem Trollefoß. Der Elv rennt durch eine enge Schlucht, die auch zur hellsten Mittagsstunde noch schwarz ist und am wärmsten Sommertag einen eiskalten Hauch ausströmt. Dort hinten beginnt das Märchen … Eine Welt für sich, durch den hohen Steinwall von den Behausungen der Menschen abgeschlossen — eine Welt mit seltsamen Stimmen, voller Überraschungen und wunderbaren Ereignissen und angefüllt mit Unbegreiflichem. Der Elv kommt aus jener Welt hervor. Sein Wesen ist ganz gewiß nicht freundlich. Er klatscht zornig gegen den kleinen, lächerlichen Steindamm, den der Bauer Finn ihm in den Weg legte, um die große Wiese vor Überschwemmung zu schützen. Der Elv murrt hinter den Wiesen, Tag und Nacht.
Was aber die Hütte der Karen am Hammer angeht, so handelt es sich hier um eine ganz und gar elende Hütte. Sie besteht nur aus einem winzigen Vorraum und einer Stube, deren Decke die Dachsparren tragen. Die Wände sind fast unmöglich niedrig. Darum blieb nur wenig Platz für das Fenster. Selbst Karen, die nicht von hervorragender Körpergröße ist, muß sich bücken, wenn sie durch die Tür eintritt.
Es steht da ein schwarzer Eisenofen, der zugleich Kochherd ist. Es steht da an jeder Wand ein Bett. Den Raum dazwischen nimmt ein Tisch ein. Nichts Überflüssiges findet sich in dieser Stube; höchstens ein Geraniumstock mit dunkelroten Blüten und Blättern, die einen braunen Ring haben. Er steht in einem schadhaften Nachttopfe am Fenster und verbreitet bunte Farben und auf irgendeine Weise ein bißchen Lebensfreude.
Und was ist nun mit dieser Karen? Mit Karen, die vor nicht ganz zwei Jahren ihren Mann Thorgeir und im vergangenen Winter ihre Kuh Plinka verlor … Karen singt. Ach, sie singt wohl nicht so richtig. Es sind keine Worte. Es ist kein Lied. Karen singt nur Töne. Singt Töne, die in eigentümlicher Sanftmut und Trauer sich in die Stille der Stube ergießen. Fast ist es so, als streiche der Wind durchs Moorgras, als summe der Wind in hohen steilen Felsen…
Nein, das kann niemals ein Lied sein — vielleicht ist es nur das Wimmern eines kleinen, verängsteten Tieres, das sich vor der Einsamkeit und dem großen Schweigen fürchtet und darum seine Stimme erhebt.
Karen ist bleich und welk und von unversieglicher Demut, wie es sich für eine arme Kätnerswitwe schickt. Sie netzt jeden Morgen ihr Haar, das sich mutwillig über der Stirn kräuseln möchte, und preßt es glatt. So verrichtet sie ihre kleinen, unbedeutenden Arbeiten, melkt ihre letzte Kuh, pflanzt Kartoffeln, mäht das Gras, gräbt Kartoffeln aus, holt Reisig aus dem nahen Wald, kocht Grütze — und erharrt in stummer Angst, aber ohne sündige Auflehnung, die Schläge des Schicksals. Karen klagt niemals.
Karen klagt auch nicht, als Thorgeir auf der See draußen blieb. Sie ging ein paar Tage lang herum und suchte ferne Stränder ab. Da fand sie das Boot, in einem kleinen Vik, unter Tang halb begraben.
Ein Dolchmesser steckte in den Planken. Das war Thorgeirs großes Dolchmesser. Es steckte außen in den Planken, nahe beim Kiel. Das erklärte alles.
Das Dolchmesser erzählte ganz gelassen und hart eine kleine Geschichte. Eine Geschichte, wie sie an dieser Küste jeden Winter einige Male sich ereignet …
Thorgeir war ein tüchtiger Kerl zur See. Er fuhr mit seinem Boot hinaus und versorgte sozusagen den ganzen Strand mit Fischen. Für die Fische tauschte er Mehl ein und ein wenig Fleisch und ein wenig Schaftalg.
Manmal fing er auch einen Heilbutt — ein richtiges fettes Seeschwein, das seine zwei Zentner schwer sein konnte. Damit ruderte er dann die paar Meilen nach Fagarö zum Handelsmann Laurentzen.
Der Handelsmann bezahlte ihm vielleicht zwanzig Ör fürs Kilo, vielleicht auch nur fünfzehn. Ho — das gab Geld auf die Hand! Blaue Scheine, gelbe Scheine.
„Der Absatz geht zwar in diesen Tagen furchtbar träge“, beklagte sich der Krämer Laurentzen. „Der Englischmann wird — salze mich — mit jedem Jahr mehr und mehr zum Racker. Ich kann keinen höheren Preis zahlen.“
Damit schenkte Laurentzen dem Fischer Thorgeir einen Schnaps ein.
„Nein — nein“, sagte der Fischer Thorgeir und trank. „Tausend Dank! Uff! Das war aber eine feine Ware — wie ein schartiges Messer zieht es sich den Hals hinab.“
Es konnte sogar auch vorkommen, daß Laurentzen dann noch ein zweites Glas zugab. Es kam aber nicht jedesmal vor. Laurentzen verstand die Kunst, sich rar zu machen und seine Wohltaten nicht zu verschwenden.
„Ein Pfund Zucker — ein halbes Pfund Kaffee … war das wirklich alles?“ konnte er fragen. „Sollte es wenigstens nicht auch noch ein halbes Pfund Rosinen sein für die Madame und den Jungen? Du schwimmst doch heute völlig in Geld und Staatspapieren, du, Thorgeir …“
„Jetzt scherzen Sie!“ antwortete Thorgeir auf solche Redensarten, vielleicht nicht ganz frei von Spott und Einsicht, aber doch auch ein bißchen geschmeichelt. „Nein, da fehlt leider noch viel zum Reichtum. Aber meinetwegen kann es also auch noch ein halbes Pfund Rosinen sein.“
„Und sonst nichts anderes?“ fragte der Krämer, währenddem er mit dem Finger ein wenig auf die Messingschale drückt, worin die Rosinen gewogen werden. „Du kannst doch nicht alle deine Geldscheine in der Erde vergraben. Das geht niemals an.“
„Wie Sie scherzen können!“ sagt Thorgeir.
Nun ja. Man wohnt einsam am Strande von Tyremoen und sieht nicht jeden Tag ein fremdes Gesicht. Da tut ein Schwatz in der Seele wohl. Und wenn man von einem Manne wie dem Krämer Laurentzen für mehr gehalten wird, als man vielleicht in Wirklichkeit ist, sogar gewissermaßen für wohlhabend gehalten wird, so darf man sich nicht lumpen lassen.
„Du ziehst ja die Taler und Zehnkronenscheine nur so aus dem Wasser herauf“, konnte Laurentzen weiter sagen. „Jaha — wer es auch einigermaßen hätte wie du …“
Und so wog er denn wieder und verkaufte und triebt Handel und erfüllte den Zweck seines Lebens. Er strich schließlich mehr als die Hälfte vom Geld, das er dem Fischer Thorgeir auszahlte, wieder über die mit Zinkblech beschlagene Tischplatte hin. Plötzlich verschwand das Geld. Es fiel durch einen schmalen Schlitz in eine Tiefe, wo es unwiederbringlich verloren war.
Wenn Thorgeir nach Hause ruderte, hatte er allerlei kleine Sachen im Boot und eine ziemlich gute Meinung von sich selber. Ja, es war wirklich ein eigener Segen mit Laurentzens Kramladen — man wurde darin zuversichtlich im Herzen und hoch im Hut. Man war für ein paar Stunden lang nicht nur ein armseliger Stümper ohne eigenen Grund und Boden unter den Füßen. Man war gewissermaßen ein Herr — ein Herr über alle Schätze des Meeres. Man konnte ja, wenn es das Glück zuließ, jeden Tag einen Heilbutt fangen und damit nach Fagarö rudern. Und dann dieser Schnaps — das reine Hexenwasserǃ
Nicht daran zu zweifeln, der Fischer Thorgeir ruderte stets zufrieden von Fagarö nach Hause. Der Krämer Laurentzen war seinerseits auch nicht mißvergnügt. Er hatte zum Beispiel zwanzig Ör für das Kilo Heilbutt bezahlt. In der gleichen Nacht noch trug das Postschiff diesen Heilbutt südwärts. Und der Krämer wird zu seiner Zeit ungefähr eine Krone fürs Kilo erhalten. Das sind Porzente, mein Lieber!
Aber alles, was recht ist — und alles kann doch nicht Gewinn sein. Mußte der Krämer Laurentzen denn nicht einen Schuppen bauen mit Doppelwänden und Sägmehl dazwischen? Und den Schuppen mit Eis füllen? Übrigens geht doch auch einiges drauf für Kisten und Briefporto und Fracht. Und so. Jedem das Seine …
Der Krämer Laurentzen muß auch um sein Leben kämpfen. Jeder kämpft auf seine Weise. Vielen wird es sehr leicht gemacht, sie können das Bargeld nur aus der See schöpfen. Anderen wird es schwerer gemacht, sie müssen Kunst und Wissenschaft anwenden …
So lebte also der Krämer Laurentzen. Und so lebte der Fischer Thorgeir. Und beide lebten in ihrer Art gar nicht so schlecht und wurden älter mit jedem Tag und reicher an Erfahrung und Lebensweisheit.
Und dann sandte der Himmel einen grimmigen Südweststurm aus, genau zu der Stunde, als der Fischer Thorgeir vom Krämer auf Fagarö zurückruderte. Der Südweststurm fand das Boot des Fischers Thorgeir, erfaßte es, hob es wie nichts auf und warf es um. Thorgeir fiel daraus und versank im Wasser. Und da er nicht schwimmen konnte, konnte er das nahe Land nicht erreichen und klammerte sich am umgewälzten Boot fest. Er kletterte hinauf bis zum Kiel. Und da die Planken glatt waren, konnte er sich nicht daran festhalten. Darum stieß er sein großes Dolchmesser ganz oben beim Kiel ein, wie es vor ihm bei ähnlichen Gelegenheiten schon mancher machte. So konnte der Fischer Thorgeir sich über Wasser halten. Er konnte schreien und um Hilfe rufen und seine Not klagen. Oh, er konnte heulen und jammern, soviel in seinen Kräften lag. Aber das hörte niemand. Niemand konnte ihn sehen. Denn dieses ereignete sich in einer dunklen Nacht, die mit Zischen und Fauchen erfüllt war.
Weil nun aber der Südwest immer schärfer übers Wasser hinsprang und vor überhändiger Wut brüllte, blies er den durchnäßten Fischer an und machte sein Gesicht starr und seine Hände klamm.
Man kann nicht wissen, ob Thorgeir in dieser Nacht den Draug gesehen, den Draug, der wahrscheinlich auf einem gekenterten Boot an ihm vorbeisegelte, mit einem großen Tangbusch zwischen den Schultern anstatt dem Kopfe. Thorgeir mag in jenen Nachtstunden mancherlei gesehen und vernommen haben. Vielleicht ließ er in großer Angst sein Dolchmesser fahren. Vielleicht wurde er nur müde und wollte nicht länger auf einem hölzernen Roß mit scharfem Rücken reiten. Und so glitt er schließlich herunter …
Solches ungefähr berichtete sein Messer.
Nein, dieses ist alles in allem keine besondere Geschichte. Viele Frauen an der Küste könnten eine ähnliche erzählen.
Dieser Art war also Thorgeir verschwunden und fortgekommen. Nicht einen einzigen Faden, nicht ein einziges Haar fand man mehr von ihm.
Karen klopfte mit einem Stein das Dolchmesser aus dem Kiel und trug es nach Hause. Dort, in der schwarzverräucherten Holzwand, steckt es.
Was soll man noch weiter darüber sagen?
Handel, Landwirtschaft und Seefahrt — viele kommen hoch dabei, und einige fallen ab dabei und müssen liegenbleiben. Dieses Mal traf es Thorgeir. Dadurch wurde sein Weib zur Witwe, und vielen Fischen wurde das Leben verlängert …
Nun erscheint aber der Hofbauer Finn vor der Kätnerhütte. Als dunkler Schatten gleitet er am Fensterlein vorbei. Er tritt durch die niedrige Tür und reibt sich die Brust.
„Gott segne deine Arbeit, Karen!“ sagt er.
So gesittet ist dieser Bauer Finn, daß er seinem Zorn nicht gleich alle Schleusen auf einmal öffnet.
„Dank dafür, Finn“, sagt Karen.
Ach, Karen weiß ja schon, daß es wichtige Umstände und Veranlassungen sein müssen, die den Bauern jetzt in ihre Stube führen.
„Und was ist nun deine Meinung von dieser Sache?“ fragt der Bauer Finn und stellt das Schiff, das einmal ein rechtschaffener Holzschuh gewesen, auf den Tisch.
Nein, Karen findet dafür keine Worte. Sie könnte ihre Gefühle möglicherweise in Töne fassen. Aber da sie nur in der Einsamkeit und für sich selber singt, bleibt ihr dieser Weg versperrt.
„Das hat also Monrad gemacht! — Mein Weibervolk behauptet es.“
Karen blickt den Bauern an. Ihr Blick ist nur eine Frage. Ihr Blick ist Angst und Flehen. Und dann senkt Karen das Haupt. Sie senkt ihr Haupt vor einem so geringen Ding wie diesem Holzschuh und bietet ohne Vorbehalt ihren Nacken dar, den Schlag zu empfangen.
Aber dieser zornige Bauer Finn, der vor kurzem sein scharfes Weib mit der Birkenrute streichelte, verliert schon wieder allen Boden unter den Füßen, und die Welt beginnt ihm abermals in Feuchtigkeit zu schwimmen. Ob er nun gleich mit gewaltiger Muskelkraft den ungeheuren Priem zerkaut und männlich um sich her spuckt und Säfte vergeudet — er bleibt dennoch Kujon und Feigling! Oder vielleicht nicht? Wenn er doch jetzt solcherlei Worte fallen läßt:
„Du sollst es nicht gar zu schwer nehmen, Karen, verstehst du! Aber ich wurde vorhin so rasend, daß ich beides, sowohl schwarz als rot, zu gleicher Zeit sah. Und es bleibt wirklich und wahrhaftig ein Himmelswunder, daß der Schlingel mir nicht in die Hände fiel. Sonst hätte leicht ein Unglück entstehen können. Denn du weißt doch, Karen, wie grauenhaft jähzornig ich in meinem Sinne bin. Das ist nun leider so ein Erbfehler von mir — Gott sei mir gnädig!“
Hierauf wird der Bauer wieder gefaßt und handlungskräftig und verkündet als der erste Mann von Tyremoen: „Ja! Dieses ist also glücklich vorübergegangen. Und heute ist Sonntag, da soll nichts weiter unternommen werden in dieser Sache. Aber morgen wird Monrad unbedingt zu mir kommen und ein Stück Leder holen, und bis zum Abend muß der Schuh wieder geflickt sein — verstehst du! Das geht, meiner Seel, nicht anders.“
Karen antwortet noch immer nicht. Ihr sitzen die Worte nicht so locker in der Kehle. Sie nickt nur. Auf einmal huscht ein kleines, ganz verwunderliches zartes Lächeln über ihr in Elendigkeit erstarrtes Gesicht; und sie reicht dem großen Bauer Finn ihre Hand. Und sie murmelt etwas dabei. Vielleicht dankt sie mit scheuen Worten für das gnädige Urteil, dankt mit sehr scheuen Worten, die sich verbergen wollen. Vielleicht sind es auch nur wieder diese leisen Töne …
Der Bauer aber versteht es wohl. Er nickt mit dem bärtigen Gesicht und geht, einen scharfen Tabaksduft und eine deutliche Spur von Überlegenheit zurücklassend.
Jetzt rinnt Finn Moens rotes Hemd wie eine Blutlache die Wiese hinunter. Karen, die Witwe, steht in all ihrer Ergriffenheit noch immer mitten in der Stube, beugt sich ein wenig vor und schaut mit schiefem Kopf am Geranienstock vorbei. Noch immer flattert ein rührendes kleines Lächeln über ihr Gesicht.
Nach allen diesen Ereignissen wird es Mittagszeit. Monrad kommt heim und sieht den Holzschuh auf dem Tisch, und sagt nein, er habe es nicht getan.
Karen hat wahrscheinlich dieses und nichts anderes erwartet. Sie entgegnet mit ihrer zerknitterten, zagenden Stimme: „Morgen früh mußt du bei Finn ein Stück Leder holen und den Schuh wieder flicken.“
Dagegen hat Monrad nichts einzuwenden. Monrad mußte schon früh durch die Schule des Lebens gehen, und dabei wurde er vor der Zeit reif und reich an Erkenntnissen.
Die steinaltermenschen
Auf irgendeine geheimnisvolle Weise erfuhr der Staat, daß am Strande von Tyremoen eine Schar Kinder glücklich in voller Freiheit herumlief. Der Staat sandte den Lehrer Klagg aus, damit er ihnen die Geheimnisse der Schrift verrate und das Wunder der Zahlen und ihnen außerdem einige gute Beispiele vor Augen führe.
Der Lehrer Klagg kam zweimal im Jahre nach Tyremoen und wohnte natürlich im Hause des Bauern Finn. In der Nordstube versammelte er alle Kinder, und sie mußten sich auf zwei Bänke um den Langtisch setzen. Es ging wahrlich gar nicht lange, so konnten sie auch schon lesen und fast ebensogut mit den Zahlen umgehen wie der Krämer Laurentzen auf Fagarö.
Die Leute von Tyremoen sagten, Klagg sei ein flinker Lehrer und in den Wissenschaften über alle Maßen kundig. Die Kinder aber hatten ihn gern, denn er war nicht streng und strafgierig, sondern übte große Geduld mit allen.
Jedesmal blieb er sechs Wochen lang am Strande von Tyremoen. Und das waren immer frohe Wochen. Es war ein Ereignis. Es war ein richtiges Fest für diesen Ort.
Ottny kochte für den Lehrer Klagg gutes Essen und gab sich viele Mühe mit höflichen Redensarten; ja sie bezähmte sogar diesem Lehrer Klagg gegenüber ihren sparsamen Sinn bis zur Selbstverleugnung und mißgönnte ihm keinen Bissen.
Nach dem Mittagessen legte sich der Lehrer hin und schlief ein Stündchen. Er legte sich auf den Rücken, und sein friedliches Schnarchen verkündete aller Welt, daß hier ein reines Gewissen ruhte. Um diese Stunde war Ottny wahrlich nicht gnädig und unterdrückte mit allen Mitteln gewaltsam jeden Lärm auf fünfzig Schritte im Umkreis. Aber die Kinder bemühten sich aus eigenem gutem Herzen, ihre große Lebensfreude ein Weilchen einzudämmen. Es ist bis dahin noch niemals vorgekommen, daß des Lehrers Schlummer gestört wurde.
Der Lehrer Klagg war in diesen Tagen schon alt und in mehrfacher Hinsicht mangelhaft. Jedoch er ging herum wie ein stilles, gutes Feuerchen, das Licht und Wärme um sich her verbreitete. Wenn einer von Tyremoen irgendeinen schwierigen Fall hatte, mit Krankheit oder Steuerplage, so wartete er in Glaube und Zuversicht bis zu dem Tage, da der Lehrer wieder erschien. Und der Lehrer fand stets einen Rat und sorgte für Hilfe oder Erleichterung.
Auch Jon Sörbö hat sich an den Lehrer gewandt in seiner Not mit dem ewigen Kindersegen. Zweifellos hätte Jon längst eine Staatsrente erhalten, wenn nicht Jenny sich der Einmischung des Lehrers in unbegreiflichem Hochmut widersetzt hätte.
„Wir sind doch nun einmal so erschaffen!“ konnte Jenny lachend rufen. „Wozu wären wir sonst überhaupt da?“ konnte sie fragen. „Und, Jon, sind wir denn vielleicht nicht in der Kirche von einem richtigen Pfarrer getraut und eingesegnet? Gottvater wird am besten wissen, was er alles mit uns vorhat und was er mit unseren Kindern anstellen will.“
Nichts von Staatsgeldern!
Im allgemeinen mißtraute man in Tyremoen dem Staat, diesem unheimlichen Wesen, das sich im verborgenen hielt, Gesetze mit vielen Verboten machte und Gelder einzog und sogar, wenn es ihm beliebte, Tisch und Bett pfänden konnte. Die Leute an diesem Strande begriffen das nicht. Der Lehrer Klagg begriff es wahrscheinlich in seiner Gelehrsamkeit, und er wollte auch Jon beistehen. Aber eine Frau findet gewöhnlich mit verbundenen Augen das richtige Wort, auch wenn sie noch lange nicht so ausstudiert ist wie ein Lehrer. Jenny fand es jedenfalls. Da zog der Lehrer seine Finger zurück. Wie hätte er sich nur vermessen sollen, dem lieben Gott die Arbeit zu verbessern?
Jon, der graue Familienvater, stand hierauf allein mit seiner Klage und seiner Hoffnung. Er verstand nicht die hochmütige Ablehnung Jennys, er verstand nicht die ängstliche Rücksicht des Lehrers Klagg, er verstand vor allem nicht des Himmels unweigerliche Fügung. Daher blieben ihm nichts anderes als Worte und Seufzer übrig. Er benahm sich in dieser Hinsicht sowohl unmännlich als gottlos und vollkommen verkehrt und zog sich zu allem andern den geheimen Spott zu.
Im Winter hatte man in Tyremoen unglaublich viel Zeit. Die Männer wollten es wohl niemals zugeben, weil sie träge waren von Natur aus. Sie sorgten nicht einmal für dürres Brennholz, obgleich der Birkenwald ihnen sozusagen bis vor die Haustür entgegenkam. Wenn die Weiber schimpften und mit dem Kochlöffel rasselten und mit dem Hunger drohten, weil das letzte Scheit im Ofen verbrannt war, erhoben sich die Männer mit vielen Worten, mit Stöhnen und überflüssigem Luftverbrauch und gingen hinauf und fällten einen Baum oder auch zwei. In keinem Falle mehr als drei. Sie schichteten das grüne Holz um den Ofen her auf, wo es unter mächtigem Zischen ein wenig trocknete und manchmal zu glühen begann. Ohne Zweifel hatten besondere Engel die Pflicht übernommen, diese paar Häuser am Strande von Tyremoen vor Feuersbrünsten zu bewahren.
Die Männer mochten noch so gute Ausflüchte finden — gewaltige Rauchwolken, die aus den Schornsteinen stiegen, verrieten sie. Nein, die Männer taten am liebsten nichts. Sie gingen herum und warteten auf den Frühling, warteten auf eine himmlische Fügung, auf ein Wunder, warteten auf irgend etwas. Keinem konnte es einfallen, selber nach einer Gelegenheit Ausschau zu halten, um Geld zu verdienen. Nach der Erfahrung mit dem Fischer Thorgeir hatte keiner mehr die richtige Begeisterung, Reichtümer aus der See zu schöpfen.
Bei gutem Wetter fingen sie sich wohl ein paar Dorsche; aber niemals mehr wurde ein Heilbutt aus seinem Sandbette herausgezogen.
Mit einer unerhörten Kunst hungerten sich diese Leute durch den langen Winter. Doch wenn der Frühling wieder kam, lebten sie alle noch und beteten in ihrer Art die Sonne an. Und vielleicht taten sie dennoch das Rechte und handelten klug. Und vielleicht waren sie sogar weise und glücklich — denn sie waren zufrieden und verlangten nicht nach mehr.
O welche Lebenskünstler! Sie verkauften dem Handelsmann auf Fagarö ein wenig Butter, ein wenig Fleisch, Felle und Wolle, sie gruben Kartoffeln aus der Erde, schnitten Hafer, mähten Gras — so ernährte sie der neunmal gesegnete Boden. Sie brauchten nur bei festlichen Gelegenheiten Zucker, und die Kaffeebrühe war so dünn, daß sie selbst das schwächste Herz nicht anzugreifen vermochte. Der Handelsmann Laurentzen auf Fagarö konnte unmöglich reich werden an solchen Kunden.
O der neunundneunzigmal gesegnete Erdboden! Wie mühte er sich um diese Handvoll Menschen und trug allerorten Früchte.
Trotz mangelhafter Regierung und aller Widerwärtigkeiten mit dem Wetter fanden die Leute ihr Auskommen. Es blieb sogar noch einiges für den Luxus übrig. Zum Beispiel für den schwarzen Kautabak, den der feindselige Staat mit jedem Jahre teurer machte, um den Männern von Tyremoen das Leben vollends zu verbittern. Diese Männer konnten aber nicht nur die langen Wintermonate überwinden, sie wurden auch im Verbrauche des Tabaks die wahren Meister: Zuerst kauten sie ihn, dann trockneten sie ihn und rauchten ihn in der Pfeife — und selbst die Asche noch nahmen sie bei Erkältungen als innerliche Medizin ein.
Außerdem hat ein jedes Haus seine regelrechte Petroleumlampe. Und zur Julzeit braute jeder Bauer ein paar Tonnen Bier. Das Dasein wurde den Männern also doch nicht so ganz unerträglich.
Wenn der Lehrer Klagg so anfangs Dezember erschien, gestaltete sich das Leben sogar ziemlich angenehm. Dann wurden die Weiber sogleich umgänglicher und nahmen feinere Manieren an. Und die Männer konnten sich in der Stube Finns versammeln und Neuigkeiten hören aus aller Welt.
Denn dieser Lehrer Klagg war neben allen seinen anderen Vorzügen auch noch weit gereist, ein richtiger Langwegsfahrer. Mit seinem Bruder Leif, dem Seemann, war er in jungen Jahren sogar einmal bis nach Hamburg gekommen. Das blieb das große Ereignis seines Lebens, an dem er seit vielen Jahren zehrte. Und manch anderer zehrte mit ihm daran. Wenn zum Beispiel alles berichtet war, was sich in Fagarö seit dem Sommer ereignet, und man sich nach allen Leuten des Pfarrortes Hernes erkundigt hatte, wußte der Lehrer gewöhnlich keine Neuigkeiten mehr. Dann durfte nur einer den Kopf heben und fragen: „Und wie trieben es denn die Deutschen — he?
Da war der Lehrer schon wieder obenauf.
„Die Deutschen? — Ja, Gott segne sieǃ Das sind — peinige dich — trotz allem tüchtige Leute! Hingegen ihr Land ist unglaublich. Es ist so flach und eben wie dieser Stubenboden hier. Nichts als Städte und Äcker und pure Industrie und Fleiß und Fortschritt. Und obendrein ein abenteuerliches Klima …“
„Ganz flach also?“ fragte dann wieder einer.
„Vollständig. Kein einziger Berg — nicht einmal soviel wie ein Hügel.“
„Was? Kein Berg? Nun scherzest du aber, guter Lehrer! Wie soll denn das viele Regenwasser ablaufen?“
Oh, der Lehrer Klagg! Da war er also festgesetzt. Er hatte nicht wenig Mühe mit seiner Geographie. Diese Menschen wollten es doch um keinen Preis glauben, daß es eine Welt geben könnte ohne Meer und Felsen — eine Welt ohne viel Wasser und viele, viele Steine. Nein.
Nein, Gott bewahre — und dann diese Einrichtung mit der Eisenbahn und den anderen Erfindungen … Nein, Gott bewahre uns vor diesen unmöglichen Deutschen!
Aber es war dennoch großartig, so dazusitzen, Tabak zu kauen und von all der fremdländischen Teufelei Kunde zu erhalten und sich zu gleicher Zeit so über alle Maßen sicher zu fühlen, geborgen in der herrlichen Kleinheit von Tyremoen, fern von allen den höllischen Maschinen, die Materie und Zeit zerhacken und den Menschen das natürliche Leben rauben …
In Tyremoen fand sich noch Natürlichkeit im Überfluß, und die Zeit lief in normaler Weise ab. Hundert Jahre liefen ab — tausend Jahre … Außer den paar Pfunden Stahl, den Sicherheitsstreichhölzern, den Petroleumlampen, den Kartoffeln und dem Tabak hat sich in Tyremoen kaum etwas verändert…
Die Menschen kommen und gehen. Sie wachsen ihre Zeit wie die Bäume des Waldes. Und wenn ihre Stunde schlägt, sinken sie hin und verwelken.
Der Fischer Thorgeir versank im Meer, ohne Priester und Grabgeläute, und war mit einem einzigen Schritt am Ziel. Andere mußten den Strohtod erleiden; und sie wurden mit dem Großboot an die drei Meilen weit zum Kirchorte Hernes gebracht und in geweihte Erde gesungen.
So liefen die Jahre ab. Jeder Hausvater auf Tyremoen hatte auf dem Dachboden ein paar Särge oder doch zum mindesten trockene Föhrenbretter. Keiner wollte sich gern vom Tod überraschen lassen; denn das blieb eine ernste Angelegenheit für jedermann.
Im übrigen schoren die Frauen ihre Schafe und spannen die Wolle und webten Stoffe und strickten Strümpfe und Genser und Unterkleider und Fäustlinge. Die Männer schnitzelten Holzschuhe und gerbten ihr Leder selber und nähten Stiefel daraus. Oh, ganz fabelhafte Stiefel! Alles miteinander schwere, ehrliche und dauerhafte Ware.
Nicht umsonst ärgerte sich der Handelsmann Laurentzen auf Fagarö über diese Leute. Er nannte sie vor Ärger rückständig. Er nannte sie aus Wut Steinaltermenschen.
Der alte Lehrer Klagg jedoch war gern auf Tyremoen.
„Gutes Volk!“ sagte der Lehrer. „Liebes Volk! — Es ist nicht anders, als sei ich lange fortgewesen — in der Fremde — und habe nun wieder heimgefunden.“
Auf diese Art nahm es der Lehrer Klagg. Das stärkte natürlich den Menschen auf Tyremoen den Rücken und gab ihnen Selbstvertrauen. Sie vergalten es dem Lehrer in mancher Weise. Vor allem ehrten sie ihn und liebten ihn aufrichtigen Herzens.
Der Lehrer Klagg brachte eine große dunkle Brille mit, die setzte er immer auf, sobald die Sonne schien. Und er brachte eine Geige mit. Ein großer Künstler war er wohl nicht. Aber er konnte immerhin ein Lied spielen. Ja, er konnte sogar, wenn das Bier stark und frisch war, einen Halling spielen oder einen Springtanz. Viel Glanz und Freude folgte ihm überall.
Vielleicht war es dieser alte Lehrer Klagg, der die guten halbvergessenen Volkstänze auf die weltverlorene Insel brachte. Man lebte hier eigentlich nur in den wenigen Schulwochen ein wirkliches Leben, mit Geschwätz und Gelächter ab und zu. Die übrige Zeit arbeitete man, oder schlief man. Oder man träumte höchstens.
Das geheimnis
Monrad, der Häuslerbub, stapft das Stortal empor.
Im Stortal gibt es viel Geröll und viel Heidekraut. Die Wacholderbüsche werden hier zu wahren Bäumen. Sie stehen in Gruppen beisammen, dunkel und schlank wie Zypressen, und gemahnen in ihrer feierlichen Ruhe an südliche Gräber.
Die Sonne brennt kräftig zwischen den Hängen; eine vom langen Winterschlaf ausgeruhte Sonne. Meisen zwitschern. Hin und wieder erhebt sich ein Schwarm schillernder Stare und flattert gleich einer unruhigen Wolke vorüber. Hinten auf den höchsten Bergkuppen liegt da und dort noch eine vergessene Handvoll Schnee. Der Himmel über dem allem ist rein und von wahrhaft unergründlicher Tiefe.
Monrad stapft bergan und wird von allen Seiten übergossen von blauen Seligkeiten. Er geht in einem leichten Rausch.
Das alles ist groß und so unfaßbar herrlich, als handle es sich hier um den ersten Frühling und den ersten Knaben, der ein sonnendurchleuchtetes stilles Tal emporsteigt … Hjördis ging eben hier vorbei. — Dort sprang sie über den kleinen Bach. Der schwarze, weiche Moorboden hat den Abdruck ihres Holzschuhs sehr getreu aufbewahrt. Hjördis — das ganze Tal ist erfüllt von ihrer Nähe.
Dieses mag vielleicht doch etwas Großes und in seiner Art Neues sein: Zwei junge Menschen, die in einem einsamen, himmelhellen Tal Zusammentreffen. Zwei Menschenknospen, und Frühling und verheißungsvolle Stille im Walde und ein hoher Weltraum voll unergründlicher Bläue …
Sie treffen einander bei einer steilen Felshalde, die Nova heißt. Die Felsen von Nova werden von der Sonne mehr gewärmt als andere Felsen. Dort ist der Schatten zwischen den hellen Birkenstämmen mit Goldstaub gesättigt und flimmert. Dort ist das Moos trocken. Bald liegen die zwei kleinen Menschenwesen im trockenen Moose nebeneinander und reden.
Sie reden nur von den Schafen, die sie zu den hohen Sommerweiden emporgetrieben haben. Sie reden von den siebenunddreißig Schafen des Hofbauern Finn … Das ist siebenunddreißigmal eine ganz bestimmte Summe Geld — das ist zuverlässiger Wohlstand.
Hjördis weiß das genau. Es handelt sich doch um die Schafe ihres Vaters. Es geht auch ihr eigenes Schaf dabei, ihr kleines Privatvermögen.
„Letztes Jahr hat es zwei Lämmer bekommen“, sagt Hjördis, während sie an einem Grashalm nagt. Ihre feste Hand streicht über das Moos hin. „Auch dieses Frühjahr bekam es zwei Lämmer.“