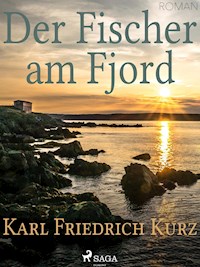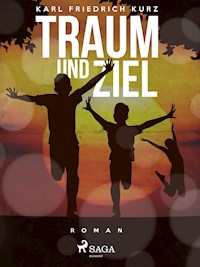
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Kindheit der Lohmanns könnte ein Idyll sein, als die Familie in den Ritterhof zieht. Mit fünf Töchtern kam Großvater Klaus einst mit seiner Frau vom Land in die Stadt. Wovon sie lebten, ließ sich schwer ergründen. Zuweilen arbeiteten sie, zuweilen trieben sie einen kleinen Handel. Irgendwie lebten sie und ernährten sich von einem Tag auf den anderen. Die drei Kinder Werner, Emil und Arnold erkunden das Riesenhaus und den wunderbaren Garten. Emil, dem Lebhaftesten unter ihnen, ist kein Spiel ist zu wild, keine Idee zu waghalsig. Arnold, der Jüngste, steht zwischen ihm und Werner, dem sensiblen und künstlerisch veranlagten Erstgeborenen einer der Töchter von Lohmann. Die neue Unterkunft hat aber Konrad, das Findelkind, erkundet. Ein Mädchen, das vielleicht einen lockeren Lebenswandel führte, brachte ihn ins Haus und verschwand für immer. Doch das Idyll ist überschattet durch die Brutalität des Vaters Hannes Frank, der als Oberhaupt der Familie seine Macht mit Schlägen untermauert. Zwischen Traum und dem Glück als Ziel schwankt das Leben der Familie: Falschgeld wird gefunden und verloren, eine Puppe wird zum Symbol einer heimlichen Jugendliebe, ein Geschäft bringt Gewinn und Verlust, eine Drogistenlehre verbrennt Arme und bringt den Tod. In den Töchtern der italienischen Familie, die eines Tages mit einzieht, liegt die gleiche Zukunft wie in Werners heimlich gemalten Bildern und Emils Machtgelüsten. Man kann seine Kindheit nicht abstreifen wie Staub: der Schatten bleibt ...Kindheit zwischen Traum und Wirklichkeit – eine grausame Familiengeschichte.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karl Friedrich Kurz
Traum und Ziel
Roman
11.–14. Tausend
Saga
Traum und Ziel
© 1940 Karl Friedrich Kurz
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711518434
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Ein Schatten am Fenster
Dumpfglühend wie der aufgehende Mond schwebt ein Fenster durch die Nacht.
Es ist kühl hier und still. In den Wolkenhimmel ragt verwischt ein Dach, halbverdeckt von der schwarzen Krone des riesigen Kastanienbaumes, der sich reglos gegen das Haus hinneigt, als wolle er ein Geheimnis belauschen.
Ein Schatten gleitet über die Gardinen.
Dieses Fenster und dieser Schatten scheinen das letzte, das einzige, was von der Wirklichkeit der Dinge zurückblieb. Die übrige Welt zerfloss in Formlosigkeit. Alles Leben ging unter in einer drückenden, unheilvoll lauernden Stille, die erfüllt ist vom verhaltenen Brausen des Stroms.
Nur ein verhangenes Fenster, über das in regelmässigen Zwischenräumen ein Schatten gleitet. Nichts als ein Zimmer, in dem ein Licht brennt. Ein Zimmer, in dem ein Mensch ruhelos wandert.
Zuweilen kommen aus der nahen Stadt die Stundenschläge. Tiefe Glockentöne, sie springen irgendwo in der Finsternis auf und tauchen wieder in der Finsternis unter.
Der junge Gärtner Alois bemerkte das erleuchtete Fenster und den gleitenden Schatten an der Gardine schon am Abend, als er zu seiner Liebsten ging. Nun kehrt der Gärtner von seiner Liebsten zurück, und der Schatten gleitet immer noch über die Gardinen. Alois hat gute Augen und mancherlei Gedanken in seinem Kopf. Stark und süss duftet der Jasmin, und der Gärtner murmelt: „Dort marschiert er wieder ... Marschiere immerzu, grosser Mann ...“
Gegen drei Uhr erlischt das Licht hinter dem Fenster; es erlischt nicht jäh, auf einen Schlag, sondern mit einer zaudernden Gemächlichkeit.
In dieser Nacht nahm der lange Marsch des Herrn Bondorf ein Ende. Irgendwie kam es — vielleicht war der Herr geistesabwesend, oder es lag ein kleiner Fehler am Gashahn. Am Morgen erwachte Herr Bondorf nicht mehr. Ein wenig verkrümmt lag er in seinem prächtigen Mahagonibett, lag unter der gelben Seidendecke und hatte einen bläulichen Schimmer im Gesicht. Neben ihm lag seine Frau, die noch immer jugendliche und ungeheuer stolze Madame Bondorf, die nur Französisch sprechen wollte und eine verwegene Reiterin war. Ja, da lag nun auch sie, blauschimmernd und sonderbar.
Das Zimmermädchen entdeckte die Sache. Wie jeden Morgen ging es mit dem heissen Kaffee ins Schlafzimmer, trat leise ans Bett, stiess einen pfeifenden Schrei aus und lief zur Köchin. Die Köchin, eine alte, abergläubische Person, rannte fort, den Gärtner zu suchen. „Oh, meine arme, sündige Seele!“ heulte sie und riss die Haustür auf. Ein frischer Nordwind sprang sie an und presste ihr den Rock gegen Bauch und Beine. In den Tannen sauste und fauchte es. Da und dort erhob sich vom Boden ein vom Winter vergessenes Laubblatt wie eine kleine, dunkle Hand, die schnell nach etwas haschte und wieder in die Erde zurücksank. Das alles schien der Köchin befremdlich und unheilkündend; dazu die Gestalt des Gärtners, von dem sie nur den langen, schmalen Rücken sah und eckige Schultern ohne Kopf. „Nicht umsonst zeigte sich das graue Garnknäuel“, seufzte sie. „Das bedeutet Unglück ... Alo—is!“
Der Gärtner kniete vor einem Blumenbeet, hörte den Ruf der Köchin, hörte auch ihre Schritte. Ohne aufzublicken, brummte er: „Was will es schon wieder, das dicke Halleluja ...“
„Alois — schnell ...“
„Was plagt dich?“
„Schnell, um Gottes willen — vielleicht ist noch ein Restlein Leben in ihnen.“
„Jetzt glaube ich aber — alte Angstflasche ... Wo brennt es?“
„Diesmal handelt es sich um ein Verbrechen ...“
In seinen groben, schmutzigen Stiefeln stapft Alois über den Perserteppich, streckt überaus gespannt den Kopf vor, schnuppert: „Hier riecht es verdächtig nach Gas und anderer Pestilenz.“
„Ja“, flüstert das Zimmermädchen.
„Hast du das Fenster geöffnet, Sophie?“
„Ja.“
„Und der Gashahn?“
„Den schloss ich.“
„Dann bleibt weiter nichts mehr zu tun“, entscheidet der Gärtner.
Blass und verstört schielt das Zimmermädchen hinter seiner Schürze hervor. „Leise — leise“, mahnt es.
Alois richtet seine grauen, klugen Augen auf das Bett, hebt mit zwei Fingern Frau Bondorfs weisse Hand von der Decke auf; hölzern folgt von der Schulter an der ganze Arm mit. Im Niederfallen schlägt die Hand dumpf gegen den Bettrand.
„Lass das!“ ruft entsetzt das Zimmermädchen.
„Sie merkt nichts mehr davon. Und hier gibt es nichts mehr zu flüstern, Sophie. Von diesen beiden ist eins genau so tot wie das andere.“
„Tot?“
„Schon kalt und steif.“
„Tot?“ wiederholt die Zofe atemlos.
„Das kannst du wohl selber sehen. Dabei ist nichts mehr zu machen. Natürlich muss man den Arzt holen. Aber zu machen ist nichts. Dieses hier muss sich kurz nach zwei Uhr zugetragen haben.“
„Schweig!“ stöhnt die Zofe. „Stets bist du so frech ... Geh hinaus!“
Alois geht. Bei der Tür dreht er sich noch einmal um, lässt seinen Blick missbilligend durch das prächtige Zimmer schweifen und sagt: „Kann man denn in einem solchen Raum sterben? Sollten diese beiden je in den Himmel kommen, werden sie es dort nicht besser treffen.“
Alois holte den Arzt. Es war nichts mehr zu machen. Der grosse Weinhändler Bondorf und seine Frau hatten diese Welt still verlassen.
Ein blosser Zufall vielleicht, oder ein Unglück aus Unachtsamkeit? Als die Obrigkeit erschien und strenge Nachforschung hielt, kamen gar sonderbare Dinge zutage. Die Bücher stimmten nicht. Wo stimmte es in diesem vornehmen Haus? Es fehlte überhaupt an allem und jeglichem — keine Barschaft, kein Bankguthaben, keine Forderungen, dafür gewaltige Schulden. Es wurde ein fürchterlicher Zusammenbruch.
Alma, das einzige Töchterlein, wäre über Nacht zum ärmsten Bettelkind geworden, wenn Frau Bondorf diese Schande nicht im allerletzten Augenblicke noch verhindert hätte. Sie gab ihren Schmuck her und versicherte ihr Leben; dieserart verhinderte sie es.
Merkwürdige Menschen. Harte Menschen. Stolze Menschen. Geldmenschen — das Leben gefiel ihnen gut in dieser Welt, solange ihre Kasse gefüllt war. Sobald der Reichtum verlorenging, verzweifelten sie, und das Leben gefiel ihnen nicht länger.
Ein grosses Gerede und Gerate hub an. Die Leute können nachträglich urteilen und verdammen. Die Leute wissen vielleicht einiges. Doch sie wissen nicht, was diese beiden gelitten, bis sie sich zum letzten Entschlusse durchgerungen. Niemand erfuhr etwas von den langen Gesprächen in den Frühlingsnächten, als der Schatten am Fenster hin und her glitt. Aber da sie nun tot waren, begrub man sie.
Von den vielen Freunden ihrer Licht- und Glanzzeit gaben ihnen nur wenige das Geleit zum Friedhof. Die Bondorfs hatten vielleicht recht in ihrer Weise: sie wussten, dass sie mit Geld geachtet und mächtig waren. Ohne Geld waren sie nichts.
Das grosse Haus wurde völlig ausgeräumt, vom Keller bis zum Dachboden, und alles kam unter den Hammer, alle Möbel und Teppiche und die Gemälde an den Wänden. Alles wurde fortgeführt; auch das Mahagonibett. Der Weinhändler und seine Frau starben jung; sie standen kaum im Sommer ihres Lebens. Nachträglich hiess es, ihr Leben sei der unverschämteste Schwindel gewesen. Die vielen Fässer, die man aus den weitläufigen Kellern heraufholte, waren teils völlig leer, teils mit blankem Wasser gefüllt.
Auch das Haus und der grosse schöne Garten kamen unter den Hammer und wurden zu einem Spottpreis losgeschlagen; denn niemand wollte das Haus der Selbstmörder haben, obschon man einen prächtigeren Besitz in der Gegend kaum finden konnte. Seit alters her nannte man ihn Ritterhof. Es hiess, einmal habe hier ein gewaltiger Mann, ein Ritter, gelebt, der sei im Kampf mit den Bauern vor den Toren der Stadt erschlagen worden. Damals war der Ritterhof eine Burg mit Turm und starken Mauern. Später wurde daraus ein Dominikanerkloster.
Alte Häuser haben ihre Geschichte. In der Klosterzeit entstanden unter dem Ritterhof die ungeheuren Keller. Die Leute behaupten, es führe ein Gang unter dem Rhein von einem Ufer zum anderen; aber er sei längst verschüttet; und es gebe im letzten Keller eine Treppe, auf der einst viele Menschen niederstiegen, aber keiner mehr heraufkam. Ausserdem gab es die Geschichte von einem Mönch. Möglicherweise war das eine neue Geschichte, von der Köchin Margarete erfunden und in Umlauf gesetzt.
„Oh, oh — ein grauer Mönch in langer Kutte!“ sagte Margarete. „Er schritt über den Hof; er schritt am Haus vorüber und schaute von der Terrasse her ins Kontorfenster. Er lehnt am Fenster — und auf einmal ist er nicht mehr da. Aber von der Stelle aus rollt ein graues Garnknäuel, rollt über den Weg und verschwindet bei der Tujahecke ...“
Drei Abende hintereinander sah die Köchin Margarete sowohl Mönch als Garnknäuel. Darauf starb die Herrschaft. Gewiss nur sinnloses Geschwätz einer alten, abergläubischen Person; doch es erfüllte einen geheimen Zweck. Es brachte den Ritterhof in der ganzen Stadt in Verruf.
Das Töchterlein Alma zog zu ihrem Onkel, der ebenfalls ein Händler und grosser Herr war und in derselben Strasse wohnte. Alma zählte vierzehn Sommer, schmal und blond war sie und überaus fein, dabei schon etwas damenhaft. Man sah sie von dieser Zeit an nur noch in schwarzen Kleidern, als richtige Waise, blass, still und traurig. Man betrachtete sie scheu und hatte Mitleid mit ihr, weil ein hartes Schicksal sie so früh getroffen. Niemand trug dem Kind nach, was die Eltern gesündigt. Selbst die wilde Strassenjugend unterbrach ihre lärmenden Spiele, wenn Alma, wie ein Schatten der Nacht, an ihnen vorbeiglitt.
Der Ritterhof versank in Schweigen; verlassen lag der schöne Garten. Doch der Frühling brauste durch die Welt und lockte bunte Wunder aus der geheimnisvollen Tiefe der Erde, auch wenn die Blumen niemand zur Freude blühten.
Der neue Besitzer des Ritterhofs meinte, das sei ein sinnloser Zustand. Es gelang ihm, weder die Besitzung zu verkaufen noch zu vermieten. Kein einziger Liebhaber meldete sich für das Gespensterhaus.
Woche um Woche ging. Dieselbe Totenstille im Haus. Im Garten verwelkten die Blumen; das Unkraut machte sich frech über alle Wege und Plätze her. Nur die Obstbäume trugen in stiller Güte ihre Früchte.
Der Geheimnisvolle
Verborgene Fäden knüpfen ferne Dinge zusammen. Alles hat seine Bedeutung. Die Bondorfs starben; sie machten im Ritterhof Platz für die Lohmanns. Ein ganz verwickelter Zug im grossen Spiel.
In den Tagen, da im verlassenen Garten die Äpfel reiften, wurde die Familie Lohmann von einem hartherzigen Hausbesitzer auf die Strasse geworfen. Diese zahlreiche und sprachgewaltige Familie bezahlte ihre Miete höchst mangelhaft und wurde von den Hausbesitzern verachtet und von den Nachbarn gefürchtet.
Klaus Lohmann, der Grossvater, ein buckliges, mageres Männchen, das stets mit dem Kopf wackelte, zog einst mit seiner Frau und fünf Töchtern vom Lande in die Stadt. Klaus selber führte ein Schattendasein, ging in der Stube aus und ein, setzte sich an den Tisch, beteiligte sich selten an der Unterhaltung. Sein Wort fand von niemand Beachtung. Sie nannten ihn den Ältesten; doch es lag keine Ehre in diesem Titel.
Wovon die Lohmanns lebten, liess sich schwer ergründen. Zuweilen arbeiteten sie, zuweilen trieben sie einen kleinen Handel, meistens arbeiteten sie nicht. Sie lebten irgendwie und ernährten sich von einem Tag auf den anderen.
Bald nach ihrer Ankunft in der Stadt fand die Tochter Barbara einen Bräutigam, der Lorentz hiess und sogleich starb. Nachdem er gestorben war, widmete sich die Tochter Barbara der Trauer um ihn, nannte ihn Lorentz selig und nähte nebenbei ein wenig.
Die zweite Tochter heiratete einen Eisenbahner und bekam schnell nacheinander drei Buben — Werner, Emil und Arnold. Damit hörte die Fortpflanzung der Familie Lohmann auf. Sie vermehrte sich jedoch noch auf diese Weise, dass ein Mädchen, das vielleicht einen lockeren Lebenswandel führte, den Knaben Konrad ins Haus brachte und hernach wieder spurlos in der Ferne verschwand.
Konrad zählte zwei Jahre mehr als Werner. Er war gewiss ein Kind der Sünde. Er hatte ein stilles, erschreckend blasses Gesicht und darin ein paar treue blaue Augen. Die drei Knaben umschlichen ihn, betrachteten ihn eingehend; darauf zogen sie sich in ihre Dachkammer zurück.
Emil sagt: „Das ist der Sohn des Geheimnisvollen.“
„Jetzt schwafelst du wieder“, erklärt Werner, indes er sich müht, das Werk einer alten Schwarzwälder Uhr in Gang zu bringen.
„Zuweilen, in der Dämmerung, spricht er mit mir“, sagt Emil weiter.
Die Schwarzwälder Uhr beginnt rasselnd zu schlagen, schneller oder langsamer, je nachdem Werner an der Kette zieht.
Emil sagt: „Er heisst Konrad. Weisst du, warum?“
Keine Antwort.
„Weil er das uneheliche Kind einer Stallmagd und eines Grafen ist“, fährt Emil unbeirrt fort.
„Woher weisst du das?“ fragt Werner.
„Ich weiss es. Ein Fluch lastet auf ihm.“
„Wer sollte ihn denn verflucht haben?“
„Der Vater des Grafen. Niemand weiss das, nur ich allein. Darauf nahm Konrads Vater eine Pistole und schoss sich tot.“
„Er schoss sich selber tot? Keine Spur.“
„Doch. Auch ich werde mich einmal totschiessen. Ich weiss das alles In Konrad fliesst blaues Blut.“
„Wo kann man das sehen?“
„An den Schläfen. Vielleicht werde ich einmal eine Gräfin heiraten. Soviel ist mir schon verraten worden.“
„Wer hat es dir verraten?“
„Im Traum ...“
Arnold, der jüngste, klettert auf eine grosse, leere Kiste; vorgebeugt, die Hände in den Hosentaschen, lauscht er gespannt und füllt mit der Zungenspitze die Backe aus, so dass eine Beule entsteht. Wenn ihm Emils Rede besonders gefällt, trommelt er mit den Fersen auf die Kiste.
Emil war damals zehn Jahre alt. Sie gingen alle in die Stube hinunter und betrachteten den Knaben Konrad nochmals eingehend, die hohe Stirn und die Äderchen an den Schläfen. Es stimmte. Er hatte blaues Blut. Er war geheimnisvoll.
„Was soll aus diesem Knaben werden?“ fragte Hannes Frank, der Eisenbahner, mit bösen Falten zwischen den Augenbrauen. „Sind nicht schon mehr als genug unnütze Mäuler vorhanden?“
Aber die Lohmanntochter Elisa war ein mündiges Frauenzimmer; sie hatte ein kleines Gesicht, eine spitze Nase und einen schmalen, geraden Strich darunter; sie sagte zu Hannes Frank: „Du solltest dich vor dir selber schämen! Schweig und sieh seine Augen an!“
„Darauf pfeif’ ich“, sagte Hannes. „Mit seinen Augen wird er sich den Bauch nicht füllen.“
„Ob einer mehr oder weniger mit uns isst, hat nichts zu bedeuten.“
Offenbar hatte das dennoch etwas zu bedeuten. Denn es entwickelte sich daraus einer der unzähligen Wortwechsel mit Tischklopfen, Fluchen und Türschmettern. Das Ende vom Spektakel war, dass der Knabe Konrad in die Familie Lohmann aufgenommen wurde. Der Herr im Himmel sorgt in unversiegbarer Güte für seine Kinder.
Es ging. Die Lohmanns ernährten sich immerzu. Es ging durch alle Jahreszeiten. Zumeist ging es mit Brot und dünnem Kaffee und noch dünnerer Wassersuppe. Manchmal ging es fast wie durch ein Wunder. Die Lohmanns kämpften mit dem Schicksal und erhielten sich am Leben. Disteln gleich standen sie am Rande der Wüste und lebten von Licht und Luft und gar nichts. Wahre Meister des Sparens und des Hungerns, überaus fromme Seelen. Wenn alles Bargeld ausging, sagten sie: „Gott wird weiterhelfen.“ Und ihr Glaube wurde nicht zuschanden. Zu Hannes Frank, der sich mit groben Worten gegen den Niemandssohn Konrad versündigte, sagten die Frauen: „Wohltun trägt Zinsen.“
Die Entwicklung der Dinge gab den Frauen recht. Denn kein anderer als Konrad war es, der die Kunde vom leeren Ritterhof ins Haus brachte. Konrad trieb sich oft auf der Strasse herum und verfolgte mit seinen hellen Augen das Treiben der Menschen, reif für sein Alter, wie Kinder der Armut oft zu sein pflegen.
Konrad rannte in die Stube und hatte vor Aufregung rote Flecke auf beiden Wangen; gerade an dem Morgen, da die Lohmanns obdachlos werden sollten. „Wir können in den Ritterhof ziehen“, sagte Konrad.
„Bist du verrückt?“ fragten die Frauen.
„Nein, nein ... Kein Mensch will im Ritterhof wohnen. Ich könnte den Eigentümer fragen, den Herrn Mayer; sein Sohn ist in meiner Klasse, ich helfe ihm bei den Aufgaben; ich war schon bei ihm daheim.“
„Ja, du ... Geh nur!“ riefen sie.
Ein Wunder geschah. Der blasse Junge Konrad vollbrachte es.
Floss wirklich blaues Blut in ihm? Verfügte er über ungewöhnliche Geisteskräfte? Ach, vielleicht war das Wunder nicht gar so gross. Der Besitzer dachte wohl, eine kleine, selbst eine unsichere Miete sei besser als gar keine Miete. „Gut. Ihr könnt sofort einziehen“, sagte Herr Mayer.
Schon in derselben Nacht schliefen die Lohmanns in den einstigen Rittersälen, in den vornehmen Räumen, die seltsam nach Reichtum, Gas und Tod rochen. Anstatt in einer engen Dachkammer wie Schafe zusammengepfercht, lagen die vier Buben mit grösster Raumverschwendung in einem hohen, weiten Prunkgemach. Von allen Wänden strahlten fast gewandlose Göttinnen; und es gab da Märchenwälder, durch die fabelhafte Tiere schritten.
Werner wurde von der zauberhaften Umwandlung am meisten ergriffen. Mit dem ersten Morgendämmer erwachte er und sah staunend die unerhörte Pracht der bemalten Wände aus den Schatten der Nacht hervorwachsen. Dieser Erstgeborene, Werner, schlug sicherlich aus der Art; er glich weder seinen Brüdern noch irgendeinem der Lohmannsippe. Nur er hatte dieses schmale Gesicht mit der breiten, kantigen und eigenwilligen Stirn. Ein merkwürdiger Träumer von früh an. Seine braunen Augen schienen stets in der Ferne zu suchen. Seine Freude bestand darin, Papier und Holzstücke, ja sogar die Wände mit Zeichnungen zu bedecken.
Ergriffen wurden sie wohl alle. Die neue Umgebung wirkte auf sie in eigentümlicher Weise. Man hätte glauben können, das alte Ritterschloss ziehe diese Menschen zu sich empor. Ein neuer Geist fuhr in sie; sie sprachen behutsamer und bezähmten die Gewalt ihrer Stimmen. Die Vornehmheit des alten Hauses betörte sie.
Am Morgen fragte Elisa, die mit der spitzen Nase, ihren Schwager, mit dem sie sonst allezeit auf Kriegsfuss stand: „Nun, lieber Hannes?“ Und das fragte sie sicherlich reinen Herzens. Sie wollte wohl darauf hinweisen, dass die ganze Herrlichkeit Konrads Werk sei. „Ohne seine Hilfe hättest du niemals in diesem Schloss übernachten dürfen“, sagte sie.
Zu gewöhnlichen Zeiten — ja, weiss der Henker — hätte eine solche Frage Hannes Frank, das Oberhaupt, in hellem Zorn aufflammen lassen, und die entsprechende Erwiderung wäre bestimmt gefallen. An diesem gnadenreichen Morgen jedoch wollte er sich nicht versündigen, sondern nickte zur allgemeinen Verblüffung Elisa nachsichtig zu.
Trotz ihrer scharfen Nasenspitze und dem dünnen Strich darunter wollte Elisa nicht eine von der Sorte sein, die Gutes mit Bösem vergalt. Darum erwies sie dem Schwager Ehre. „Ja, du, Hannes“, sagte sie, „du bist ein so kluger Mensch und bewandert in vielen Dingen. Könntest du uns erklären, was die unverschämten Malereien im Zimmer der Buben darstellen?“
„Das“, antwortete der Schwager Hannes, ohne sich lange zu besinnen, „das sind Sachen aus der biblischen Geschichte.“
„Alle diese nackten, ausgelassenen Frauenzimmer, du, Hannes?“ Nein, Elisa zweifelte; und vielleicht war selbst zu dieser guten Stunde ihr Herz doch nicht ganz frei von schlimmen Hintergedanken. Sie wollte dem Schwager eine Falle stellen.
Wenn aber der Schwager in Elisas Falle fiel, so blieb er immerhin noch der Mann, der wieder darauskrabbelte. Breit und sicher stellte er sich vor dem Märchenwalde auf und fragte: „Hast du vielleicht je etwas von einem weltberühmten Maler gehört, der Raffael hiess?“
Ja, nun starrte Elisa in die leere Luft.
„Also dieser Maler“, verkündete Hannes Frank, „malte viele Bilder. Und alle malte er für den Papst in Rom. Im Palast des Papstes sind mehr als tausend Zimmer, wenn du bei dieser Gelegenheit auch noch dieses wissen möchtest. Und auf alle Wände der tausend Zimmer malte der Maler Raffael seine Bilder. Darunter gibt es manche Frauenzimmer, die noch weniger auf dem Leibe haben als diese hier.“
Die Knaben stehen dabei und spitzen ihre Ohren. Konrad horcht mit schiefem Kopfe auf das, was Hannes Frank vom Maler Raffael und den tausend Zimmern des Papstes erzählt, und er zwinkert Werner heimlich zu.
Aber Elisa, das streitlustige Frauenzimmer, lacht frech. „Hihi, Hannes — das magst du nur selber glauben. Hihihi“, lacht Elisa zweideutig. „Bist du vielleicht schon einmal in Rom beim Papst gewesen?“
Zwischen Hannes Franks Brauen erscheint die gefürchtete Falte, und die Unterredung hätte gewiss, allem Wohlwollen zum Trotz, mit einem Streit geendet, wenn im allerletzten Augenblick eine helle Knabenstimme dies nicht verhütet hätte. „Ich habe Talent. Ich will Künstler werden. Ein grosser Raffael. Ich werde berühmt. Ich will viele Bilder malen ...“
Der Knabe Werner sagte das. Er sagte es nur zu sich selber. Es sprang plötzlich als ein heftiger Schrei aus seiner innersten Seele. Mit seinen dreizehn Sommern wandelte er noch gläubigen Herzens durchs Wunderland, wo alles möglich ist.
„Haha!“ Der Vater Hannes lacht und blickt aus grosser Höhe hernieder auf seinen kühnen Sprössling. „Haha — grüner Scherenschleifer!“
Und „Hihi“ lachen die Frauen. Die Frauen lachen viel lauter als nötig und ziehen die kampffreudige Elisa aus der vordersten Frontlinie. Immer ist ein bisschen Diplomatie und Strategie im Handeln der Frauen — diesmal vermeiden sie einen Krieg.
Das Glück
Die Brüder fanden Werner am Stamm des alten Kastanienbaums, aus dessen dunkler Krone die braunen, blanken Früchte niederfielen, obschon sich kein Windhauch regte. „Was treibst du?“ fragten sie. „Jetzt wollen wir das Haus untersuchen!“ riefen sie und hüpften von einem Bein aufs andere. „Komm ...“
Sie liefen durch alle Räume vom Keller bis zum Estrich, wie Diebe, wie Forscher, wie Eroberer. Wo eine Tür sich fand, wurde sie geöffnet. In jedem Winkel suchten sie das Abenteuer und fanden es. Manches, was den forschenden Blicken der Obrigkeit verborgen blieb, das stöberten acht scharfe Knabenaugen auf. Beutegierig fielen sie überall ein, Sieger in Feindesland. Sie trommelten mit ihren Fäusten gegen die Wände und entdeckten geheime Schränke hinter den Tapeten. Es war eine Fahrt in eine neue Welt, ins Märchenland, ins Niemandsland. Eine herrliche Stunde. Wohl ward ihnen nicht beschieden, grosse Reichtümer zu erobern. Aber Emil fand einen Hammer und eine verrostete Säge.
Die unsichtbaren Mächte, die aller Wissenschaft zum Hohn im verborgenen die Welt regieren, führten Werner in des toten Herrn Bondorfs Kontor, zum breiten Fenstergesims, das sich hochheben liess. Da lag eine Menge weisses Papier, grosse und kleine Blätter, und Farbenstifte. Da lagen ein paar merkwürdige Zeichnungen. Verwunderliche Zeichnungen; sie glichen Geldscheinen, riesenhaften Banknoten; bald eine Vorderseite, bald eine Hinterseite.
Was? Sollte der selige Herr Bondorf in den Tagen, als der Weinhandel flau ging, sich mit solchen Spielereien die Zeit vertrieben haben? Nummern, Namen, Unterschriften — Hundert Franken zahlt die Bundesbank dem Überbringer in Gold ...
Werner schob die überlebensgrossen Banknoten in eine Spalte zwischen dem Paneel. Heisse Freude im Herzen, zog er mit Papier und Stiften davon; gerade in dem Augenblick, da Arnold im Nebenzimmer einen schmetternden Jubelschrei ausstiess, denn er hatte zwei Kistchen Zigarren mit Bauchbinden gefunden.
Aber Konrad fand ein Geheimnis, etwas, das er schnell unter seinem Kittel verbarg und damit verschwand.
Es wurde der glücklichste Morgen im Leben der vier Knaben. Und aus dem Morgen wurde ein glücklicher Mittag. Emil fand zu seinem Hammer in einem der oberen Lagerkeller ein leeres Fass, das herrlich nach süssem Wein und verbotenen Genüssen duftete.
Gemeinsam wälzten sie das Fass ans Ufer des Rheins, in ein Akaziengestrüpp, das für gewöhnliche Menschen und jedenfalls für Erwachsene völlig unzugänglich und somit zu geheimem Treiben hervorragend geeignet war. Emil schlug mit seinem Hammer ein paar Reifen los, schlug den Boden ein. Da zeigte es sich, dass das Fass noch nicht völlig leer und unschuldig war. Eine braungoldene Flüssigkeit, herrlich und süss nach Blüten und Sonne duftend, schimmerte auf dem Grunde. Nicht viel, keine Eimer oder Kannen voll; doch immerhin genug, es mit einer leeren Blechbüchse auszuschöpfen.
„Vielleicht ist es Gift“, meinte der besinnliche Werner. „Wirf es weg, Emil!“
„Wegwerfen? Bist du bei klarem Verstande, Mensch?“ widersprach Emil unternehmungslustig. „Ja, das sollte nur fehlen, Mensch. Ich kann dir soviel verraten, dieses ist der herrlichste Wein von der Welt. Königswein.“ Emil spuckte zischend durch die Zähne und behauptete: „Gift, lieber Mensch, riecht meiner Seel nicht so, sondern anders. Versuch du es zuerst, Arnold!“
Der kleine, dicke und rothaarige Arnold glaubte mit seinen acht Jahren nicht an Gift und Tod und die unzähligen Gefahren des Lebens. Oh, im Gegenteil. Ihm bedeutete es eine Auszeichnung, als erster zu trinken.
Werner rief ängstlich: „Trink nicht!“
Bis dahin beteiligte sich Konrad nicht an der Untersuchung des Fasses, sondern lag nur auf dem Rücken und schaute verträumt in den Himmel, der sich zwischen dem Gewirr der Akazienzweige öffnete. Vielleicht erblickte er dort eine Himmelsleiter, und sicherlich war er fern den Begebenheiten dieser Erde. Erst Werners aufgeregtes Rufen zog ihn zurück zu den gewöhnlichen Dingen. „Lass ihn doch“, sagte er gleichmütig, ohne den Kopf zu drehen. „Es ist Malagawein.“
„Wer behauptet das?“ fragte Emil verblüfft.
„Das steht eingebrannt im Fassboden.“
„Hurra — gib die Büchse her!“ schrie Emil und entriss sie Arnolds Händen. „Ja, natürlich ist es Malagawein. Das hab’ ich gleich gewusst.“ Nun trank Emil zuerst und in langen Zügen. Er verdrehte dabei die Augen vor Wonne. „Nein, Mensch — dass es so guten Wein geben darf“, jauchzte er. „Bring jetzt deine Zigarren, Arnold“, befahl er. „Denn jetzt soll hier ein Jubiläum abgehalten werden.“
Sie tranken wie Männer und rauchten wie Männer. Und eine Weile mundete ihnen dieses Treiben ausgezeichnet. Bis Arnold sehr weiss im Gesicht wurde und ins Gras sank. „So — jetzt sterbe ich“, stöhnte er, warf die prächtige Zigarre fort und erbrach sich furchtbar.
Emil beobachtete ihn ängstlich und erklärte: „Ich glaube, auch mir wird übel ... Es war also doch Gift! Wenn wir jetzt sterben müssen, ist es deine Schuld, Konrad.“
Aber Konrad befand sich wieder auf der Himmelsleiter; ausserdem hatte er schon einige Erfahrung gesammelt im Leben. Beschwichtigend erklärte er: „Das kommt vom Rauchen. Bleibt ein Weilchen ruhig liegen, dann wird euch wieder wohler.“
Sie lagen unter den Akazien und stöhnten. Sie bezahlten ihre grosse Freude. Doch sie starben nicht daran.
Gegen den Abend hin kehrten sie ins Haus zurück, auf wackeligen Beinen, mit grünen Gesichtern. „Allmächtiger Himmel — wie seht ihr aus!“ riefen die Frauen.
„Ho — das ist schon gar nichts mehr“, erklärte Emil. „Ihr hättet uns früher sehen sollen! Wir haben nur ein paar unreife Äpfel gegessen.“
Hierauf kehrte Hannes Frank von seinem Dienst zurück und vernahm das von den Äpfeln. Als Mann und Herrscher rief er: „Ich hätte grosse Lust, euch alle vier gründlich zu verhauen, damit in Zukunft die Äpfel an den Bäumen hängen und reifen können. Was seid ihr doch für verfluchte Taugenichtse.“ Nach seiner Gewohnheit ass er schnell, redete sich nebenbei in Wut und geriet in die rechte Stimmung.
Um den Vater von seinem Vorhaben abzulenken, rief Emil: „Wir haben viele gute Sachen gefunden.“
„Was habt ihr gefunden?“
„Werner fand eine Menge Papier und Farbenstifte.“
„Papier!“ sagte Hannes Frank verächtlich. „Wartet nur, ihr Schlingel, bis ich fertig bin ...“
„Und Arnold fand zwei Kisten Zigarren.“
„Hol sie!“
Willig lieferte Arnold seine Zigarren ab. Sein Herz hing nicht länger daran.
„Das sind feine Zigarren“, nickt Hannes Frank versöhnlich. „Aber ich verhau’ euch doch. — Sonst noch etwas?“
„Ein Hammer und eine Säge.“
„Gut. Her damit!“
Der rote Arnold starrte auf des Vaters Teller, der schon fast leer war; verzweifelt rief er mit seiner kleinen Krähstimme: „Konrad hat etwas anderes gefunden.“
Tiefe Stille um den langen Tisch. Alle Augen richteten sich auf Konrad. In kalter Ruhe fragt Hannes Frank: „Was hast du gefunden?“
Da wird Konrads Gesicht dunkel; gleich darauf wird es noch bleicher als gewöhnlich. Arnold senkt den Kopf und schweigt.
„Komm doch einmal zu mir herüber, Bürschlein!“ befiehlt Hannes Frank unheimlich leise.
Sogleich lässt Konrad den Löffel in den Teller fallen und erhebt sich. Mit kurzen, ungelenken Schritten schleicht er der Wand entlang, und es läuft ein heftiges Beben durch seinen mageren Körper.
„Er hat nichts gefunden. Ich habe nichts gesehen“, ruft Werner angstvoll. „Ich war die ganze Zeit bei ihm.“
Zu seinem Unglück sitzt Werner an der Seite des Vaters, darum erhält er den ersten Schlag, so dass vor seinen Augen rote Funken stieben. Werner presst beide Hände vors Gesicht. Aber in seine Ohren dringt die fürchterliche Stimme des Richters: „Wer hat dich gefragt, Strolch?“ Und nun ist Hannes Frank mit dem Essen fertig. Er säubert den Löffel mit der Zunge, schmatzt und richtet den Blick auf Konrad. Fast gemütlich fragt er: „Nun, Jüngling, wie steht es mit deiner Zunge? Ich werde sie dir wohl lösen müssen.“ Dabei löst er selber den Leibriemen. „Also ...“
„Nichts“, flüstert Konrad kaum vernehmlich.
„Seht — hier steht der Lügner!“ Förmlich frohlockend ruft Hannes Frank — und eigentlich gilt das der Schwägerin Elisa für ihre Bemerkung vom Morgen, die noch nicht vergessen ist. Hannes streckt seine Faust nach dem schlotternden Opfer, dreht es um. „Seht euch ihn an! Seht euch ihn genau an, von allen Seiten, ihn, dem wir soviel zu danken haben.“
Neugierig starren alle auf Konrad. Nur Werner presst seine Hände vor die Augen, und die Tränen rinnen ihm zwischen den Fingern hervor, die Arme entlang.
„Ich frag’ dich zum letztenmal: Was hast du verborgen?“
„Nichts.“
Hannes Frank schlägt zu. Der breite, schwarz und glatt gescheuerte Riemen saust zischend durch die Luft und klatscht auf Konrads Rücken, auf seine Hüsten und Beine.
Am anderen Ende des Tisches beginnt Arnold zu heulen, blechern, verzweifelt. „Oh, oh, oh ...“ Arnold windet sich, als träfen ihn die Schläge. Aber Konrad gibt nicht einen Laut von sich, macht keine Bewegung; nicht einmal den misshandelten Rücken zieht er ein. Nur seine blauen Augen hebt er auf zu Hannes Frank, den mehr und mehr der Zorn fortreisst. Konrad blickt seinen Richter seltsam fragend an, furchtlos, mit flimmernden Augen und einem unerklärlichen Ausdruck im totenblassen Gesicht; doch kein Wort und kein Zeichen. Er scheint die wuchtigen Schläge gar nicht zu fühlen. Gott weiss, vielleicht lächelt er irrsinnig.
„Gesteh die Wahrheit!“ brüllt Hannes Frank, hält einen Augenblick inne und gibt dem Sünder noch eine letzte Frist.
Nichts.
Möglicherweise geschah es ohne Absicht, ohne Überlegung; aber der Leibriemen sauste von hoch oben herab, mit der blanken Schnalle voran. Die Eisenschnalle traf Konrad an die Schläfe mit merkwürdig hartem Aufschlag. Rotes Blut floss über die eingesunkene Wange. Auch jetzt noch kein Laut. Das wurde unheimlich; Hannes Frank selber, der einzige und allmächtige Mann in dieser Stube, schien sich zu fürchten vor dem stummen Knaben. Wahrscheinlich brüllte er deshalb so gewaltig. Und es kam ihm wohl nur gelegen, dass die Frauen endlich von allen Seiten herbeisprangen, ihn umringten und seine Arme niederdrückten.
Im allgemeinen Tumult entkamen die Knaben.
Arnold und Emil verkrochen sich in ihren Betten, im grossen, prächtigen Saal, bei den lächelnden Göttinnen. Werner lief zum Haus hinaus.
Der Mond war aufgegangen. Riesengross schwebte er über dem Dächergewirr der Stadt. Werner lief durch den Garten und suchte den Schatten der Bäume. Wo war sie nun, die helle Freude des Morgens? Wo war es, das Glück des Mittags?
Auf der hohen Mauer, die steil zum Wasser niederfiel, sass Konrad und schaute hinaus in die unbegreifliche Welt mit ihren Wundern und Schrecken. Völlig unbeweglich sass er; ein Stein auf den vielen Steinen der alten Mauer. Er drehte nicht einmal den Kopf, als er leise Schritte hinter sich vernahm, als eine bebende, eine zagende Hand sich unter seinen Arm schob. Jetzt waren es zwei Steine, die die vermooste Mauer um ein geringes überragten, zwei kleine, verschüchterte Menschenwesen, unendlich verlassen in der stillen Nacht.
Tief unten plätscherte der Rhein; es gemahnte an weinerliches, schläfriges Kindergemurmel. Als ein paar gezackte Kreidestriche hoben sich die langen Häuserreihen am anderen Ufer aus dem blaudunklen Himmel. Mondlicht flackerte in unruhigen Bändern und Ringen am Fuss der Böschung, legte sich silbern um schwarze Steine. Stille war und tiefer Friede überall.
Eine verhaltene Stimme fragte: „Aber du hast doch etwas weggetragen — nicht?“
„Ja.“
„Was war es denn?“
„Frage nicht. Ich kann es nicht verraten.“
„Nein, nein.“
Schweigen und sanftes Wellengemurmel. Das Mondlicht fällt auf Konrads Gesicht und zeichnet deutlich die dunkle Blutlinie, die von der Schläfe über die Wange hinläuft bis hinunter zum Hals.
„Ich werde Wasser holen und ein Tuch. Ich will es abwaschen.“
„Lass es nur“, sagt Konrad fast feierlich. „Das tut gar nicht weh. Und wenn er mich umgebracht hätte, würde ich nichts verraten haben.“
In stummer Bewunderung schaut Werner auf zu dem Pflegebruder, der ein Geheimnis hat; ein Geheimnis, für das er leiden und sterben will. Das Dasein wird auf einmal gross und voll dunkler Tiefe. „Arnold meinte es nicht böse, verstehst du. Er verplapperte sich nur aus Angst, denn er ist noch so klein und dumm ...“
„Ach Arnold“, seufzt der merkwürdige Konrad und lächelt dabei.
„Warum muss er immer so roh und gemein schlagen? Uns zu schlagen ist keine Heldentat; er weiss ja, dass wir uns nicht wehren können.“
„Dein Vater? Er versteht das wohl nicht besser. Sicher hat er selber als Knabe viel Prügel bekommen. Nun meint er, die Reihe sei an ihm, zu schlagen. Die Grossen schlagen die Kleinen. So muss es stets sein. Was meinst du?“
„Ich weiss nicht ...“
Es reden nun diese beiden verprügelten Knaben und unterhalten sich über die mangelhafte Einrichtung dieser Welt. Altklug sind sie beide, durch Not und Bitternis frühreif geworden. Sie haben einen scharfen Blick für das Wesen der Menschen und der Dinge.
„Und das, was er über die Wandgemälde sagte, ist nichts als Unsinn“, meint Konrad. „Es sind Darstellungen aus der Götterlehre der alten Römer. Eins davon ist bestimmt die Jagd der Diana.“
„Ist das sicher?“
„Ja. Ich habe ein ähnliches Bild im Museum gesehen. Wenn du willst, können wir am nächsten Sonntag hingehen; da ist es für jedermann geöffnet und kostet keinen Eintritt.“
So schnell wird das Übel überwunden und vergessen. Diese zerbrechlichen Menschenfigürchen haben Stahlfedern im Leib. Sie werden zu Boden geworfen und flachgedrückt; aber kaum lässt der Druck nach, fahren sie leicht wieder in die Höhe.
„Im Museum — sind dort richtige Bilder?“
„Ja. Gemälde berühmter Künstler.“
„Von Raffael?“
„Ach, das war ja nur einer von vielen, und er ist längst tot. Natürlich konnte er allein nicht tausend Zimmer ausmalen. Dein Vater weiss wenig; aber er schwatzt viel.“
„Glaubst du, dass ich ein berühmter Maler werden kann?“
„Freilich — warum nicht ...“
„Ich glaube es.“
Aber hierauf sagt Konrad etwas, was ganz und gar nicht zu dieser Sache gehört; er blickt den Mond an und sagt: „Ich wundere mich, in welchem Zimmer sie schlief ...“
„Wer?“
„Die Waise.“
„Sie schlief gewiss bei ihren Eltern.“
„Nein, sie hatte ein Zimmer für sich allein. Sie waren doch sehr vornehme Leute, musst du begreifen ...“
„Warum willst du wissen, wo sie schlief?“
„So ... Sie ist immer allein und still und traurig. Nie kommt sie auf die Strasse hinaus zu uns anderen. Nur hinter dem Eisengitter steht sie. Aber sie lacht und kreischt nicht wie andere Mädchen. Ich habe Purzelbäume vor ihrem Tor geschlagen ...“
„Sie ist ein schönes Mädchen“, meint Werner bedächtig.
„Ich kann dir nur versichern, dass sie das schönste Mädchen der Stadt ist. Ja, vielleicht gibt es nicht ihresgleichen in der ganzen Welt. Sie steht himmelhoch über uns ...“
Damit endete das nächtliche Gespräch auf der hohen Mauer über dem Rhein. Die beiden Knaben sassen noch lange schweigend nebeneinander, jeder mit seinen eigenen Gedanken.
Der Mond streute grüngoldenes Licht auf die Erde. Der mächtige Strom rauschte mit seinen Wellen.
Verlorene Seelen
Es gab einen Mann, der heimlich durch das weitläufige Haus und durch die tiefen Keller schlich, und das war ein Mann, der allen Ernstes das Glück suchte, den verborgenen Schatz. Seht, der alte Klaus Lohmann wollte diesmal nicht abseits stehen, wenn die Unsichtbaren ihre Gaben ausstreuten. Deshalb ergriff er Emils Hammer und begann eine Tätigkeit. Er suchte, während die anderen schliefen.
Nun war leider der Schlaf der Frauen nicht tief genug, und sie vernahmen ein dumpfes Klopfen. Es war Elisa, die rief: „Allmächtiger Vater — hört ihr nichts?“
„Was denn?“ fragte es aus dem Dunkeln.
„Macht Licht! O Herr des Himmels — es klopft ...“
Das Gaslicht wurde angezündet. Die Frauen wussten es nicht, aber es war dasselbe Gaslicht, das dem Ehepaar Bondorf den Tod brachte. Aufgeschreckt sassen sie in ihren Betten und lauschten. Es klopfte. Drei dumpfe Schläge, bald da, bald dort. Es klopfte. „Bete, Mutter!“ flüsterten sie.
Die Grossmutter holte die grosse Bibel, setzte ihre Brille auf und las mit singender, vor Angst flatternder Stimme den prachtvollen Psalm, den sie zu lesen pflegte, wenn ein schweres Gewitter am Himmel tobte. „Wer unter dem Schutze des Höchsten steht und im Schatten des Allmächtigen wandelt ...“, las sie.
Es klopfte weiter.
Siebenmal las die Grossmutter den Psalm. Aber das Gespensterklopfen horte nicht auf. „Sie haben sich selber ums Leben gebracht, nun dürfen sie im Grab keine Ruhe finden“, sagte darauf die Grossmutter.
In Elisa steigt jäh ein kühner Gedanke auf. „Vielleicht gilt das uns“, flüstert sie heiss. „Ja, vielleicht sind wir auserkoren, diese armen Seelen zu erlösen.“
Ein glorreicher Gedanke! Ein Unternehmen, ganz nach dem Herzen der Lohmanns. „Wir wollen um ihre armen Seelen ringen“, sagen die Frauen zueinander. „Wir wollen ihnen die ewige Ruhe verschaffen.“
Abwechselnd beteten sie und flehten den Herrn um Erbarmen. „Vergib ihnen, o Herr!“ riefen sie inbrünstig.
Am Glauben fehlte es hier wahrlich nicht, und es wurde eine schöne und grosse Sache. Die Frauen hofften, dass die Belohnung nicht ausbleiben könne, denn sie waren natürliche und echt menschliche Wesen.
Dann hörte das Klopfen auf.
In der folgenden Nacht holten die Frauen Hannes Frank, und auch er hörte die Zeichen auf einer anderen Welt. Als der Mann, der er war, warf er sich nicht sogleich in den Staub und machte sich unnötig klein; er erklärte: „Mir täuscht keiner ein Huhn für ein Ei vor; hingegen hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Soviel ist wahr und gewiss. Diese Seelen erlösen? Wartet nur — dafür werde ich schon Mittel und Wege finden“, erklärte er zuversichtlich.
Hannes Frank besass ein Buch. Und das war ein geheimnisvolles und mächtiges Buch, nicht eine Bibel, sondern ein Buch, das er vom Vater erbte, der in seinem Dorf als Hexenmeister berühmt war. Ein dickes, uraltes Buch, in dem mancher Rat für überirdische und unterirdische Dinge stand, sowohl heilkräftige Tränke als dunkle Zaubersprüche. Hannes Frank zauderte nicht, den Kampf mit den finsteren Mächten aufzunehmen. „Wenn es darauf ankommt“, sagte er, „so fürchte ich den listigsten Teufel der Hölle nicht. Lasst mich nur machen“, sagte er und kniff die Augen zusammen.
Ei, da erst wurde es eine Angelegenheit! In der Mitternachtsstunde, während der alte Klaus mit seinem Hammer die Wände der tiefen Keller beklopfte und die Knaben im Märchenwalde schliefen, versammelten sich die Lohmanns im Zimmer der Selbstmörder. In stummer Feierlichkeit entrollte Hannes Frank auf dem Stubenboden einen langen, schmalen Papierstreifen, der mit seltsamen Zeichen bedeckt war. Die Zeichen hatte Hannes Frank selber mit roter Tinte gemalt, genau nach der Anleitung seines Zauberbuches. Er legte den Streifen in bestimmten Schlingen und Bogen, zog damit zwei magische Kreise. In den einen Kreis setzte er sich selber, das schwere Buch auf den Knien; in den anderen aber legte er einen echten Totenschädel. „Dreht das Gaslicht aus“, befahl er gedämpft, zündete drei Kerzen an und begann murmelnd zu lesen.
Auf ihren Betten kauerten die Frauen, eisige Schauer im Rücken, lauschten Hannes Franks düsterer Stimme und dem hohlen Geisterklopfen. Von Mitternacht bis ein Uhr dauerte die Beschwörung, worauf das Gaslicht wieder angezündet wurde, Hannes Frank den Papierstreifen aufrollte und den Totenschädel in einen kleinen Sack aus grünem Tuch schob.
Aber Elisa wollte gern wissen, was der Schwager aus seinem Buch vorgelesen.
„Was ich gelesen habe? Darüber darf kein Wort fallen. Ausserdem würdest du doch nichts davon verstehen, denn es war altes Lateinisch.“
„Verstehst du vielleicht altes Lateinisch?“ fragte Elisa hinterhältig.
Hannes Frank, das grosse, schwere Buch unterm Arm, richtete seinen Blick ungefähr auf Elisas Knie und erklärte geringschätzig: „Du tätest, meiner Seel, besser daran, dich um deine eigenen Kenntnisse zu kümmern. Soviel kann ich dir immerhin verraten, dass ich diese Geister in dreimal drei Nächten bannen werde. Und falls das nicht helfen sollte, so ist mir ein bestimmter Ort im Hardwald angegeben; ja, dann werde ich sie also unter eine gewisse Eiche bannen.“
„Unter eine Eiche?“
„Dort sind sie zwar nicht ganz sicher. Sie werden sich in jeder Vollmondnacht dem Hause um einen Hahnenschritt nähern.“
Oh, dieser Hannes! Er verstand seine Sache. Ungeheuer selbstbewusst schaute er von einem zum anderen und nickte. Und so blieb er natürlich der Gewaltigste unter den Frauen. „Nein, du Hannes, du Hannes!“ riefen sie überwältigt. „Was du alles kannst und verstehst.“
„Was dieses anbetrifft, so geh’ ich keinem gesalbten Pfaffen und keinem Mönch aus dem Wege.“
Hannes Frank — er meinte wohl, ein Mann, der mit seiner Trillerpfeife die schweren Eisenbahnwagen nach seinem Willen bewegen könne, dem sei es ein leichtes, mit Geistern zu manövrieren.
Doch Elisa fragte: „Wenn sie sich aber nicht unter die Eiche im Hardwald bannen lassen wollen, du Hannes?“
Ho — Elisa — einfältiges Frauenzimmer!
„Dann weiss ich noch einen Rat — nämlich die geweihte Flasche. Davon hast du erst recht keine Ahnung. Denn bei dir sitzt, wie bei den Fröschen, der ganze Verstand in der Zungenspitze.“
„So? Und wenn sie nicht in die Flasche hinein wollen, du kluger Hannes?“
„Wie? — Nun, dann magst du und der Teufel selber ihnen weiterhelfen!“ schrie Hannes Frank. Und jetzt war er wütend; er stampfte auf seinen kurzen, dicken Beinen aus dem Zimmer und knallte die Tür hinter sich zu.
Die armen Frauen fragten: „Warum kannst du niemals dein böses Maul halten?“
Worauf Elisa verschiedenes zu erwidern wusste.
Nacht um Nacht arbeiteten sie mit den Geistern — neun Nächte lang. Die Knaben merkten, dass etwas Ungewöhnliches und Gefährliches vor sich ging. Arnold und Emil zum Beispiel wagten, sowie es zu dunkeln anfing, keinen Schritt mehr vor die Stubentür. Vor lauter Furcht zogen sie sogar ihre Beine unter dem Tisch hervor auf die Stühle, und wenn es sich so traf, liessen sie das Wasser in die Hosen laufen. —
Konrad und Werner sitzen am Ufer des Rheins, fischen und schauen ein paar grauen Möwen zu, die still auf ausgebreiteten Schwingen segeln. Die Möwen legen ihre Köpfe von einer Seite zur anderen und starren mit ihren rotumränderten Augen auf die Knaben nieder, fahren kreischend in die Höhe. „Ahi — ahiii!“ rufen sie und ziehen langsam stromaufwärts.
„Kommen sie vom Meere her?“ fragt Werner.
„Aus der Nordsee; vielleicht von Norwegen oder Island. Bald wird es Winter. Die Möwen wissen es.“
Sie sitzen unter einem knorrigen, halbdürren Baum. Die Sonnenstrahlen fallen schräg unter die Äste, von denen ein zerfetztes Spinnennetz völlig unbeweglich in der Luft hängt. Es wird Abend.
Konrad blickt übers Wasser hin, über die hastigen, kleinen Wellen, die auf der einen Seite blau, auf der anderen golden schillern. Konrad sagt: „Merkst du etwas daheim? Sie halten eine richtige Geisterbeschwörung ...“
Werner hebt den Kopf. „Was meinen sie wohl damit?“
„Es ist natürlich alles nur Schwindel.“
Konrad Niemandssohn, dieser aufgeweckte Bursche, ist ein kleiner Zweifler, ein klarer Kopf, einer der Ersten in der Schule. Er liest Bücher. „Früher glaubten die Menschen an Teufelei und Zauberei — man verbrannte Hexen. Zu jener Zeit würde man auch deine Leute verbrannt haben.“
Werner wirft einen flachen Stein ins Wasser, schaut ihm mit schiefem Kopfe nach, wie er von Welle zu Welle hüpft und weit draussen verschwindet. An diesem Morgen hatte Werner Frank einen grossen Augenblick; in der Schule, beim Zeichenunterricht. Alle Menschen haben im Leben ein paar ungewöhnliche Augenblicke, die sie später nie wieder vergessen.
Werner Frank war kein Musterschüler, keiner von denen, die man als Beispiel und Leuchte zeigen darf. Am schlimmsten ging es mit dem Zeichnen. Da gab es etwas, das man Ornamente nannte; für Werner eine Plage. Seine Hand zitterte, er konnte keinen schönen Bogen ziehen. Er, der ein berühmter Künstler werden wollte! Ach, das war zum Lachen und zum Heulen; seine Hand schien ihren eigenen Willen zu haben. Diese Hand vermochte hingegen auf dem Blattrand mit ein paar Strichen den Kopf des Lehrers hinzusetzen, dazu eignete sie sich vortrefflich. Werner sah den Lehrer an, und seine Hand zog hastige, krause Striche, die sich auf einmal überraschend zusammenfügten, so dass das weisse Blatt zum Raum wurde, aus dem ein bärtiges Gesicht hervorwuchs.
Der Lehrer bemerkte Werners Treiben, trat näher in der Absicht, zu strafen. Doch es kam etwas ganz anderes, etwas Unglaubhaftes; es wurde eine grenzenlose Überraschung sowohl für den Lehrer als für Werner.
Schon streckte sich eine grosse Hand nach Werners Ohr; doch die Hand blieb in der freien Luft hängen. Der bärtige Mann beugte sich mit grossen Augen vor und fragte: „Wie? Hast du selber das gemacht?“
Werners Herz krampfte sich vor Schreck zusammen.
„Nein, das ist doch ausgeschlossen“, murmelte der Lehrer. Dabei hob er Werners Kopf, forschte staunend in dem zuckenden, schamerfüllten Knabengesicht. Dieser Lehrer malt ja Bilder und ist fast ein Künstler. Er weiss sicher nicht mehr, was er tut. Er zieht Werners Kopf an seine tabakduftende Brust und murmelt: „Fürchte dich nicht, Werner Frank ... Das ist wahrlich kein Grund, sich zu schämen. Denn das, was du dort gezeichnet hast, ist ein kleines Meisterwerk.“
So unvermutet kam das, so rein närrisch und unfassbar wurde es. Atemlose Stille im Raum, ein gespanntes Aufhorchen. „Ein Meisterwerk“, wiederholte der Lehrer feierlich. Und Werner, der oft bestraft, aber nie gelobt worden, senkte langsam den Kopf und weinte.
„Nein, nein, nein“, murmelte der Lehrer, selber ergriffen. „Zeichnest du zu Hause?“
Werner nickt, die Hand vor den Augen.
„Willst du mir einmal deine Arbeiten bringen?“
„Ich habe keine.“
„Was sagst du?“
„Mein Vater hat mir verboten zu zeichnen.“
„Deshalb vernichtest du deine Arbeiten?“
„Ja.“
„Hat man schon so etwas gehört? Was ist dein Vater?“
„Eisenbahner.“
„Ein lebendes Rätsel ... Dir, Knabe, wurde etwas sehr Seltenes geschenkt ...“ Nachdenklich holt der Lehrer mit der Zunge ein Ende seines Schnurrbartes zwischen die Lippen und kaut daran.
Das war Werners grosser Augenblick. Eine helle Flamme schlug auf dem grauen, alltäglichen Himmel nieder auf seinen Scheitel ...
Werner kauert jetzt an Konrads Seite und erzählt ihm sein Erlebnis. „Sicher wollte er damit sagen, dass ich Talent habe. Was meinst du?“
„Ja, du wirst einmal ein grosser Künstler sein“, nickt Konrad eifrig.
Leider blieb es nur ein kurzes, grelles Aufleuchten. Die Flamme erlosch, und Werners Leben wurde abermals grau und freudlos. Werner Frank wurde wieder zurückgestossen in die Masse und tauchte darin unter. Wahrscheinlich schämte der Lehrer sich nachträglich des kleinen Zwischenfalles und seiner Ergriffenheit. Die Sache schien ihm wohl gar zu unmöglich, und er vergass sie bald. Er war ein grosser Mann mit gewaltigem Bartwuchs, gewiss hatte er ein warmes und gutes Herz. Die Herzen der Menschen sind fast immer gut; nur träge sind sie — Gott bessere es.
Was aber dieses anbetrifft, so waren die Herzen der Lohmanns durchaus nicht träge, denn sie strengten alle ihre Kräfte an, dem Bösen zwei verlorene Seelen zu entreissen.
Der einzige, der vom Geistertreiben keine Ahnung hatte, war der alte Klaus. Unscheinbar und unbeachtet, wie seit jeher, ging er seine eigenen Wege, ausgeschlossen vom Vertrauen. Und so rumorte er also im Keller, indes in der Stube Hannes Frank beim Schein der drei Kerzen altlateinische Sprüche murmelte.
Es war seit jeher der Traum dieser armen Menschen, durch ein Wunder mühelos und schnell reich zu werden. Sie lebten immerzu in der Zuversicht, dass ihr Dasein irgendwie eine überraschende Wendung nehmen müsse. Sie waren glücklich in ihrer Hoffnung. Ihr Glaube war so stark, dass sie alle Not der Gegenwart leicht überwanden. Nun konnten zwar die armen Seelen in den dreimal drei Nächten nicht erlöst werden. Hannes Frank setzte also den Kampf im Walde fort, unter einer gewissen Eiche. Nebenbei erfüllte man die gewöhnlichen Pflichten des Alltags, führte Kriege und schloss Frieden.
Ein Versprechen
Und da war nun dieser grosse, gesegnete Garten. Die Früchte an den Bäumen reiften allmählich und konnten gepflückt werden; ein grosses Ereignis für die Knaben, die solches zum erstenmal erlebten.
Im Garten gab es einen Hügel, der einst dadurch entstanden, dass das viele Erdreich beim Ausgraben der mächtigen Kellereien dort abgelagert worden. Auf dem Hügel wuchsen Tannen, schlanke, hohe Stämme, deren Wipfel im Herbstwind sangen und sachte hin und her schwankten und aus deren dichten Zweigen es dunkel rauschte und lockte.
Der Garten gehörte jetzt den vier Knaben. Er durfte wachsen und alt werden, ehe er ein paar Menschenherzen erfreute. Früher war es ein vornehmer und stiller Garten. Die stolze Frau Bondorf spielte als Kind darin. Sie wurde im Ritterhof geboren und erbte ihn nach ihrem Vater, dem Herrn Kesser, der ein wirklicher Weinhändler gewesen und überhaupt eine glückliche Hand hatte, so dass er Geld auf Geld häufen konnte.
Auch das Töchterchen Alma spielte hier. Auf den Hellen Kieswegen machte es die ersten Schritte seines Lebens, allein, still, fern vom Lärm der Stadt. Im Grunde blieb es doch so unbegreiflich, warum der unglückselige Herr Bondorf das viele, viele Geld nicht behalten durfte; warum er nicht in diesem Garten mit seiner schönen Frau glücklich sein und grau und alt werden durfte. Die Leute behaupten jetzt, dieser Herr sei kein rechter Patrizier gewesen. Er stamme von irgendwo her, von jenseits der Grenze, vielleicht von Spanien oder Peru. Sie nennen ihn nachträglich eine mystische Person. Eine gelbe Haut hatte er; dunkle, feurige Augen hatte er. Diese heissen Augen betörten die reiche Tochter.
Zweifellos leben auch in anderen Städten vornehme Leute. Aber wozu brauchten die Bondorfs vier oder sechs Pferde auf einmal und verschiedene Wagen und zwei Kutscher? Viel Unerklärliches haftete diesen Menschen an.
Jeden Morgen ritten sie miteinander durch die Strassen. Und soweit die gewöhnlichen Leute sich auf Pferde verstehen konnten, ritt Herr Bondorf auf einem echten Araberhengst. Das Töchterlein Alma aber ritt auf einem braunen Pony und war überaus niedlich. Die Knaben standen mit offenen Mündern am Wegrand — genau dieselben Knaben, die jetzt im schönen Garten lärmten.
Die Bondorfs trieben es doch gar zu toll mit Luxus und Verschwendung, mit Gärtnern und Kammerzofen und Gott weiss was. Sie gaben glänzende Feste. Wollten sie vielleicht dadurch aller Welt beweisen, dass der zugereiste Herr Bondorf kein Habenichts, kein Abenteurer oder Zirkusmensch war? Und da endlich alle Welt glaubte, dass Herr Bondorf ein richtiger Hidalgo sei, drehte er selber den Gashahn auf. So ungefähr hing das zusammen; und es war grauenhaft und ein wenig lächerlich. Deshalb überwucherte jetzt Unkraut die hellen Wege. Konrad benahm sich als der Gesittetste, er setzte sich hier und dort auf eine Bank und blickte den Wolken nach, die über die Tannenwipfel zogen. Er allein konnte die Büsche und Bäume beim rechten Namen nennen. Der rote Arnold verstand sich eben erst aufs Obstessen, und Emil, der unruhige Geist, erfand jeden Tag neue Spiele, neue Teufeleien. In dieser Beziehung war er ein Genie und der geborene Anführer.
Aber Werner zeichnete, unbeholfen, doch in tiefer Andacht. Kleine Werke, ein knorriger Baumstamm vielleicht, ein paar Zweige, einen Stein mit dunklem Schatten dahinter. Und zuweilen kletterte er auf eine Tanne.
In diesem Knaben wohnten zwei Seelen, eine verschüchterte Träumerseele, die aus verborgenem Winkel hervor die mannigfaltigen Bilder der Welt erschauernd in sich aufnahm. Doch er liebte in gleicher Weise die Stille und die Gefahr.
Von den höchsten Wipfeln der Tannen tat er einen Blick in die Nachbargärten, auf das Dächergewirr der Stadt und hinaus in die grosse Ebene, an deren äusserstem Rande der mächtige Rhein als flimmernde Linie verschwand. Eine frischere Luft wehte. Die Menschen in den Strassen erschienen klein und in ihrer Gestalt wunderlich verzerrt. Als Kegel schoben sie sich vorwärts, mit hastigen, komischen Bewegungen; ja selbst ihre Stimmen klangen befremdlich. Manchmal schwirrte ein kleiner Vogel nahe vorbei, und der Windzug seines Schwingenschlages streifte Werners Gesicht. Vom Menschenstrom in fernen Gassen stieg dumpfes Brausen über die Dächer. Eisenbahnzüge fuhren in die Ebene hinaus, schrill pfiffen Lokomotiven; der Wind trug ihr Rasseln und Schnauben heran, bald stärker, bald schwächer. Ein endloses Kommen und Gehen, ein ungeheurer Wille zum Leben, und jähe, erschreckte Stille dazwischen. Nichtig schienen die Menschenfiguren in all dem Dröhnen, Kreischen, Klirren und Rasseln, das sie doch selber erzeugten ...
An den obersten Wipfel der höchsten Tanne klammerte sich Werner, überrascht und erschüttert von der Grösse der Welt. Gleich den vorbeihuschenden Vögeln stiess er helle Jubelschreie aus.
Er sollte jäh aus seinem Höhentaumel gerissen werden. Hinter dem dicken Wall der tausend Äste hervor rief eine fürchterliche Stimme: „Was treibst du dort oben, verdammter Schlingel?“
Der Himmel verfinsterte sich, die Ferne verblasste, die tausend Geräusche der Stadt verstummten ...
Dort unten irgendwo, verborgen hinter dem wunderfeinen Gewirr der duftenden Tannennadeln, lauerte schreckhaft wie das Verhängnis der Vater, der Herr über Leben und Tod, der erbarmungslose Richter, dessen Hand stets bereit war, zu strafen. „Komm sogleich herunter!“ wurde befohlen. Eine kalte Welle der Angst strömte Werner entgegen. Ein Schauer lief durch seinen Körper. Hart klopfte ihm das Blut im Halse. „Dir werde ich die Ohren ausputzen ...!“
Vor wenigen Augenblicken noch jubelte Werners Herz, und er war glücklich und frei und unmenschlich reich. Die Stimme des Vaters verwandelte ihn zu einem armseligen Häuflein Furcht. Doch überraschend kam eine unbändige Auflehnung gegen diese rohe Gewalt über ihn, ein wilder, sinnloser Trotz. Sich selber fremd, rief er: „Ich komme nicht. Nein. Und es ist mir gleichgültig, ob ich herunterfalle und sterbe ...“
Worauf eine betäubende Stille eintrat. Der Vater entfernte sich ein Stückweit, um seinen Sohn, der solches wagte, zu betrachten. Am Rande eines Rosenbeetes tauchte er auf, klein und rund, ohne Beine, nur die Füsse standen ihm unter dem Bauch hervor, eine Brust mit einem roten, zornigen Gesicht darüber. Der blanke Schild seiner Mütze funkelte in der Sonne, und die Trillerpfeife hing wie ein Orden an seinem Rock. „Du kommst nicht? Was sagst du?“
„Versprich mir, dass du mich nicht anrührst. Sonst bleibe ich hier oben.“
Dieses war das erstemal, dass Werner es wagte, dem Vater zu widersprechen. Er fühlte sich sicher und überlegen in seiner Höhe. Er schaukelte sich hin und her. Der schlanke Tannenwipfel bog sich unter ihm, es knisterte und raschelte in den Zweigen. Der Tannenwipfel bog sich einem anderen Tannenwipfel entgegen. Werner liess los, sauste mit ausgebreiteten Armen durch die leere Luft, griff zu und wiegte sich wieder. Ein paar Äste krachten; ein paar Schrammen an Gesicht und Händen. Das Spiel war schön. Ein herrliches, ein gefährliches Spiel, noch dadurch erhöht, dass tief unten der gefürchtete Mann stand und in ohnmächtiger Wut seine beiden Fäuste emporstreckte.
Von Wipfel zu Wipfel sprang Werner, leicht und sicher; ihm war, als brauche er nur seine Arme auszubreiten, um wie die Vögel durch die Luft zu schweben, hoch über die Erde und den erzürnten Vater hin, in die blaue Ferne hinaus.
Trotzdem meinte der Vater es gut auf seine Weise; er verstand nur so gar wenig von dem, was in der Seele seines Sohnes lebte. Nach alter Überlieferung meinte er, es genüge, streng zu herrschen und hart zu züchtigen. Er meinte, damit sei schon alles getan. Aber als er seinen Sohn, einem Eichhörnchen gleich, von Baum zu Baum springen sah, wurde ihm ein wenig schwindlig, und er rief mit milderer Stimme: „Lass das jetzt, du! Komm nur herunter. Ich tu dir für diesmal nichts.“
„Versprichst du mir das?“
„Jawohl — hörst du ...“
Ei, das war ein völlig ungewohnter Ton. Es klang ähnlich einer Bitte. Werner traute dieser Milde nicht und blieb zurückhaltend. „Soll das wirklich ein Versprechen sein?“ fragte er.
„Ja, was denn sonst?“
„Ein Versprechen muss man halten ...“
„Schwätz nun nicht länger und komm herunter!“
„Gut. Ich glaube dir.“
Die blanke Schirmmütze und das rote Gesicht verschwanden hinter dem Gewirr der Tannenäste. Werner meinte, der Vater sei ins Haus gegangen und das kleine Abenteuer beendet.
Darin irrte er sich. Der Vater lauerte hinter einem Busch verborgen, und noch ehe der Sohn den Erdboden erreichte, wurde er von kräftiger Faust im Nacken erfasst. Ein Leibriemen schwirrte in der Luft, der kühne Sohn wurde furchtbar verhauen. Über ihm keuchte eine wütende Stimme. „Das ist für deine Kletterei. Und das ist für dein freches Maul. Ich will es dir dick aufstreichen. Daran sollst du dein Leben lang denken ...“
Als der Riemen ihm entglitt, schlug er mit blosser Hand weiter. Und gewiss meinte er es noch immer gut auf seine Weise. Er liess den Sohn zur Erde fallen und erklärte schnaufend: „Wer sein Kind liebt, der züchtiget es.“
Während er den Leibriemen umschnallte, wiederholte er: „Jawohl — der züchtiget es bald.“ Worauf er ein paar Schritte machte. Dann drehte er sich um und sagte: „Und jetzt ins Bett mit dir, du Strolch. Abendbrot gibt es heute nicht. Verstanden?“ Nun erst ging er ins Haus.
Hannes Frank ahnte nicht, was er angerichtet. Er ahnte nicht, dass Werner sein Leben lang diese Stunde nicht mehr vergessen konnte. In Werner war etwas sehr Kostbares zerbrochen.
Eine flammende Empörung beherrschte ihn völlig. Er liess sich schlagen, und kein Laut kam über seine Lippen. Es war genau so, wie Konrad es in einer Mondnacht auf der Strandmauer schilderte: er hörte die Schläge, aber fühlte sie kaum. Was ihm damals unglaubhaft erschien, das hatte er nun selber erlebt.
Im Kreise standen stumm, mit verstörten Gesichtern, die Brüder. „Tut es sehr weh?“ erkundigte sich der rote Arnold, indes er seine eigenen Lenden rieb, und stöhnte: „Oh — oh ...“
Konrad beugte sich über Werner, hob ihm den Kopf, strich ihm das Haar aus dem Gesicht, ohne ein einziges Wort. Für Konrad blieb alles Erleben Schicksal, das er ohne Widerspruch erduldete, als etwas Unentrinnbares.
Schnaufend lief Emil herbei. „Der Tyrann sitzt in der Küche, frisst und flucht. — Werner, verschwinde! Wenn er dich sieht, haut er dich sicher noch einmal, denn er ist noch rasend. Hör nur, wie er brüllt, der Löwe ...“
Sie führten Werner durch den Haupteingang ins Haus. Konrad wusch ihm das Gesicht. Und Werner sagte noch immer kein Wort. Mit geschlossenen Augen lag er, und es war eine grosse Müdigkeit und unendliche Trauer in ihm.
Allmählich begannen die Schläge zu schmerzen. Werner feuchtete mit der Zungenspitze die trockenen Lippen an und merkte, dass sie dick geschwollen waren. Er dachte nur immer das eine: Er hielt sein Versprechen nicht! Und es war in ihm ein Entsetzen sondergleichen.
Sehr behutsam drehte er sich auf die Seite. Sein Rücken brannte wie Feuer. Das ganze Bett strömte unerträgliche Gluthitze aus. Aber Werners Herz zitterte vor Kälte. Und er öffnete die Augen und starrte zur Wand hinüber, zum Märchenwald mit den schönen Göttinnen und den Fabeltieren — in eine Welt, in der es keine Leibriemen und keine Gemeinheit gab.
In dieser Stunde hörte Werner Frank auf, ein Kind zu sein. Kaum dreizehn Jahre zählte er, als ihm sein Kinderglaube genommen wurde. Des Vaters Faust riss ihn aus der linden Sorglosigkeit der Jugend. Des Lebens Wirklichkeit richtete sich finster und drohend vor ihm auf. Das Band, das ihn an die Eltern knüpfte, hatte Hannes Frank durchschnitten. Dieses Band konnte nie wieder geknüpft werden. Voll unausdenkbaren Grauens fragte Werner: „Wer sind sie, diese Menschen? Was wollen sie von mir?“
Er glaubte, sie umständen alle sein Lager und schauten auf ihn nieder, wie er so zerschlagen und zerschmettert lag. Aber sie hatten fremde und lauernde Gesichter. Es war ein unfassbares, blitzhelles Durchdringen der Oberfläche. Alle wurden durchsichtig. Hinter ihren Augen sah Werner schattenhaft ihre geheimen Gedanken vorübergleiten. Ob dieser Erkenntnis gingen die Schmerzen seines wundgeschlagenen Körpers unter im Erschauern seiner Seele.
Oft bestimmen kleine und unbeachtete Begebenheiten den Lebenslauf der Menschen — Werner Franks wurde durch des Vaters Wortbruch aus der Gemeinschaft der Familie gelöst. Hinfort stand er ihrem Treiben fern ...
Schritte auf den Steinfliesen des Hausflurs. Schwere, klatschende Schritte. Werner kannte sie genau. Hart stiess die Ferse auf den Boden, darauf klatschte die Sohle. Es hörte sich an, als schritten zwei nebeneinander her.
„Plattfüsse“, murmelte Werner, zitternd wie im Fieber. Ein völlig neues Gefühl von Abscheu und Hass quoll in ihm auf. Er stellte sich vor, wie der Vater jetzt durch den hallenden Flur schritt, schmatzend nach dem Essen, satt, zufrieden, stumpf. Ein Dunst von Schweiss und Schmieröl umgab ihn, ein Geruch von sonnendurchglühten Eisenbahnwagen und kaltem Tabakrauch. Die Enden des langen Schnurrbarts hingen zu beiden Seiten des Kinns nieder und verbargen den Mund. Nie hat Werner seines Vaters Mund gesehen. Doch nun erkennt er sehr deutlich den Schnitt der Lippen ...
Ein fremder Mann. Ein Eisenbahner, er schreitet gegen die Landstrasse. Er öffnet das eiserne Gartentor. Untersetzt, schwerfällig. Sein Dienst ist, mit den Eisenbahnwagen zu manövrieren. Sie sagen, er sei Obmann einer Rangierabteilung. Er kommandiert über vier oder fünf andere Männer, die Schildmützen tragen und einen ähnlichen Geruch ausströmen. Hannes Frank heisst er, und seine fleischigen Hände baumeln ihm beim Gehen seltsam leblos aus den Ärmeln, gleich zwei gelben Sandsäcken. „Diese Sandsäcke waren es, die mich schlugen“, murmelt Werner. Auf einmal denkt er ohne Groll daran, es ist mehr ein Erinnern von weit her, als sei das einst einem anderen zugestossen. „An seinen schlaffen Händen würde ich ihn erkennen unter vielen Tausenden ...“
In einer Dämmerstunde hielt Werner Frank Abrechnung. An einem Samstagabend.
Am folgenden Morgen ging Werner mit Konrad in die Gemäldesammlung des Museums.
Er hinkte ein paar Tage lang und konnte den Rücken nicht strecken.