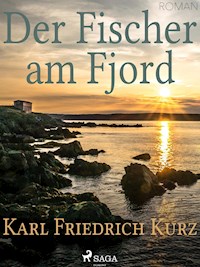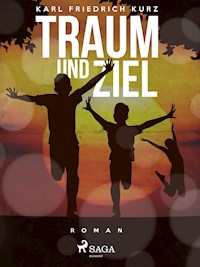Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die fest verschlossenen Türen ohne Klinke, die vergitterten Fenster, die Beobachtung durch die Wärter: Das Irrenhaus, in das der Hauptmann, begleitet von seinem Gefangenenwart, eingeliefert wird, unterscheidet sich nicht sehr von dem Gefängnis, aus dem er überführt wird. Die krankenhausähnliche Aufnahme ist lästig. Die Irren auf den Gängen begegnen dem Neuen voller Aggression und Neugier, der Oberarzt, der die Akte kennt, bleibt unterkühlt reserviert. Für den Hauptmann aber, der seine Söhne und seine junge Frau zurücklassen musste, liegt der wesentliche Unterschied zu seiner Verhaftung und dem Gefängnis in dem "Idiotenparagraphen": Der soll ihn, ohne Verhandlung, von der Schuld, einen Menschen getötet haben, freisprechen. Ein Geheimbericht der Regierung, für die er arbeitete, verhindert ein Verfahren und sorgt stattdessen für die Unterbringung in der Irrenanstalt: denn ein Narr ist ungefährlich. Was er sagt, hat kein Gewicht. Doch der unbändige Wille des Hauptmanns, seine Unschuld zu beweisen und sich nicht brechen zu lassen, beeindruckt. Sein kalter Morphiumentzug, lebensgefährlich in wenigen Tagen durchgezogen, wird zum Wettstreit mit dem Oberarzt, der ihm immer wieder eine Spritze anbietet. Mit dem Sieg gegen die Sucht gewinnt er nicht nur die zurückhaltende Bewunderung der Wärter. Mit jeder Visite lässt sich der Oberarzt, der das Gutachten pro oder kontra schreiben muss, weiter aus dem Leben des Mannes erzählen, der unbeirrbar seinen Weg in die Freiheit verfolgt.Die unheimliche Geschichte eines unschuldigen Mörders, dem es gelingt, mit äußerster Geistes- und Willenskraft sein kafkaeskes Gefängnis aufzubrechen – grausam und spannend erzählt!Karl Friedrich Kurz (1878–1962) war ein deutscher Schriftsteller, der vorwiegend Erzählungen, Romane und Reisebeschreibungen schrieb. Geboren in Bremgarten (heute Ortsteil von Hartheim am Rhein, südlich von Freiburg im Breisgau), ist er noch als Kind mit seinen Eltern nach Basel gezogen. Nach der Schule wollte er Maler werden und schrieb sich an der Akademie in Karlsruhe ein; doch die Umstände ließen ihn zum Schriftsteller werden. Er vagabundierte durch viele Gegenden der Welt (etwa durch Ostasien, insbesondere Japan), bis er sich schließlich in Norwegen niederließ, wo er zunächst in der Gegend von Solund, dann nahe Vadheim im Sognefjord lebte. In Norwegen schrieb er Erzählungen in deutscher Sprache, beeinflusst vom großen norwegischen Romancier Knut Hamsun sowie von Natur und Leben der Bevölkerung in den Fjorden von Sogn und Sunnfjord. Seine Bücher erreichten hohe Verkaufszahlen. 1934 wurde ihm der Große Schillerpreis der Schweizerischen Schillerstiftung Zürich verliehen. 1924 zog er nach Vårdal (Dalsfjorden) im Sunnfjord, wo er bis 1950 wohnte, als er seine Familie verließ und sich in Nessjøen (Sotra) im Hordaland ansiedelte. Dort lebte er bis zu seinem Tode. Seine nachgelassenen Schriften sind weitgehend verschollen.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karl Friedrich Kurz
Die Zerrütteten
Roman
Saga
Die Zerrütteten
German
© 1925 Karl Friedrich Kurz
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711518496
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Erstes Kapitel
Herr Geiger, setz’ an, der Brummbass geh mit!
Mein Tänzer — komme in Minne,
Erlaub’, dass den Tanz ich beginne.
Drei Männer, ein älterer und zwei in mittleren Jahren, gingen durch die Tore zur psychiatrischen Klinik.
„Nun schliessen sich die Tore der Vernunft hinter mir,“ sagte der eine der dreien. Dieser Mann war über mittelgross, schlank, doch kräftig und sehnig, er ging vornübergebeugt. Sein Gesicht, schon seit einem Monat unrasiert, war ruhig und gleichgültig, als ginge da eine unwesentliche, fremde Sache vor sich. Nur aus seinen Augen blickten dann und wann wie ein Blitz, der die Nacht erhellt, unbändiger Trotz und Spott. Seine Begleiter waren erregt. Der jüngere schaute immer wieder voll Mitgefühl und Grauen auf den Häftling. Seine Augen sagten: „Er kommt nicht mehr lebend aus diesem Hause.“ Der ältere suchte in allen Taschen mit raschen Händen, während die dreie vor der Pförtnerstube standen, und machte sich weiter keine Gedanken. Endlich zog er einen bedruckten und beschriebenen Schein hervor, dann legitimierte er sich: „Oberwachtmeister Saus mit Begleitung, ausnahmsweise in Zivil!“ sagte er.
Der mürrische alte Pförtner sah mit einem raschen Blick auf die beiden Begleiter, seine Augen huschten wie Mäuse in der Stille, dann schaute er den Häftling misstrauisch an. Währenddem hatte er schon, wie eine alte Maschine, die immer dasselbe tut, den Wärtern geklingelt. Drei kräftige Männer der Tagwache in weissen Schürzen und Jacken kamen, wie aus den Türen gespuckt, von drei Seiten heran, scheinbar wie zufällig. Ihre Augen zeigten, dass sie griff- und sprungbereit waren, den „Neuen“ sicher zu fassen. Der Häftling schaute die dreie ruhig an und fragte seinen jüngeren Begleiter:
„Können wir jetzt gehen?“
Da machte der eine Wärter, ein blonder und baumstarker Mann, der stellvertretende Oberwärter, lächelnd eine einladende Handbewegung und sagte:
„Bitte gehen Sie nur in das Wartezimmer, der Herr Oberarzt wird gleich kommen.“
Der blonde Wärter stellte sich neben den Häftling, wies mit seiner greiffesten Hand voraus über den breiten hallenden Korridor und sagte:
„Dort ist das Wartezimmer!“
Der Häftling war stehengeblieben, der Blonde blinzelte schier unmerklich. Die andern beiden, ein kleiner, mächtig Breitschultriger und ein schlanker, katzengeschmeidiger Mittelgrosser, stellten sich, die Eingangstür sperrend, sofort in den Rücken des Neuen. Der schaute sich langsam um, dann zuckte um seinen Mund ein kurzes, schwaches Lächeln. Sein jüngerer Begleiter aber sagte schier erbost und unwirsch zu den Wärtern:
„Das ist denn hier doch nicht notwendig!“
Einen Augenblick schaute der Häftling seinem jüngeren Begleiter in die Augen. Dieser Blick war beredter als viele Worte. Dann wandte sich der Neue zu dem blonden Wärter und sagte hart, wie ein Mensch, der gewohnt war, zu befehlen:
„Gehen Sie voran!“
Ruhig ging der herkulische, blonde Wärter voraus, während der kleine Breite, unsicher seinen schwarzen Schnurrbart zwirbelnd, langsam folgte. Der schlanke Katzenflinke aber schaute überrascht und forschend dem Neuen nach, denn er hatte in dreizehn Dienstjahren Erfahrung noch keinen Neuen eben so gesehen. Er folgte als letzter hinter dem Oberwachtmeister. Der jüngere Begleiter ging neben dem Häftling und sagte leise und mit einem Ton in der Stimme, dem anzuhören war, dass er nur etwas Gutes sagen wollte, aber es selbst nicht glaubte, was er sprach:
„Es wird sicher nicht so schlimm werden!“
Der Oberwachtmeister Saus jedoch hatte schon wieder das Reisefieber. Er dachte in seinem alten Gendarmenschädel nur noch daran, ob er und der jüngere Begleiter auch noch den Zug nach Haus zur rechten Zeit bekämen; denn er wollte noch zwei Privatgänge machen, ehe er in sieben Stunden wieder zur Eisenbahnstation ging. Der Häftling antwortete seinem jüngeren Begleiter leise und ruhig; der jedoch fühlte einen warmen Ton in den Worten:
„Ich habe schon Böseres mitgemacht und ausgehalten, und dann geht auch die längste Zeit vorüber, lieber Herr Gefangenenwart.“
Der blonde Wärter klinkte die Tür auf zum Wartezimmer und liess die dreie eintreten. Die Wärter blieben aussen stehen. Der Blonde sagte:
„Ich melde Sie jetzt dem Herrn Oberarzt.“
Dann schloss er die Tür und befahl ruhig den Wärtern im Flur:
„Du, Krayer, und du, Fuchs, ihr bleibt zur Fürsorge mal hier.“
Drinnen im Wartezimmer herrschte ein drückendes Schweigen. Der Oberwachtmeister Saus dachte immer, ob die sieben Stunden auch ausreichten. Es hätte ihn arg verdrossen, wenn ihm etwas in die Quere gekommen wäre. So in Gedanken versunken, sass er auf einem Stuhl und schaute stier in die andere Ecke des Zimmers. Der Gefangenenwart aber stand an die Wand gelehnt, gegenüber der Bank, worauf der Häftling still und ruhig sass. Doch sah der Gefangenenwart wohl, dass einen kurzen Augenblick, schier unmerklich, ein wehes Zucken über das Gesicht des Untersuchungsgefangenen ging und rasch dem Ausdrucke der Verachtung Raum machte. Da ging der Gefangenenwart langsam im Wartezimmer auf und ab. Er kannte das Gesicht des Häftlings zur Genüge und wusste, was das bedeutete. Die Minuten wurden ihm lange und quälend, er trat an das vergitterte Fenster, öffnete es und atmete tief die kalte Winterluft, die von draussen in das von grauem Tageslicht trübe Wartezimmer strich. Dann sagte er beinahe mechanisch, um seine Gedanken abzulenken:
„Da drüben ist die Frauenabteilung!“
Wieder ging unter Schweigen die Zeit langsam dahin. Da ging der Gefangenenwart rasch zur Tür und wollte hinaustreten. Er stiess mit dem einen Wärter vor der Tür zusammen und fragte heftig:
„Müssen wir hier denn eine Ewigkeit warten?“
„Ja, bei uns hat schon mancher auf die Ewigkeit warten müssen, Herr,“ antwortete ihm der kleine Breitschulterige trocken.
Der Flinke aber ging sofort weg; es klappte Tür und Tür immer ferner; der Wärter holte den Oberarzt. Bald nachher tat sich die Tür zum Wartezimmer auf, und der Oberarzt, in langem, weissem Kittel, trat ein, gefolgt vom Oberwärter. Der Oberarzt konnte ein beginnender Dreissiger sein, das Gesicht war hart, die Augen hinter dem Kneifer lebhaft, scharf und klug. Seine Gestalt war gross und schlank, sein Wesen hatte noch den burschenschaftlichen Schneid. Der Oberwärter, ein älterer Mann mit goldener Brille, hinter der kluge Augen nicht ohne Humor aus einem schmalen Gesicht hervorschauten, mass mit einem kurzen Blick, gerade wie der Oberarzt, prüfend und wägend den Häftling. Der war aufgestanden, als die beiden eingetreten waren, und schaute ihnen entgegen. Der Arzt trat auf ihn zu und sagte rasch:
„Ich habe Ihre Akten gelesen.“
Der Häftling antwortete nicht.
„Der Oberwärter wird Sie zu Ihrem Bette bringen,“ fuhr nach einer Weile der Arzt fort, drehte sich auf dem Absatz und ging rasch zur Tür hinaus.
Der Oberwärter sagte mit einer durch lange Jahre angewöhnten Freundlichkeit:
„So, so wollen wir jetzt gehen, Herr!“ Der Häftling schritt auf seine Begleiter zu. Kühl gab er dem Oberwachtmeister Saus, der seine Reisegedanken verloren hatte und mit beiden Ohren horchte und den Augen sah, die Hand.
„Lassen Sie sich’s gut gehen, Wachtmeister!“ sagte der Häftling, dann wandte er sich zum jüngeren. „Und Ihnen, Herr Gefangenenwart, hab’ ich viel Dank zu sagen, nun aber grüssen Sie mir zu Hause meine Familie!“
Die beiden drückten sich die Hand, und ehe noch ein Wort weiter gesprochen wurde, wandte sich der Häftling und folgte dem vorausgehenden Oberwärter. Der Gefangenenwart ging mit dem Oberwachtmeister Saus mit langen Schritten über den Flur. Während dem Gehen sagte er laut, dass die Wärter verwundert horchten:
„Der Hauptmann ist so wenig verrückt wie ich, und wenn sie ihn behalten wollen, dann sorg’ ich dafür, dass ihn sein Rechtsanwalt aus diesem Hause holt.“
„Na, jetzt ist aber noch nichts zu machen, und dann, es ist ja auch egal um ihn, alle denken zu Hause so!“ meinte darauf der Oberwachtmeister Saus, und begann sich mächtig zu freuen, dass ihm seine Zeit nun doch reichen würde, „sein Programm“ zu erledigen.
Der Gefangenenwart aber dachte nach Haus an eine junge, schlanke Frau, die nachts weinte und am Tage mit blanken blauen Augen aufrecht durch die gaffenden Leute ging, so tapfer wie nur eine Frau sein kann, die einen tiefen Schmerz stille und wortlos verborgen im Herzen trägt. Und er dachte an die weisshaarige Mutter des Häftlings, die staunend am Fenster sass und nur das Weh fühlte, deren Kraft gebrochen war. Dann dachte er an zwei Jungen, denen der Häftling beim Abschied die Hände auf die Schultern gelegt und gesagt hatte:
„Gebt tüchtige Menschen, und haltet euch brav!“ Er sah die Jungen, die stolz auf ihren Vater waren, deren Augen sagten, was ihre Herzen voll kindlichem Vertrauen fühlten: „Wartet nur, ihr kennt ja unsern Vater alle nicht!“
Der Gefangenenwart wollte diesen zu Hause sagen: „Nur Kopf hoch, sie werden ihn im Narrenhaus nicht unterbekommen!“ Das wollte er sagen, auch wenn er es selbst nicht glaubte.
So glücklich die Reise für den Oberwachtmeister ausgefallen war, zum Schluss klappte es nicht mehr. Alles war gut gegangen, bis sie zu Hause auf der Bahnstation ankamen. Da wollte der Oberwachtmeister Saus, in Zivil, aus dem Abteil aussteigen. Seine Gefühle waren beschwingt, und er wurde unachtsam. So kam ihm, als die Lokomotive noch einen kleinen Ruck machte, sein Regenschirm zwischen die Beine. Der Schirm zerbrach und trübte die Erinnerung an die glückliche Fahrt.
„Nu ja,“ murrte er unverdriesslich, „man muss nur so einen verfluchten Kerl transportieren, und schon passiert einem ein Pech.“
Der Gefangenenwart hörte nicht hin, er ging eilig nach der Wohnung des Häftlings, noch ehe er sich nach Hause begab.
Zweites Kapitel
Ihr Herren und Damen, ihr irrt euch sehr,
So leicht ist das Tanzen nicht,
Besonders der Anfang ist bitter schwer.
Der Oberwärter, gefolgt vom Häftling, hinter dem die beiden Wärter blieben, legte scheinbar die Hand an eine der breiten Doppeltüren des Flurs. Da öffnete sich diese leise und sanft, lächelnd ging der Oberwärter an der Seite des Häftlings hindurch, die beiden Wärter traten rasch nach. Da schnappte die Tür mit einem harten Ruck wieder zu, gerade so wie eine Mausefalle klappt, wenn die Maus am Speck zieht. Sie standen in einem kahlen Raum, der in jeder seiner vier Wände eine grosse Doppeltür hatte. Da wandte sich der Oberwärter an den Häftling, seine Lippen wurden schmal, und die sonst gutmütigen Augen blickten nochmals forschend über den Häftling, dann sagte er:
„Sehen Sie, Herr, keine der Türen hat eine Klinke, nur Sicherheitsschlösser, und wer da den Schlüssel nicht hat, kann weder ein noch aus.“
„Das hab’ ich bereits gesehen,“ antwortete der Häftling kalt und abweisend.
Aber der Oberwärter sprach unbekümmert weiter, wie einer, der seinen Spruch schon oft hergesagt hat: „Und geben Sie jetzt, wenn wir durch diese Tür kommen, auf die Fenster acht, alle schwer vergittert, nicht zu durchbrechen, gerade wie diese Mauern hier; bei uns ist alles massiv.“
Der Häftling schaute geradeaus, als ginge ihn diese Rede gar nichts an. Der Oberwärter stutzte einen Augenblick. Dann lächelte er wieder. Langsam, so dass der Häftling das ja sehen musste, nahm er seinen Türschlüssel und schob ihn lautlos ins Schlüsselloch. Wieder sprang eine Tür auf.
„So!“ sagte der Oberwärter, „jetzt kommen wir zur Aufnahmestation.“
Sie betraten einen etwa vier Meter breiten Flur. Der vordere Teil war leer und kahl, nur zwei Türen waren gegenüber der Fensterseite. Dann aber gegen die Mitte zu stand das erste Bett, längs der Wand. Links und rechts kamen Türen, die irgendwohin führten. Dann standen im hintern Teil links und rechts des Flures wieder Betten. Menschen mit geschlossenen Augen lagen darin. Nur aus dem einen Bett unter dem letzten Fenster richtete sich ein alter, langer Mann auf. Sein Hemd war kurz und zerrissen. Der dünne, knochige Leib zeigte sich mit blosser Haut, die lange keine frische Luft mehr gefühlt hatte und wie Leichenhaut zu sehen war. Das Gesicht des Mannes war angstverzerrt, mit tiefliegenden Augen. Er sah aus wie der lebende Tod. Mit schwankenden, schlürfenden, dennoch raschen Schritten ging er auf die dem Eingang gegenüberliegende Türe zu. Mit beiden Händen schlug er gegen die Tür und schrie unruhig, wie einer, dem das Sterben im Herzen sitzt:
„O Herr Jesus, lasst mich hinaus, o Herr Jesus, lasst mich hinaus!“ und immer schrie der alte Mann dasselbe und schlug mit den Händen die Tür. Die Schlafenden wurden merklich unruhig. Einer setzte sich auf und jammerte kläglich: „Der Grossvater soll doch ins Bett gehen!“
Der Oberwärter war stehengeblieben, dann rief er einem Wärter zu: „Krotz, ist der Gugel schon wieder so unruhig?“
„Schon wieder, Herr Oberwärter! Immer noch, wäre richtig, ich hab’ ihn sicher schon ein paar dutzendmal ins Bett gelegt.“
Der Wärter Krotz ging langsam auf den Alten zu; der jammerte immer noch:
„O Herr Jesus, o Herr Jesus!“
Wärter Krotz nahm sachte den einen Arm des Alten, drehte ihn um, so dass er ihm ins Gesicht schaute. Dann bückte sich der Wärter rasch und legte den Alten, der immer mehr schrie, wie einen Sack auf die Schulter, trug ihn zu seinem Bett und legte ihn hinein.
„Krotz, geben Sie ihm eine halbe Spritze Scopolamin, damit er wieder ruhig wird, unser Grossvater,“ sagte der Oberwärter sachlich und lässig. Zu dem Häftling gewandt, fuhr er fort: „Das ist die Halbruhe für die weniger unruhigen, jetzt kommen wir zur Wachstation, da durch diese Tür.“
Der Oberwärter schloss mit seinem Schlüssel die nächste Tür auf. Sie traten in einen grossen Saal; rings an den Wänden standen die Betten, mit dem Kopfende gegen die Wand. Aus den meisten Betten schauten ausdrucklose oder verzerrte Gesichter. Einige der Patienten waren auf und gingen langsam herum, oder sassen schier teilnahmslos auf den Stühlen. In der Mitte des Saales waren zwei lange Tische zusammengeschoben; wohl dreissig Menschen konnten gut daran Platz nehmen. In einer Fensternische stand ein kleines Tischchen, und der grosse, blonde Wärter sass daran. Einige andere Wärter standen da und dort, ihre Augen schauten spähend nach allen Seiten aus.
„Hier ist Tag und Nacht, Licht und Wache, Herr!“ sagte der Oberwärter unvermittelt zu dem Häftling. Dann trat der Oberwärter rasch an das kleine Tischchen heran und sagte zu dem herkulischen, blonden Wächter:
„Hier, Herr Weber, ist der Patient, der uns zur Beobachtung geschickt wurde!“
Der stellvertretende Oberwärter Weber schaute mit wasserblauen Augen ruhig mit einem Anflug von Bedauern dem Häftling ins Gesicht, dann sagte er langsam:
„Wollen Sie sich gleich ins Bett legen, das ist Ihr Bett,“ er zeigte auf das Bett, das dem Wärtertischchen am nächsten stand. Der Häftling schaute sich noch einmal rasch im Saale um, dann fragte er:
„Ist die Visite schon durch?“
Der blonde Weber schaute verwundert auf den Häftling:
„Nein!“ sagte er dann und fuhr nach einer Weile so nebenbei fort: „Waren Sie schon einmal in einer Anstalt?“
„Nein,“ entgegnete der Häftling.
„Die Visite mit dem Herrn Oberarzt wird bald kommen, Herr,“ sagte der blonde Weber.
Während dieser Worte kam der Oberarzt; verwundert schaute er auf den Häftling.
„Wollen Sie nicht zu Bette gehen?“ fragte er.
„Nein, hier nicht,“ antwortete der Häftling.
„Weshalb nicht,“ fragte der Arzt scharf. Seine Augen blickten hart, sein Mund bekam etwas Verkniffenes, gerade als müsste er ein unbändiges Tier bewältigen.
Da trat der Häftling nahe an den Oberarzt heran und sagte leise und bestimmt:
„Versetzen Sie sich in meine Lage, Herr Doktor, hier bringen Sie mich nicht unter. Entweder Sie geben mir ein Zimmer, oder Sie sperren mich in die Zelle, wie Sie wollen.“
Der Oberarzt schaute noch einmal prüfend auf den Häftling, seine Augen blickten weniger hart; er ordnete an:
„Gut, Weber, führen Sie den Patienten ins Zimmer zum kleinen Goldschmied.“
„Danke!“ sagte der Häftling.
„Ich komme nachher auf Ihr Zimmer.“ Der Oberarzt begann seine Visite zu machen, während Weber den Neuen zu seiner Station führte. Jäh schrie da eine Stimme neben dem Häftling:
„Du hast die Paralyse.“
Das letzte Wort sang der Irre lang gedehnt und gellend, er trottete im Hemd neben dem Häftling her, mit gierigem Blick und zuckenden Händen, die plötzlich dem Neuen klammernd an den Hals fuhren. Die Wärter sprangen herbei, der blonde Weber griff dem Irren hart um die Handgelenke. Der aber lockerte seine Finger nicht vom Halse des nach Atem ringenden Häftlings. Da schlug dieser leicht mit der Faust dem Irren unter das Kinn. Die Hände lösten sich vom Halse, der Irre taumelte zurück, um, einen Wutschrei ausstossend, wie ein wildes Tier den Häftling anzuspringen. Aber schon legte ihm der schlanke, katzengeschmeidige Kreyer von hinten den einen Arm unter dem Kinn um den Hals und hob ihn, so tobend der Irre sich auch wehrte, sachte ein wenig vom Boden hoch. Zwei andere Wärter hielten je einen der schlegelnden Arme, und einer hing sich an des Irren schwebende, tretende Beine. Der Häftling schaute aufmerksam dem Vorgang zu; rasch eilte der Oberarzt mit dem Oberwärter herbei. Wieder trat der harte Zug in des Arztes Gesicht hervor; kalt sagte er:
„Herr Oberwärter, geben Sie dem Roser eine ganze Spritze Scopolamin!“
„Ich hab’ die schon in Bereitschaft, Herr Doktor,“ sagte lächelnd der Oberwärter. Mit einem Ruck fuhr die Nadel in den Arm des Irren; er schrie gellend:
„Sie stechen mich wieder, sie stechen mich, die verdammten Hunde!“
Langsam trugen die Wärter den Irren in sein Bett, sie hielten ihn immer noch wie in Schrauben fest. Der Häftling ging mit dem gleichmütigen, ruhigen Weber durch den Saal, durchschritt dann ein kleines Zimmer, in dem zwei Betten standen. Das eine war leer, und aus dem andern schrie ein älterer Mann, stossweise, immer wieder:
„Ho, ho, Mörder, vielfacher Mörder, Familienmörder.“ Dann schlug er sich mit der Faust die Brust, dass es dröhnte.
„Der Herr ist ein wenig unruhig jetzt, aber das gibt sich,“ sagte der blonde Weber im Vorübergehen, während sie in das zweite und letzte Zimmer traten. Auch darin standen zwei Betten; in dem gegen die Flurtür lag ein junger Mensch und schaute gross auf den Neuen. Der Häftling grüsste, der Kranke regte sich nicht.
„Frühzeitige Verblödung, Herr, aber harmlos wie ein Kind,“ erklärte Weber, dann sagte er interessiert: „Das war auch nicht das erstemal, dass Sie einem eine unters Kinn versetzten!“
„Nein,“ antwortete der Häftling ernsthaft, „ich kann ein wenig mit den Japanern umgehen; darum, Herr Weber, wird’s besser sein, Sie und Ihre Wärter fassen mich nie an wie den Verrückten da draussen im Saal.“
„Das wird wohl kaum notwendig sein bei Ihnen, Herr, ich glaube, wir werden schon gut auskommen miteinander!“ sagte gutmütig lächelnd der blonde Wärter, dann grüsste er und ging.
Ein älterer, mittelgrosser Wärter kam herbei. Der Mann war glattrasiert und hatte ein etwas pastorales Gesicht. Freundliche, braune Augen schauten den Häftling eine Weile an, dann wies der Wärter auf das Bett, das nahe dem Fenster stand.
„Das ist Ihr Bett, Herr, ziehen Sie sich jetzt aus und legen Sie sich hin, die Kleider hierher,“ er zeigte auf einen Stuhl, der vor einem der leichten Tische stand. Noch ein solcher Tisch, eine Waschkommode ohne Waschgeschirr und ein Nachttisch waren das einzige Mobiliar in dem Krankenzimmer. Der Häftling stand im Zimmer, schaute sich um und antwortete nicht. Vom Saale herein drang durch die verschlossene Tür immer noch das wilde Schreien des Tobsüchtigen, bis endlich die Spritze wirkte und die Schreie mählich zu gurgelndem Geräusch wurden. Der Häftling zog seine kurze Tabakspfeife aus der Tasche, stopfte Tabak ein, zündete ein Streichholz an und begann zu rauchen. Dabei beobachtete er seinen Wärter, der sagte vorwurfsvoll:
„Aber, Herr, auf dieser Station darf nicht geraucht werden.“
„Das weiss ich,“ sagte der Häftling und rauchte ruhig weiter.
So strich langsam eine Spanne Zeit dahin, der Häftling rauchte, ruhig auf seinem Stuhl sitzend, eine Pfeife nach der andern. Der Wärter schaute dann und wann verstohlen hin, dann lächelte er, als ob er sagen wollte:
„Wart’ nur, Eigensinn, du wirst das bald lassen!“
Nach langer Zeit kam der Oberarzt ins Zimmer des Häftlings. Wieder schaute er diesen forschend an, dann fragte er:
„Sie rauchen gerne?“
Der Häftling antwortete lächelnd:
„Ja, und diese paar Pfeifen, die waren so etwas wie eine Henkersmahlzeit, Herr Doktor.“
„Na, dann rauchen Sie mal Ihre Henkersmahlzeit, bis wir uns besprochen haben,“ sagte der Oberarzt, dann fragte er sachlich: „Seit wann nehmen Sie Morphium?“
„Seit drei Jahren, Herr Doktor.“
„Und weshalb?“
„Weil ich’s gegen Schmerzen bekam bei meiner Verwundung.“
„Gewehrschuss oder Splitter?“
„Gewehrschuss.“
„Seit da nehmen Sie ununterbrochen?“
„Nein, ich hab’ mich vor mehr als einem Jahr selbst entwöhnt.“
„Und dann wieder genommen?“ fragte ungläubig der Arzt.
„Weil mir’s die Ärzte wieder gaben, nach der Ruhr, die ich vor einem Jahr hatte und die schwere Nachwirkungen hinterliess.“
„Na und jetzt?“
„Jetzt nehme ich immer noch, und zwar ganz hohe Dosen.“
„Ich weiss das aus den Akten des Gerichtsarztes; aber wollen wir nun beginnen, uns zu entwöhnen? Dafür sind Sie zwar nicht hier, sondern zur Beobachtung, aber ich meine —,“ sagte der Oberarzt so nebenbei, als wäre sein Vorschlag ganz alltäglich. Fragend und interessiert schaute er den Häftling an.
„Sie meinen ganz richtig, ich kann mich entwöhnen und Sie beobachten, aber rapid muss es geschehen, biegen oder brechen,“ antwortete der Häftling gelassen, wie ein Mensch, der sich mit etwas abgefunden hat.
„Wenn Sie die Spritze brauchen, dann rufen Sie mich,“ antwortete der Oberarzt.
Dann ging die Tür vom Flur rasch auf; ein grosser älterer Herr, mit gutem, klugem Gesicht, dessen Vollbart grau war, trat ein, sein weisser, langer Kittel flatterte. Er ging aufrecht und rasch wie ein Junger. Der Oberarzt verbeugte sich und sagte, auf den Häftling weisend:
„Herr Geheimrat, der Fall wegen Totschlags zur Beobachtung.“
Das Gesicht des Psychiaters wurde ernst, scharf sahen seine blaugrauen Augen in des Häftlings Gesicht. Der schaute dem Geheimrat ruhig in die Augen, als wollte er sagen: „Was könnt ihr mir denn tun; mit meinem Bündel auf dem Rücken werde ich schon allein fertig werden müssen, da könnt ihr hier mir auch nicht helfen.“
Plötzlich und unvermittelt fragte der Geheimrat mit scharfer Stimme:
„Schuldig?“
„Nein,“ antwortete der Häftling.
Noch eindringlicher stellte der Geheimrat die zweite Frage:
„Notwehr?“
„Ja!“
Scharf und hell, rasch, Wort auf Wort fiel Frage und Antwort, gleich wie zwei Schwertklingen aufeinander klingen.
Der Ernst verlor sich aus des Geheimrats Antlitz, freundlich schaute er eine Weile in des Häftlings Gesicht, dann fragte er:
„Woher haben Sie ihre schwarzen Haare und den Abruzzen-Bart, mal eine Grossmutter aus Italien gehabt, da von jenseits der Alpen?“
„Nein, Herr Geheimrat, meine Grossmutter hat Italien nie gestreift,“ antwortete der Häftling. Da reichte ihm der Geheimrat rasch, ganz gegen seine Gewohnheit, die Hand zum Abschied und wandte sich; er ging eilig in den Saal hinaus.
Der Häftling hörte, wie er im Weggehen zum Oberarzt sagte: „Er gefällt mir, er muss ganz gesund werden, Herr Doktor!“
Da entkleidete sich der Häftling langsam, er reichte Stück für Stück von seinen Kleidern dem Wärter hin, und als er das letzte gegeben, schlüpfte er unter die Decke und sagte:
„Wärter, verstauen Sie nun nach Ihrer Hausordnung die Kleider, und geben Sie Obacht, dass ich nicht durch das Schlüsselloch verschwinde.“
Der Wärter aber nahm hurtig die Kleider und Schuhe zusammen, trat unter die Saaltür und rief einem kleinen, schnauzbärtigen, älteren Wächter zu:
„Becherer, hier sind endlich die Kleider des Neuen, tragen Sie sie auf die Kammer!“
Der Häftling lag dieweil im Bett, die Hände unter dem Kopf, und schaute an die Decke hinauf, er murmelte vor sich hin:
„Jetzt kann der Tanz beginnen.“
Da erscholl vom anderen Bett her ein Lachen, als ob der Kranke bersten wollte, es schüttelte ihn vor Vergnügen. Freundlich fragte der pastorale Wärter:
„Na, Goldschmied, warum lachst du denn?“
Ächzend vor verhaltenem Lachen antwortete der Irre:
„Ach, Schätzle, ich freue mich ja so!“
Dann schmetterte er wieder sein Lachen hinaus, bis er keuchend, vor Zwerchfellerschütterung stöhnend, Atem schöpfen musste.
„Worauf freust du dich denn, kleines Goldschmiedchen?“ fragte Schätzle und lachte leise mit.
„Aufs Essen!“ sagte langsam und lachend Goldschmied.
Im Nebenzimmer aber hatte das Lachen den andern Kranken wieder aufgerüttelt, er schrie:
„Ho, ho, Mörder, vielfacher Mörder, Familienmörder!“ Dabei schlug er sich mit der Faust auf die Brust, dass es dröhnte. Durch die angelehnte Saaltür schob sich langsam und vorsichtig ein kugelrunder Schädel mit Augen wie Funken, brandrotem Schopfhaar und äugte nach dem Schreienden hin. Als der im Bette immer wieder sein stossendes „Ho ho“ schrie, verzog der rote Schädel unter der Türspalte grinsend seinen vollippigen Mund und sagte:
„Bei welchem Empfange ist denn nun der dabei, dass er so in einem fort ‚Hoch‘ schreien muss!“