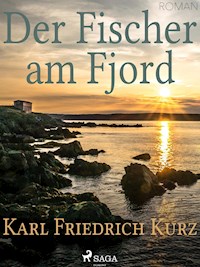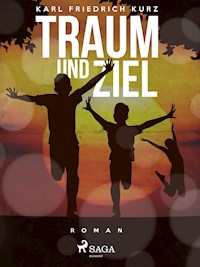Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Landarzt Dr. Hans Bohner ist eine angesehene Persönlichkeit. Das Leben schenkte ihm vieles, auch Amalie, eher eine tüchtige Hausfrau als leidenschaftliche Gefährtin. Doch alles ändert sich mit einem Schlag, als Bohner eines Abends Kutscher Martin zur Fahrt nach dem Stammtisch anspannen lässt. Der Wahnsinn der nächsten Stunden kündigt sich als Schimmer hinter der Glastür des Gasthofs an, durch ein helles Seidenkleid. Die Überraschung fährt Bohner in den Rücken, als er Rita wiedererkennt. Wenige wiegende Schritte, ein paar kaum gehauchte Worte und das ganze festgefügte Gebäude seines Daseins, Aufstieg, Erfolg, die solide Ehe, zerfällt beim Wiedersehen mit dieser Frau, die ihn einst verließ. Der Maskenball am nächsten Tag ist die einzige Möglichkeit, zusammen zu sein. Als Bohner sich am nächsten Abend in der Kutsche fiebernd vor Leidenschaft umzieht, hat er nicht an Kutscher Martin gedacht. Zu Tode erschrocken glaubt der, in dem Verkleideten den Teufel persönlich zu sehen und rennt davon. Bohner lässt sich davon nicht beirren und eilt zu Rita. Inzwischen geht das Gerücht um, der Leibhaftige habe den Doktor ermordet – in der verlassenen Kutsche findet man nur die Kleider und ein paar Tropfen Blut. Für den Doktor, der aus verständlichen Gründen die verräterische Maske nicht fallen lassen kann, beginnen wahrlich abenteuerliche Stunden, die in einer Verhaftung, Flucht und der vergeblichen Mühe ausarten, sich unerkannt von Handschellen zu befreien. Denn keiner seiner Freunde und Bekannte will ihm helfen: alle sehen in ihm nur den Satan persönlich ... Dr. Bohnens verteufelte Liebe – ein heiterer Gesellschaftsroman über eine versehentlich in Aufruhr versetzte Kleinstadt.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karl Friedrich Kurz
Die Geisterkutsche
Heiterer Roman
Die Geisterkutsche
© 1950 Karl Friedrich Kurz
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711518458
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Als könne sich hier nie etwas ereignen …
Da ist eine Straße. Es ist die Hauptstraße eines Städtchens weit hinten im Lande, in einer Gegend, die noch so gottgefällig unberührt blieb, daß ihr selbst die Eisenbahn fehlt. Wohl hört man in stillen Nächten den Pfiff der Lokomotiven und selbst das dumpfe Rädergedonner auf den Eisenschienen. Doch all das kommt von weit her, über einen Berg und einen großen Wald. Alle die Jahrhunderte lag das Städtchen abseits: vom breiten Heerweg, wo das Schicksal hitzig waltet, es lag am Eingang eines engen Bergtals, schlief und träumte, wenn draußen in der Welt gewaltige Taten vollbracht wurden.
Auch heute träumt es noch. Es verlangte nie nach rasendem Fortschritt, sondern war zufrieden mit seiner ehrwürdigen Ruhe.
Darum ist auch an dieser Straße nichts Besonderes, nicht die geringste Spur von Sehenswürdigkeit. Häuser hüben, Häuser drüben, ein Streifen gepflasterten Erdbodens dazwischen. Einige der Häuser sind alt; doch nicht alt genug, um als Rarität zu gelten. Die Pflastersteine sind grob und rund und glattgescheuert vom Tritt unzähliger Füße. Immerhin gibt es da und dort Anfänge von Bürgersteigen, ein paar Streifen Asphalt oder Zement, was fast sonderbar anmutet.
Es mag um die fünfte Abendstunde sein, eine stille Dämmerstunde im Märzen. In Winkeln, die die Mittagssonne noch nicht erreichen kann, ducken sich Häuflein kranken, schmutzigen Schnees. Im Wind aber, der zuweilen unruhig über die Dächer streicht, liegt die erste Frühlingsahnung.
Ein Wagen rasselt über die Pflastersteine heran. Obschon es nur eine kleine Kutsche ist, schwarzlackiert, mit blanken Fensterscheiben, lärmt es doch gewaltig unter den Rädern. Vor der Kutsche trabt ein Schimmel. Der Kutscher auf dem Bock trägt eine Mütze mit schwarzglänzendem Schild, an seinem Mantel blinken Messingknöpfe, und aus seinem roten Gesicht hervor wächst ein schreckhaft großer, struppiger und grauer Bart. Der Bart reicht von einem Ohr zum anderen. Es ist ein dicker Mann. Er heißt Martin.
Hinter der Straße liegt der Marktplatz mit dem großen, steinernen Brunnen, dem Rathaus und dem Gasthof zum Schwanen. Vor der Gasthofstür zieht Martin die Zügel an, und die Kutsche hält. Ein Herr steigt aus, mittelgroß, ein wenig rundlich.
All das ist so beruhigend alltäglich, die Straße, die Häuser, die wenigen Menschen auf der Straße, als ob sich hier niemals etwas Ungewöhnliches ereignen könnte.
Der Herr macht ein paar gemächliche Schritte, bleibt dann stehen und schaut sich um, ohne Neugierde. Er kennt die Gegend, von den zwitschernden Spatzen auf den Pflastersteinen bis zu den giebligen Ziegeldächern, und der zufriedene Ausdruck seines Gesichts bekundet, daß ihm das alles wohlgefällt.
In einer der brausenden Städte dort hinter dem Berg, wo es so viele Motorwagen auf Gummirädern und aller Welt Teufelei gibt, würde man Kutsche und Herrn überhaupt nicht beachten. Hier in dieser kleinen Stadt aber bedeutet es etwas. Jedermann kennt die Kutsche und achtet den Herrn, den Landarzt Doktor Hans Bohner, achtet ihn als einen der wenigen, auf die es in diesem Bergtal ankommt. Es wird also wohl doch keine Kleinigkeit sein, mit bärtigem Kutscher, blankem Wagen und rundem Schimmel bis vor die Gasthofstür zu fahren.
Der Doktor mag um die vierzig Jahre zählen. Im Schläfenhaar unter dem Hutrand zeigen sich einige graue Flöcklein. Ein wenig grau schimmert es auch aus dem gestutzten Schnurrbärtchen. Unter seiner Weste wölbt sich ein spitzes Bäuchlein. Aber das alles sind nur schüchterne Anzeichen, die neben dem frischen, rotwangigen Gesicht und den lustigen Augen gar nichts zu bedeuten haben. Mag der Doktor auch nicht länger ein Jüngling sein, so ist er doch noch ein junger Mann, satt von des Daseins Gütern und zufrieden mit allen Dingen und sich selber. Und so genießt er leichten Sinnes den Augenblick und freut sich über den erblassenden Himmel, über die alten Dächer und das vertraute Treiben der Straße.
Bis zu dieser Stelle ging der Doktor seinen Weg ruhig und zuversichtlich. Es war kein steiniger Weg, und er führte weder zu schroffen Höhen noch zu gefährlichen Abgründen. Es glich eher einer gemächlichen Fahrt auf weichen Polstern über ein ebenes Land.
Wahrlich, das Leben meinte es gut mit diesem Doktor. Es schenkte ihm vieles. Sobald er nur seine Hand ausstreckte, kamen die Dinge willig zu ihm. Das Leben schenkte ihm zur rechten Zeit auch die rechte Frau. Amalie, eine tüchtige Hausfrau, eine überaus kluge Frau, keine aufreizende Schönheit, nein; aber die Frau, die ihren Hans in ein schönes Haus führen konnte.
Amaliens Schätze lagen mehr im Verborgenen. Auch damit war der Doktor zufrieden. Es ging ihm gut. Er verlangte nicht mehr nach brausender Leidenschaft.
Einst war er ein wilder Knabe. Das ist längst vorbei. Das ist längst vergessen. Zwar bleibt der Knabe immer der Vorgänger des Mannes. Aber der Doktor fand sich leicht zurecht in den Forderungen des gesitteten Alltags, überwand den Knaben und trat ein in den Kreis, der ihm vorgezeichnet worden. Überall füllte er seinen Platz aus und wurde bald das, was er jetzt ist, ein nützliches Mitglied der Gesellschaft und eine Respektsperson.
Über die Schulter sagt er: „Um halb zwölf fahren wir zurück, Martin.“
Und der Kutscher nickt. „Jawohl, Herr Doktor, um halb zwölf.“
Eine Stunde wird bestimmt. Alles gleitet sanft dahin. Alles ist geregelt mit Pflichten und Freuden. Jetzt geht der Doktor zum Stammtisch, zu Bier und Kartenspiel. Zweimal in der Woche fährt er aus seinem Dorf hinein in die Stadt. Festgefügt ist die Ordnung, die im Leben dieses Mannes herrscht.
Aber nun kommt etwas, das nicht vorgesehen ist im Stundenplan. Das kündet sich an durch einen Schimmer hinter der Glastür des Gasthofs, durch ein helles Seidenkleid, einen Frauenkopf mit dunklem Haar, durch etwas Fremdes. Nie zuvor sah der Doktor Ähnliches. Er starrt darauf in gespannter Erwartung. Ein kaltes Prickeln rieselt ihm vom Scheitel bis zur Sohle. Mit einem Schlage wird alles um ihn geheimnisvoll und schicksalhaft. Blitzhell schießt eine Ahnung von Unfaßbarem in ihm auf, blendet ihn, verschlägt ihm den Atem.
Die Tür öffnet sich. Festgebannt auf seinem Platze steht der Doktor, das Unentrinnbare erwartend. Es schwebt heran, überraschend, unglaubhaft wie ein Traumbild, wie eine heidnische Göttin mit strahlenden Augen unter hohen Brauenbogen und rotem Mund, weichem, rotem Mund. Die Augen richten sich auf den gelähmten Doktor. Um die Lippen huscht ein scheues Lächeln.
„Herr im Himmel …“, murmelt der Doktor fassungslos. Seine Wangen werden zu Eis, und seine Zunge wird zu einem Holzstück. Die Überraschung fährt ihm als heftiger Stich in den Rücken. „Herr im Himmel …“
Fünf Schritte mögen es sein bis zur Gasthofstür. Keinen Fuß rührt der Doktor. Er läßt die liebliche Unheimlichkeit an sich herankommen.
Jetzt sind es nur noch zwei Schritte. „Äpfelchen“, flüstert der lächelnde Mund. „Kügelchen … Guten Abend, Hänschen!“
Vielleicht sind es keine Worte, sondern es ist nur ein Hauch, ein leiser Seufzer. Vielleicht bildet der Doktor sich das nur ein. Was kann er denn hören, wenn ihm das Blut so gewaltig in den Ohren rauscht. In seiner Verwirrung greift er nach dem Hut.
Des Doktors Hut hängt frei in der Luft. Alles wird schwärzeste Zauberei. Des Doktors Arm versteinert sich. Um seinen Körper liegen die Kleider wie Blech. Die fremde Frau verhexte ihn.
Vor wenigen Augenblicken stand auf diesen runden, groben Pflastersteinen ein selbstbewußter Landarzt und eine anerkannte Respektsperson. Dann ereignete sich ein Wunder in der Welt.
Mit wenigen wiegenden Frauenschritten trat das Schicksal an einen Mann heran. Ein paar kleine, kaum gehauchte Worte aus süßem Frauenmund vollbrachten die jähe Wandlung. Ein würdiger Mann wurde aus seiner sichern Bahn geschleudert. Da steht er jetzt, hölzern, steinern, verzagt. Seine Welt, die ihm eben noch zuverlässig erschien, schwankt unter ihm. Viele Jahre seines Lebens, Aufstieg, Erfolg, die solide Ehe mit Amalie, das ganze, festgefügte Gebäude seines Daseins zerfließt zu einem Nebelstreif, der im Glutmeer eines Sonnenbrandes verdampft. Ja, da steht er und entsinnt sich nicht, daß es vor kurzem einen Doktor Bohner gab.
Aus friedvoller Alltäglichkeit der Straße erhob sich das große Abenteuer. „Margrit“, stammelt er atemlos. „Nein, Rita, nein … Wie sollte das je möglich sein?“ Er blinzelt, geblendet von der grellen Wirklichkeit.
„Hab ich dich erschreckt, mein liebes Hänschen?“ fragte in heiterer Besorgnis eine weiche Stimme.
„Armes Äpfelchen, wie bist du bleich geworden.“
„Rita — sag, daß ich träume“, stammelt er.
„Setz deinen Hut wieder auf. Nein, Hänschen, es ist kein Traum.“
„Kein Traum, kein Geist … Rita, gib mir deine Hand, sonst glaube ich nicht daran. Deine Hand, Rita …“
Beide Hände reicht sie ihm hin und sagt: „Komm, Lieber, laß uns nicht länger hier stehn, unter den vielen Fenstern. Die Leute beobach ten uns. Komm, führ mich irgendwo hin.“
Eben werden auf dem Marktplatz die ersten Laternen angezündet. Der Kutscher Martin hat sein Pferd gewendet und fährt davon. Die Wagenräder rasseln. Beim Brunnen spielt eine Kinderschar; ihr jauchzender Gesang übertönt schrill das Rädergerassel. Der Doktor schreitet an Ritas Seite.
Ein zarter Duft weht von ihr zu ihm herüber. Kein Wohlgeruch, wie ihn die Damen des Städtchens ausströmen, nicht Veilchen, nicht Flieder. Es ist etwas Fremdes, Unbekanntes, süß und verwirrend wie die Sünde selber.
„Du hast mich überfallen und niedergeschmettert, Rita“, gesteht der Doktor mit Herzklopfen in der Stimme. „Ja, und nun begreife ich das Leben nicht länger … Dein Arm streift mich. Rita, Rita, du hast mich in einen Abgrund gestoßen.“
Sie lacht leise, tief unten im Halse. Sie lacht wie ein kleines Mädchen beim Spiel. „Oh, ich wollte dich überfallen, Äpfelchen, aber ich wollte dich nicht niederschmettern. Wie freute ich mich doch auf diesen Augenblick — seit Jahren.“
Er schüttelt den Kopf und wiederholt: „Seit Jahren … Wie soll ich das auslegen?“
„Ich dachte an dich“, sagt sie leise.
„An mich? Nein, Rita, nun wird es aber zuviel. Ich sehe deine Augen, und ich höre deine Stimme. Ich fühle, daß du die Wahrheit sagst.“
„Wann hätte ich dich je belogen, Äpfelchen?“ fragt sie einfach. „Ich dachte an dich, alle die vielen Jahre.“
„Deine Augen blicken zu mir hin wie strahlende Sterne“, sagt er und verfällt unbewußt in die Sprache der entschwundenen Jugend. „Wunderbar wie früher sind deine Augen. Und deine Stimme dringt mir bis in die Seele. So müssen wohl die Harfen der Engel klingen, wenn es einen Himmel gibt. Aber ich habe gar zu lange glauben müssen, daß du mich vergessen hast. Rita, du gingst von mir.“
„Ja, aber jetzt bin ich wieder zu dir zurückgekommen.“
„Wann kamst du? Und was willst du hier?“ fragt er bang.
„Gestern abend kam ich. Ich sehnte mich nach der Stätte meiner Jugend. Noch einmal wollte ich das Städtchen sehen, die alten Häuser. Noch einmal wollte ich die Sprache, die Stimmen dieser Menschen hören.“
„Die Häuser, die Sprache …“, murmelt er.
„Und dich wollte ich sehen. Doch so vieles hat sich hier verändert. Unsere alten Häuser finde ich nicht mehr. Auch du, Äpfelchen, bist nicht mehr so wie einst.“
Er senkt den Kopf und sagt bedrückt: „Die Zeit fährt über uns hin. Die Zeit nimmt alles mit. Man kann sich nicht dagegen wehren.“
Da wird auch ihre Stimme klanglos. Sie gesteht: „Daran habe ich nicht gedacht. Ich nahm die alten Bilder mit mir fort.“
„Nur an deinen Augen erkannte ich dich, Rita, und an deiner Stimme.“
Sie gehen ein Stück weiter. Dann erzählt Rita: „Noch gestern in der Nacht lief ich durch die Straßen. Ach, Lieber, ich fand unsere Gasse nicht mehr. Ich fragte ein kleines Mädchen nach der Rebengasse. Es schaute mich verwundert an und schwieg. Die Häuser unserer Jugend sind nicht mehr, unsere Gärten sind verschwunden.“
„Sie mußten der Entwicklung weichen.“
„Gibt es denn dergleichen auch hier? Entwicklung?“
Er lächelt matt: „Dort, wo wir als Kinder spielten, führt jetzt eine Brücke über den Bach.“
„Darum habt ihr die Häuser niedergerissen?“
„Es waren alte Häuser, Rita.“
„Es waren unsere Häuser. Früher lagen große Steine im Bach. Bei niedrigem Wasser sprangen wir von einem zum andern. Erinnerst du dich daran? Du hieltest mich bei der Hand …“
„Und bei Hochwasser trug ich dich hinüber, Rita. Du hattest zwei schwarze Zöpfe damals. Dein Haar duftete nach Heckenrosen.“
„Du erinnerst dich wirklich? Ja, nach Heckenrosen, das hast du damals behauptet.“
„Ob ich mich erinnere? Immer, wenn die Heckenrosen blühn, laß ich meinen Wagen am Wege halten. Ich pflücke mir eine Handvoll …“
„Ja?“ fragt sie. Es ist ein verhaltenes Schluchzen.
„Dann sitze ich mit geschlossenen Augen und denke an dich.“
„Ist das wahr? Du denkst an mich? Immer noch?“
„Immer noch. Ich denke an das, was gewesen. Aber die Heckenrosen sind Blumen von einem Grab.“
„Sag das nicht! Geh ich denn nicht wieder an deiner Seite?“
„Allzulange bliebst du fort, Rita!“
„Aber vorhin, den ganzen Abend, stand ich am Fenster und wartete auf dich. Ich hörte, daß du kommen würdest. Mir wurde so bang. Ich weiß nicht, war es Freude oder Weh. Ich fürchtete mich.“
„Welch ein Abend, Rita! Die Leute erzählten dir wohl einiges? Und nun weißt du, wie es mit mir steht?“
„Vieles erfuhr ich, liebes Hänschen, und einiges erfuhr ich, was ich gar nicht fassen kann.“
„Wohl vor allem, daß ich Amalie heiratete?“
„Gerade Amalie Hiller, die du einst nicht leiden mochtest.“
„Das geschah mehr aus Verzweiflung — diese Heirat … ich weiß selber nicht, wie es kam. Als du von mir gingst …“
„Kann man aus Verzweiflung heiraten?“ fragt sie fassungslos.
„Oder aus Trotz. Nein, es war wohl auch nicht das. Mir wurde nur alles so gleichgültig in der Welt. Ich ließ mich treiben, und ich wollte vergessen, irgendwie darüber hinwegkommen.“
„Dabei bist du ein mächtiger Mann geworden, Äpfelchen. Auch dieses hätte ich von dir nie erwartet.“
„Nicht? Welche Rolle hast du mir denn zugedacht?“
„Lieber, Lieber! Es fiel nie ein unfreundliches Wort zwischen uns. Unsere Freundschaft war fleckenlos.“
„Unsere Liebe war fleckenlos …“
Sachte bestätigt sie: „Ja, unsere Liebe. Nie hast du mich enttäuscht. Und du warst doch ein unbändig wilder Knabe —- ein Feuerkügelchen. Immer hattest du rote Wangen. Darum nannte ich dich Äpfelchen und Kügelchen. Und du littest es. Nannten andere dich so, sprangst du ihnen an den Hals. Außer dir fand ich keinen Freund in meinem Leben.“
„War es das, was dich zurückzog?“ fragt er schnell.
„Ja, das war es vielleicht.“ Leise fügt sie hinzu:
„Doch ich mußte also erfahren, daß ich alle die Jahre träumte wie ein kleines Mädchen. Ich träumte dort weit unten, unter einem andern Himmel; das Leben aber nahm seinen Lauf und kümmerte sich nicht um meinen Traum. Sieh, Äpfelchen, ich bin in der Entwicklung zurückgeblieben. Bei mir ist noch ungefähr alles so wie damals, als du mit mir über den Bach sprangst, als du mich in deinen Armen von Stein zu Stein trugst und ich noch zwei schwarze Zöpfe hatte, die nach Heckenrosen dufteten.“
„Rita, Rita“, stöhnt er. „Schweig. Sei gnädig!“
„Gewiß handelte ich töricht. Vergib, Lieber, deinem kleinen, dummen Mädchen, das sich so wenig auskennt in den Irrgängen des Lebens.“
„Und das alles sagst du mir heute!“ ruft er heftig. „Warum quälst du mich? Bis heute hatte ich die Blumen von einem Grab …“
„Ich konnte es dir nicht vorher verraten, Lieber. Ich wollte nicht deine Zukunft gefährden. Nach der unseligen Tat meiner Mutter.“
„Daran bist du unschuldig.“
„Ich weiß, ich weiß. Doch wir kamen ins Gerede. Du wärest treu zu mir gestanden. Dennoch — ich war so schrecklich arm. Gewiß, vieles wäre dennoch möglich gewesen. Mir fehlte nur Mut und Entschlossenheit, ich wagte nicht den Kampf aufzunehmen. Ja, so war ich — und so bin ich leider noch heute, verzagt und schwach der Wirklichkeit gegenüber.“
„Du wagtest aber die weite Reise hierher“, meint er zweifelnd.
„Die Reise wagte ich. Doch ich kam zu spät, viel zu spät. Es kann daraus nur ein Abschiednehmen werden. Ein paar Stunden bleiben uns …“
Unter einem heftigen Schmerz duckt er sich.
„Nein, nein! Das meinst du wohl nicht! Das wäre wenig und ungeheuer viel. Ein paar Stunden, Rita? Gütiger Gott — wie sollten wir nachher weiterleben und die Trennung ertragen?“
„Wir werden schwer daran tragen“, gesteht sie mutlos. „Ich handelte töricht … Aber es war alle die Jahre eine Sehnsucht in mir, ein unstillbares Verlangen. Heute muß ich erkennen, daß mein Wunsch unerfüllbar ist.“ Sie besinnt sich und sagt dann ohne Scheu: „Denk an eine Blumenknospe, die es nicht verhindern kann, sondern aufbrechen muß. Ja, so war es. Die Blumenknospe weiß nicht, was mit ihr geschieht. Sie öffnet sich der Sonne. Nein, du begreifst das wohl nicht.“
„Sei sicher, ich verstehe, wie du es meinst, die Blumenknospe und alles. Und wenn ich dich so reden höre, Rita, muß ich alles vergessen, was hinter mir liegt, und ich meine, du habest mich nie verlassen. Ja, ich denke genau so wie du. Erst in diesem Augenblicke wird mir klar, daß mein Leben nichts war und nichts sein konnte ohne dich. Nur in dir allein liegt für mich Erfüllung.“
Mit Tränen in der Stimme wiederholt sie: „Keine Erfüllung. Kein Glück. In tausend Nächten fragte ich, was ich tun könnte, doch ich fand weder Mittel noch Weg. Mag es uns nun wieder neuen Schmerz bereiten, dennoch war es gut, daß ich zu dir kam. So konnte ich dir endlich alles sagen. Und ich durfte deine guten Worte hören. Wir wissen hinfort beide, daß wir uns nicht ganz verloren haben.“
Er legt den Arm um ihre Schultern, und so schritten sie in die Nacht hinaus, mit gesenkten Köpfen, und jedes dachte seine eigenen Gedanken.
„Woher kamst du, Rita?“ fragt er.
„Weit dort unten lebte ich, auf Sumatra, in einem Ort, der Mangala heißt.“
„Und von Mangala fuhrst du hierher?“
„Zuerst war ich in Italien und dann in Paris. Ich fürchtete mich vor dem nordischen Winter.“
„Wie ein Märchen klingt das. Mangala? Ich kann es noch nicht fassen — du kamst wirklich zu mir, Rita?“
„Und kam also zu spät.“
Darauf schweigen sie wieder.
„Mangala?“ fragt er. „Sumatra? Darum bist du so gelb und fremdländisch in deinem Gesicht … Mangala …“
„Die vielen, vielen Jahre unter jenem Gluthimmel blieben nicht spurlos. Das Leben ist dort so ganz anders als hier.“
Darauf sagt er: „Du gingst von mir ohne ein Wort. Du verschwandest spurlos in der Nacht. Du hast mir nie geschrieben …“
„Lieber Gott, das kam doch so schnell, so völlig unerwartet, und ich war so verstört. Mit meinem Vater stand es noch schlimmer. Daß meine Mutter ihn betrog, hat er nie überwinden können. Wir gleichen dem Efeu — wir sterben, wo wir uns festklammern. Mein Vater floh mit mir.“
„Nach Sumatra?“
„Er hatte einen Bruder dort unten, einen Pflanzer. Damit begann für uns beide ein neues Leben.“
Eng umschlungen schritten sie dahin. Sie hatten kein Ziel. Aber sie schritten auf den alten Wegen, durch die Gärten ihrer Jugend. So kamen sie zur neuen Brücke.
Und sie schritten über die Brücke, auf der Straße der großen Ebene zu. Der Doktor ergriff Ritas Hand und sagte dumpf: „Dämmerig, gerade und eben wie diese Straße, so lag mein Leben vor mir. Ein Leben ohne Höhen und Tiefen. Ich nahm es ohne Murren hin, als mein Geschick. Ich war nicht unglücklich, nicht einmal unzufrieden. Längst vergaß ich, daß es anders hätte sein können …“
Rita dreht sich um und sucht in der vom schwachen Mondschein mit Silberstift gezeichneten Landschaft. „Wuchsen nicht hier einst Bäume?“ fragt sie. „Waren es nicht Buchen und mächtige dunkle Ulmen? Ein finsterer Wald schien es mir. Unser Wald.“
„Unser Wald — auch er mußte fallen. Auch das ist Entwicklung. Es ist der gewöhnliche Lauf der Dinge. Für uns aber entwickelt sich alles so seltsam, und der gewöhnlichen Dinge Lauf wird uns schmerzhaft … Ja, und hier an dieser Stelle sollst du auch noch dieses erfahren, Rita: In unsern Wald floh ich damals. Bei Tage suchte ich unsere Zeichen in der Rinde der Bäume, und nachts tastete ich mich von Stamm zu Stamm und flüsterte deinen Namen. Ja, Rita, ich rief nach dir. Nicht viel mehr als ein Knabe war ich, doch ich litt wie ein Mann.“
Über der fernen Ebene liegt die Dunkelheit wie ein dickes, braunes Tuch. Die Straße schimmert fahl daraus auf — ein zerfließender Strich durch bleiche Unfaßbarkeit.
„Armes, liebes Äpfelchen“, murmelt Rita. „Du riefst nach mir, und ich hörte dich nicht. Ja, ich ahnte nicht, daß du so schwer daran trugst.“
Vorwurfsvoll sagt er: „Wenn du mir wenigstens geschrieben hättest. Auf ein Wort von dir hoffte ich, auf ein kleines Zeichen. Dann hätte ich auf dich gewartet bis zu meiner letzten Stunde, oder ich wäre dir gefolgt bis ans Ende der Welt. Dein Schweigen veränderte meine Zukunft, und es erdrosselte meine Seele.“
„Ich schrieb dir, Lieber!“ ruft sie. „Oh, ich schrieb dir viele Briefe, viele lange Briefe. Alles, alles gestand ich dir.“
„Kein einziger kam in meine Hände“, sagt er ungläubig.
„Nein, ich sandte sie nicht ab. Weil ich wußte, daß du auf mich gewartet hättest oder mir gefolgt wärst. Ich meinte, das dürfe nicht sein. Oh, ich hätte sie dennoch absenden sollen, meine Briefe. Erst jetzt verstehe ich, daß alles nur Schwäche und Feigheit war. Aber so wartete ich von Tag zu Tag und von Jahr zu Jahr. Worauf ich wartete, weiß ich nicht. Aber dann starb mein Onkel. Er war unverheiratet. Die Pflanzung fiel auf meinen Vater. Im letzten Winter starb mein Vater. Jetzt bin ich allein.“
„Jetzt bist du frei?“
„Ganz frei.“
„Und reich …“
„Und reich, ja. Ich versteh zwar nicht viel von Geld und solchen Dingen. Doch ich glaube, ich kann mir alles kaufen, was ich wünsche — bis auf das Glück.“
„Und“, fragt er bang, „was wirst du nun tun?“
„Wie?“ fragt sie erstaunt. „Ich kehre zurück nach Mangala. Was könnte ich denn anders tun? Übermorgen fahre ich nach Holland, nach Rotterdam. Am Montag geht mein Schiff.“
„Ist das so bestimmt?“ fragt er in einem Ton, worin heiße Angst zittert.
„So bestimmte ich es.“
„Muß es denn sein, liebe Rita?“
„Aber Hänschen, liebstes Äpfelchen — begreifst du nicht? Was soll ich noch hier? Ich unternahm diese Reise; ich machte einen kleinen Seitensprung. Hernach muß das Leben weitergehen.“
„Das sagst du so leicht“, wendet er ein. „War es nur ein Seitensprung?“
„Großer Gott — nein! Nein, für mich war es etwas Unaufschiebbares. Es ist Nacht. Ich sehe dein Gesicht nicht. Ich erkenne deine Gestalt nicht. Doch ich fühle deine gute Nähe. Du bist wieder mein kleiner, tapferer Ritter.“
Ergriffen von unbändigem Verlangen beugt er sich vor und küßt sie. Er meint, das sei der Gipfel seines Lebens. Er meint, es sei der Abschluß seines Erdendaseins.
In befremdender Starrheit überläßt sie sich ihm. Mit keiner Bewegung wehrt sie sich gegen seinen Sturm; aber sie erwidert nicht seine Küsse. Verwirrt fragt er: „Weinst du, Rita? Weine nicht …“
In kindlicher Unbeholfenheit hascht sie nach seinen beiden Händen, nach seinen fieberheißen, flatternden Händen, preßt sie gegen ihr Herz und flüstert: „Achte nicht darauf. Nein, das sind keine Tränen, mein liebes Äpfelchen. Es sind ungesprochene Worte. Laß uns wieder zurückkehren, zu den Häusern, zu den Menschen, zur Wirklichkeit.“
Dumpf, bebend vor Erregung sagt er: „Zu den Menschen? Gibt es denn für mich noch Menschen nach dieser seligen Stunde? Nein, Rita. Nur wir beide sind noch auf der Welt, nur wir beide, und dort oben der Mond, der unseren Weg beleuchtet. Laß uns jetzt auf dieser Straße weitergehen, immer weiter, bis wir uns in der Nacht verlieren. Laß uns alles vergessen, was dort hinter der Brücke liegt. Und wo der Weg zu Ende geht, wollen wir gemeinsam sterben.“ Ja, da fängt dieser Mann noch einmal an zu glühn und wird wieder zum wilden Knaben, der mit seinen Händen die Sterne vom Himmel holen möchte.
Und sie lauscht in glücklichem Erstaunen dem Ausbruch. „Genau so warst du früher“, ruft sie zwischen Lachen und Weinen, „so hitzig und maßlos. Jetzt bist du wieder mein liebes Feuerkügelchen. Du wärest wohl imstande, eine Dummheit anzustellen. Bedenke aber, ich habe schon ein paar Silberfäden im Haar, und du, Hänschen, hast eine Frau.“
Als er darauf finster schweigt, sagt sie noch: „Wir sind ja toll, alle beide.“
„Sag ein Wort, Rita, nur ein kleines Wort, und ich ziehe mit dir hinaus, nach Sumatra, oder wohin du willst“, stöhnt er.
Und das trifft. Ja, das trifft eine Stelle in ihr, die schwach ist. Ihn mit sich nehmen in ihren sonnigen Garten, das war doch ihr geheimer Gedanke. Ihre Stimme zittert; aber sie muß fragen: „Würdest du so viel wagen, Lieber?“
Doch nun zaudert er, nur einen Pulsschlag lang. Er schrickt wohl selber zurück vor dem gewagten Sprung. Dann ruft er laut und in finsterer Entschlossenheit: „Alles wage ich für dich und unser Glück!“
Aber sein Zaudern entging ihr nicht. Und sein Versprechen klingt nicht ganz echt. Nie zuvor hat sie an seinem Wort gezweifelt. Im Schreck preßt sie ihre Hände auf die Brust. Mit einem Ruck steht sie still.
„Was ist denn, Rita, was?“ fragt er.
„Nichts, nichts … Waren da Stimmen im Wald?“ Sie lauschen. Und sie hörten keine Stimmen im Wald.
Nur der Zauber war gebrochen. Er zerbrach wohl nicht ganz, der mächtige Zauber, der die Märchenprinzessin aus ihrem Palmengarten in den rauhen Norden lockte. Nur sein Wunderglanz verblaßte ein wenig.
Die Prinzessin sagt jetzt ruhig: „Nein, mein liebes Äpfelchen, wir wollen nicht in die Nacht hinausgehen und miteinander sterben. Und es würde dir nicht leicht fallen, dein früheres Leben aufzugeben, um ein neues zu beginnen. Die Heimat läßt dich nicht mehr los.“
„Rita, du willst mich ein zweites Mal verlassen!“ ruft er verbittert.
„Was kann ich dagegen tun?“ fragt sie klagend.
„Sag, Lieber, was kann ich tun?“
„Und wenn es schon ein Abschied sein muß, so schenk mir eine Nacht.“
„Herr im Himmel …“, ruft sie.
„Wir treffen uns morgen abend.“
„Unmöglich! Wo denn? Wie?“
„Ich hole dich in meinem Wagen ab, wenn es dunkel ist …“
„Nein, bist du bei Sinnen? Hier, wo dich jedes Kind kennt! Man müßte uns entdecken. Und dann: welche Schande! Und wie würde es dir schaden!“
Er verbessert sich: „Wir fahren in eine große Stadt, wo uns niemand kennt.“
„Kannst du das? Kannst du für eine Nacht verschwinden?“
„Wie bist du grausam, Rita!“ ruft er. „Wie bist du hart. Reiß mir das Herz aus der Brust oder schenk mir die Nacht — nur eine einzige Nacht.“ Angesteckt von seiner Verrücktheit sagt sie schnell: „Ja, ja!“ Und sie schmiegt sich an ihn und schließt die Augen. „Oh, Lieber, ich gehörte dir in tausend Nächten“, flüstert sie.
„Rita!“ jubelt er.
„Gehörte ich denn nicht dir von Anfang an? Aber gibt es ein Plätzchen auf der weiten Welt für uns zwei arme, verirrte Kinder?“
Plötzlich kommt ihm ein guter Gedanke. „Morgen ist im Schwanen Maskenball. Morgen ist Freinacht. Morgen wird alles außer Rand und Band sein. Keiner wird uns beachten. Wir werden zwei Narren sein unter hundert anderen Narren.“
So kam es. Der Märchenschimmer verblaßte. Übrig blieb das rote Abenteuer. „Ja, ja“, sagte Rita abermals. Damit waren beide bereit, die Pforte ihres Paradiesgärtleins hinter sich zu schließen. Beide waren reif zum ewigsüßen Sündenfall.
„Alles werde ich ordnen!“ rief er begeistert.
„Verlaß dich auf mich, Rita.“
Der Plan mit dem Maskenball gefällt ihr. „Du mußt Danielsens Kleid tragen; er ließ es sich von der Hauptstadt kommen. Dann wird man dich für Danielsen halten, denn er ist ungefähr von deiner Gestalt.“
„Für wen wird man mich halten?“ fragt der Doktor mißtrauisch. „Danielsen — was ist denn das?“
„Mein Verwalter, ein Däne. Ich nahm ihn auf die Reise mit. Ein prächtiger Mensch.“
„Du bist verliebt in ihn“, sagte er hastig und finster.
„Ich?“ lacht sie. „Stände ich dann jetzt hier? Dummes Hänschen!“
„Dann ist er in dich verliebt“, behauptet der Doktor eigensinnig. „Gesteh es nur.“
„Möglich. Ja, ich glaube, daß er mich heimlich liebt, Äpfelchen. Doch er ist so schüchtern, daß er es mir nie offenbaren wird.“
„Zur Hölle mit dem ganzen Mann Danielsen und seiner heimlichen Liebe!“
„Du wirst morgen seine Tracht anziehen, Hänschen. Das geht fein. Übrigens weiß kein Mensch im Städtchen, wer ich bin. Ins Fremdenbuch trug ich den Namen unserer Pflanzung ein.“
„Großartig! Dann wären wir vollkommen sicher nach allen Seiten hin!“ ruft er eifrig.
Ja, es sei wirklich ein glänzender Einfall, meinen sie beide. „Aber jetzt laß uns umkehren“, bittet Rita.
„Wenn es doch sein muß“, seufzt er und nickt. „Send mir das Dänenkostüm nach Endingen. Bei mir zu Hause darf ich natürlich nichts verraten.“
„Nein, das darfst du wohl nicht“, bestätigt sie mit leisem Spott.
„Nein, wir müssen vorsichtig sein.“
„Wir werden sehr vorsichtig und vernünftig sein, Äpfelchen.“
„Du erinnerst dich noch an das kleine Waldhaus an der Landstraße? Es steht heute noch ebenso verlassen wie ehemals.“
„Morgen früh schick ich Danielsen selber hin. Er ist zuverlässig.“
„Alles ganz ausgezeichnet!“ frohlockt er. „Abends fahr ich dann vorbei und kann mich im Wagen umziehen.“
Da wird Rita ängstlich: „Und dein Kutscher?“
„Ho, Martin! Martin, dieses Schaf und Murmeltier … Ich geb ihm einen kleinen Wink, und er ist noch zuverlässiger als dein Däne!“
„Er wird sich Gedanken machen.“
„Martin — und Gedanken“, ruft der Doktor.
„Ho, Martin!“ lacht er.
„Ja, ja“, nickt Rita und läßt sich willig überzeugen. „Wir werden uns im Ballsaal treffen. Das fällt gar nicht auf. Und jetzt ist mir wie damals, wenn du mich über den Bach trugst — ich freue mich und es gruselt mir.“
„Ich werde ein sicheres Winkelchen für uns finden.“
Sie lacht verschämt. Dann ruft sie: „Nein, wie jung ich doch noch bin!“ Und sie wundert sich sehr darüber.
„Alle Tage deines Lebens wirst du ein kleines Mädchen bleiben“, versichert er ihr unter überzeugenden Küssen.
„Sieh, Hänschen, da sind wir ja schon bei der Brücke.“