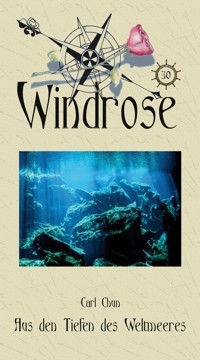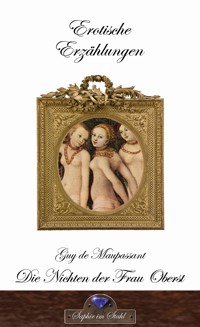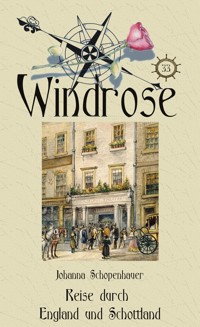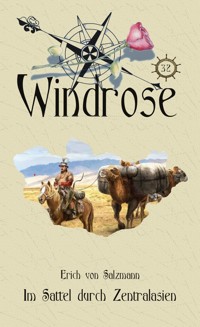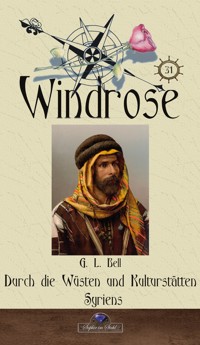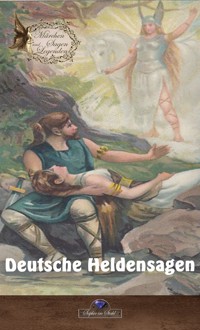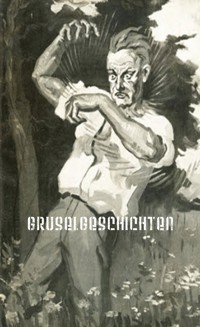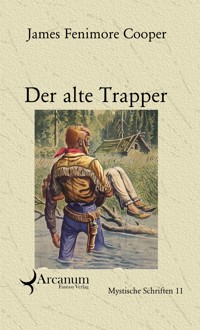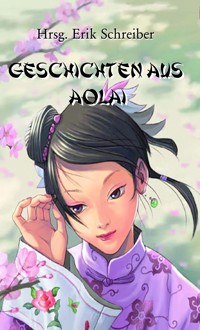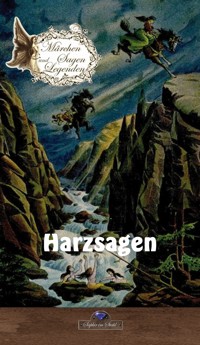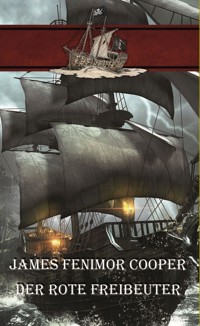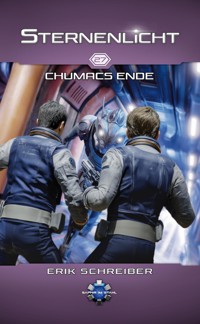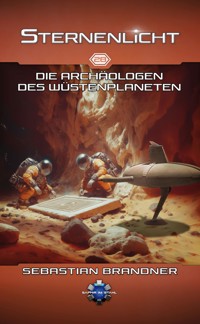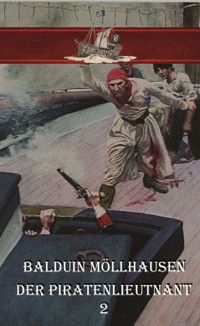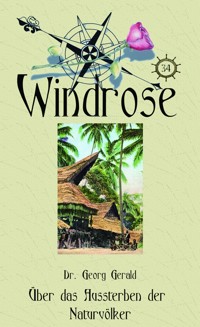
4,99 €
Mehr erfahren.
Die Reihe "Windrose" aus dem Verlag Saphir im Stahl publiziert alte Reiseberichte namhafter Forschungsreisender. Die Forschungsreisenden vom 18ten Jahrhundert bis zum 20sten Jahrhundert zeigen die Unterschiede zwischen dem heutigen Wissen und dem damaligen Forschungsdrang. Auf diese Weise lernt man in der heutigen Zeit dessen Wissenstand der Vergangenheit kennen und die Entdeckungsreisen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Herausgeber
Erik Schreiber
Windrose 34
Reiseerzählungen
Dr. Georg Garland
Über das Aussterben
der Naturvölker
Saphir im Stahl
Windrose 34
Reiserzählungen
e-book 319
Dr. Georg Gerland - Über das Aussterben der Naturvölker (1868)
Erscheinungstermin 01.11.2025
© Saphir im Stahl Verlag
Erik Schreiber
An der Laut 14
64404 Bickenbach
www.saphir-im-stahl.de
Titelbild: Archiv Andromeda
Lektorat Peter Heller
Vertrieb neobook
Der Verlag Saphir im Stahl ist Mitglied des
Netzwerkes „schöne bücher“, eine
Vereinigung unabhängiger Verlage
Herausgeber
Erik Schreiber
Windrose 34
Reiseerzählungen
Dr. Georg Garland
Über das Aussterben
der Naturvölker
Saphir im Stahl
ÜBER DAS AUSSTERBEN DER NATURVÖLKER
VON
DR. GEORG GERLAND,
LEHRER AM KLOSTER U. L. FR. ZU MAGDEBURG.
LEIPZIG,
VERLAG VON FRIEDRICH FLEISCHER.
1868.
SEINER EXCELLENZ
DEM HERRN GEHEIMEN RATH
H.C. VON DER GABELENTZ.
Vorwort.
Die Frage nach dem Aussterben der Naturvölker ist bis jetzt nur gelegentlich und nicht mit der Ausführlichkeit behandelt, welche die Wichtigkeit der Sache wohl verlangen kann. Am genauesten ist Waitz auf sie eingegangen in seiner Anthropologie der Naturvölker Bd. 1, 158-186; aber da auch er sie nur anhangsweise bespricht und in dem Zusammenhang seines Werkes nicht mehr als nur die Hauptgesichtspunkte angeben konnte und wollte; da er ferner manches nur andeutet oder ganz übergeht, was von großer Wichtigkeit ist, so erscheint es durchaus nicht überflüssig, die Gründe für dies „rätselhafte“ Hinschwinden selbständig und möglichst genau von neuem zu erörtern. Namentlich die psychologische Seite des Gegenstandes hat man bisher über die Gebühr vernachlässigt; sie wird deshalb in den folgenden Blättern besonders betont werden müssen.
Das Material zur Beantwortung der Frage, die uns beschäftigen soll, findet sich zerstreut in einer großen Menge von Reisebeschreibungen, ethnographischen und anthropologischen Werken. Da es mir aber darauf ankam, einmal, denn nur strengste Empirie kann uns bei unserer Frage fördern, meine Sätze durch getreue Quellenangabe zu stützen, und andererseits, dass die angeführten Zitate nicht allzu schwer zugänglich seien, um nachgeschlagen werden zu können, so habe ich mich, wo es möglich war, auf Werke gestützt, die weiter verbreitet sind, und den Quellennachweis nur da weggelassen, wo das Gesagte in allen Reisewerken sich gleichmäßig findet. Dass ich das schon erwähnte ausgezeichnete Werk meines nur allzu früh verstorbenen Lehrers Waitz, die Anthropologie der Naturvölker, sehr reichlich benutzt habe, wird man nicht tadeln; man findet dort die oft sehr schwer zugänglichen Quellen in kritischer Auswahl beisammen, und wozu werden solche grundlegenden Werke geschrieben, wenn man nicht auf ihnen weiterbaut?
Ich stelle hier der Übersicht und des bequemeren zitierens wegen die Werke zusammen, welche ich als Belege benutzt habe, ohne die mit anzuführen, welche nicht öfters zitiert sind. Einige, welche ich gern gehabt hätte, sind mir unzugänglich geblieben.
Angas, Savage life in Australia and N. Zealand. London 1847.
Australia felix. Berlin 1849.
Azara, Reise nach Südamerika in den Jahren 1781-1801 (Magazin der merkw neuen Reisen. Bd. 31. Berlin 1810).
Bartram, Reisen durch Karolina, Georgien und Florida 1773. (eb. 10. Band). Berlin 1793.
Beechey, Narrative of a voyage to the Pacific (1825-28). London 1831.
Behm, Geographisches Jahrbuch. 1. Teil 1866. Gotha 1866.
Bennett, Narr. of a whaling round the globe 1833-36. London 1840.
v. Bibra, Schilderung der Insel Vandiemensland bearbeitet v. Röding. Hamburg 1823.
Bougainville, Reise um die Welt 1766-69. Leipzig 1772.
Bratring, Die Reisen der Spanier nach der Südsee. Berlin 1842.
Breton Excursions in N.S. Wales, W. Australia and V. Diemensland. London 1833.
Browne, N. Zealand and its aborigines. London 1845.
Carus, Ueber ungleiche Befähigung der verschiedenen Menschheits-Stämme. Leipzig 1849.
v. Chamisso, Bemerkungen und Ansichten auf einer Entdeckungsreise (1815-18). Weimar 1821.
Cheyne, a description of islands in the Western Pacif. Ocean etc. London 1852.
Cook, 3te Entdeckungsreise in die Südsee und nach dem Nordpol. 2. Bd. Berl. 1789.--id. b, 1ste Entdeckungsreise bei Schiller.
Darwin, Naturwissenschaftliche Reise, übersetzt von Dieffenbach, Braunschw. 1844.
Dieffenbach, Travels in N. Zealand. London 1843.
Dillon, Narrative of a voyage in the South Sea. London 1839.
Dumont d'Urville, a, Voyage de l'Astrolabe. Paris 1830. id. b, Voy. au Pole Sud. Paris 1841.
Ellis, Polynesian Researches. London 1831.
Erskine, Journal of a cruise among the Islands of the Western Pacific. London 1853.
Finsch, N. Guinea und seine Bewohner. Bremen 1865.
Freycinet, Voyage autour du monde (1817-20). Paris 1827.
P. Mathias G***, Lettres sur les îles Marquises. Pasis 1843.
Gill, Gems from the Coral Islands. London 1855.
le Gobien, Histoire des Isles Marianes. Paris 1701.
Grey, Journals of two expedit. in NW and W. Australia (1837-39). London 1841.
Gulick, Micronesia, Nautical Magazin 1862.
Hale, Ethnographie and Philol. (Unit. States exploring expedition). Philadelphia 1846.
Hearne, Reise von der Hudsonsbay bis zum Eismeere (1769-1772). Magaz. v. Reisebeschreibungen. 14. Bd. Berlin 1797.
v. Hochstetter, Neuseeland. Stuttgart 1863.
Howitt, Impressions of Australia felix. London 1845. id. a, Abenteuer in Australien. Berlin 1856.
A. v. Humboldt,
a) Versuch über den politischen Zustand des Königreichs Neuspanien. Tübingen 1809.
b) Reise in die Aequinoktialgegenden des neuen Continentes, deutsch v. Hauff. Stuttgart 1861.
c) Ansichten der Natur. 3. Aufl. Stuttgart u. Augsburg 1859.
Jarves, History of the Haw. or Sandw. Islands. London 1843.
v. Kittlitz, Denkwürdigkeiten auf einer Reise nach d. russ. Amerika, Mikronesien u. Kamtschatka (1826 etc.). Gotha 1858.
v. Kotzebue, Entdeckungsreise in die Südsee und nach der Behringsstrasse (1815-18). Weimar 1821.
Krusenstern, Reise um die Welt (1803-6). Berlin 1811.
v. Langsdorff, Bemerkungen auf seiner Reise um die Welt (1803-7). Frankfurt 1812.
La Pérouse, Entdeckungsreise 1785. Magazin von Reisebeschr. Band 16. 17. Berlin 1799 f.
v. Lessep, Reise durch Kamtschatka und Sibirien, Magaz. v. Reisebeschr. 4. Berlin 1791.
Lichtenstein, Reise in Südafrika (1803-6). Berlin 1812.
Lutteroth, Geschichte der Insel Tahiti, deutsch v. Bruns. Berlin 1843,
Mariner, Tonga Islands. London 1818.
Meinicke,
a) Das Festland v. Australien. Prenzlau 1837.
b) Die Südseevölker u. das Christenthum. Prenzlau 1844.
c) Australien in Wappäus Handbuch der Geographie und Statistik. 7. Aufl. 2. Bd. 2. Nachtr. Leipzig 1866.
Melville, Vier Monate auf den Marquesas-Inseln. Leipzig 1847. Id. b, the present state of Australia. London 1851.
Moerenhont, Voyage aux îles du grand Ocean. Paris 1837.
Nieuw Guinea, ethnogr. en natuurk. onderzocht in 1858 door een Nederl. Ind. Commiss. Amst. 1862.
Nixon, The cruise of the Beacon. London 1857.
Novara, Reise der österr. Fregatte (1857-59). Wien 1861.
Ohmstedt, Incidents of a whaling voyage. N. York 1841.
Petermann, Mitteilungen usw. a.d. Gesammtgebiet d. Geographie.
Pöppig, Artikel Indier bei Ersch u. Gruber. 2. S. B. 17. 1840.
Remy, Hist. de l'Arch. Hawaiien, texte et traduction. Paris et Leipzig 1862.
Salvado, Memorie storiche dell' Australia, part. della miss. benedettina. Roma 1851.
Schomburgk, Reisen in Britisch-Guiana 1840-44. Leipzig 1848.
Sparmann, Reise nach d. Vorgebirge der guten Hoffn. 1772-76. Berlin 1784.
Stewart, Journal of a residence in the Sandwich isl. (1823-25). London 1828.
Taylor, The Ika a Maui or N. Zealand and its inhabitants. London 1855.
Thomson, The story of N. Zealand. London 1859.
Thunberg, Reisen in Afrika und Asien 1772-79 im Mag. d. Reis. 7. Bd. Berlin 1792.
v. Tschudi, Reisen durch Südamerika. Leipzig 1866.
Turnbull, Reise um die Welt 1800-1804, Magaz. v. Reisebeschr. Bd. 27. Berlin 1806.
Turner, Nineteen years in Polynesia. London 1861.
Tyermann and Bennet, Journal of voy. in the S. Sea islands. London 1831.
Vankouver, Reisen nach d. nördl. Teile der Südsee (1790-95). Magaz. v. Reisebeschr. Bd. 18. 19. Berlin 1799 f.
Virgin, Erdumsegelung der Fregatte Eugenie (1831-33), übers. v. Etzel. Berlin 1856.
Waitz, Anthropologie der Naturvölker. Leipzig 1859 f. id. b, Die Indianer Nordamerikas. Leipzig 1865.
Williams, a Narrat. of Missionary enterprises in the South Sea Islands. London 1837.
Williams and Calvert, Fiji and the Fijians ed. by Rowe. Lond. 1858.
Wilson, Missionsreise ins südl. stille Meer 1796-98, Magaz. von Reisebeschr. Bd. 21. Berlin 1800.
Zeitschrift für allgemeine Erdkunde, neue Folge.
Inhalt.
Vorwort. Quellen
§ 1. Einleitung. Umfang des Aussterbens
§ 2. Empfänglichkeit der Naturvölker für Miasmen. Krankheiten, welche spontan bei der Zusammenkunft der Natur- und Kulturvölker entstehen
§ 3. Direkt eingeschleppte Krankheiten
§ 4. Behandlung der Kranken bei den Naturvölkern
§ 5. Geringe Sorgfalt der Naturvölker für ihr leibliches Wohl
§ 6. Charakter der Naturvölker
§ 7. Ausschweifungen der Naturvölker
§ 8. Unfruchtbarkeit. Künstlicher Abortus. Kindermord
§ 9. Krieg und Kannibalismus
§ 10. Menschenopfer
§ 11. Verfassung und Recht
§ 12. Natureinflüsse
§ 13. Aeussere Einflüsse der höheren Kultur auf die Naturvölker
§ 14. Psychische Einwirkungen der Kultur
§ 15. Schwierigkeit für die Naturvölker, die moderne Kultur sich anzueignen
§ 16. Behandlung der Naturvölker durch die Weißen. Afrika. Amerika
§ 17. Fortsetzung. Der stille Ozean
§ 18. Geographische Verteilung der einzelnen Gründe für das Aussterben der Naturvölker. Vergleichung dieser Gründe in Bezug auf ihr Gewicht
§ 19. Vergleichung der Natur- und Kulturvölker in Bezug auf ihre Lebenskraft
§ 20. Aussterbende und ausdauernde Naturvölker
§ 21. Die afrikanischen Neger
§ 22. Folgerungen aus der Art, wie die Naturvölker von den Kultur behandelt sind
§ 23. Zukunft der Naturvölker; Mittel sie zu heben
§ 24. Werth der Naturvölker für die Menschheit und ihre Entwickelung. Schluss
§1. Einleitung. Umfang des Aussterbens.
Die Erscheinung, dass eine Reihe von Völkern vor unseren Augen durch langsameres oder rascheres Hinschwinden ihrem Untergang entgegengeht, ist eine überaus wichtige. Dass sie für die Geschichtsforschung große Bedeutung hat, leuchtet ohne weiteres ein; dass sie für die Naturgeschichte des Menschen, die Anthropologie entscheidend ist, ebenfalls. Und wenn es sich als wahr bestätigt, dass, wie man behauptet hat, diese Völker aus einer Lebensunfähigkeit, welche ihrer Natur anhaftet, dem Aufhören entgegengehen; so ist, da die notwendige Folgerung jener Behauptung dahin führt, dass man verschiedene Arten, höhere und niedere im Geschlecht Mensch annimmt, die Beantwortung dieser Frage auch für die Philosophie maßgebend. Praktisch hat man sie von jeher in den Staaten betont, wo Weiße mit Farbigen zusammenleben; wie man eben die Theorie der geringeren Lebensfähigkeit nicht weißer Rassen zuerst in diesen Staaten aufgestellt hat.
Und allerdings ist es auffallend, dass nur farbige Rassen dies Hinschwinden zeigen und am meisten es da zeigen, wo sie mit der weissen in Berührung gekommen sind; dass die Weißen, obwohl sie doch ihre Heimat, das gewohnte Klima usw. aufgegeben haben und in unmittelbarer Berührung mit denen leben, welche in ihrem Vaterlande, scheinbar unter den alten Lebensbedingungen, verkommen, gänzlich davon verschont zu sein scheinen.
Während wir nun dies Hinschwinden hauptsächlich bei den kulturlosen Rassen, bei den Naturvölkern, d.h. bei den Völkern finden, welche dem Naturzustande des Menschengeschlechtes noch verhältnismäßig nahe stehen (Waitz 1, 346), oder bei welchen, um mit Steinthal zu reden, noch keine bedeutende Entwickelung der logischen Fähigkeiten stattgefunden hat: so sehen wir es doch ebenfalls auch da, wo farbige Rassen sich zur Kultur und sogar zu einer gewissen Höhe der Kultur emporgeschwungen haben, in Polynesien, in Mexiko, in Peru, und man hat daher geschlossen, einmal dass diese Kultur doch nur Halbkultur und wenig bedeutend gewesen sei, denn wäre sie wahr und ganz gewesen, so würde sie größere Kraft verliehen haben: oder aber, dass bestimmte Rassen, auch wenn sie sich wirklich über das Niveau der gewöhnlichen „Wilden“ erhoben hätten, dennoch einem frühen Tode entgegengingen, weil sie nun eben von der Natur zum Aussterben bestimmt seien, weil es ihnen eben, in Folge ihrer Rasseneigentümlichkeit, an Lebensfähigkeit fehle, welche keine Kultur ersetzen könne: Vielmehr decke jede Art von Kultur diesen Mangel nur um so mitleidsloser auf. Allerdings gibt es auch farbige Rassen und Naturvölker, bei welchen an ein Aussterben nicht zu denken ist; und andererseits sind auch Teile von Kulturvölkern, indogermanische, semitische Stämme verschwunden und ausgestorben. Allein bei letzteren redet man nicht von einer geringeren Lebensfähigkeit, einmal wegen der Verwandtschaft dieser Stämme mit den anerkannt lebensfähigsten Völkern der Welt; andererseits auch wegen der Art ihres Verschwindens. Denn der Grund, warum sie aufgehört haben zu existieren, liegt klar auf der Hand; teils sind sie durch Krieg vernichtet, wie so viele Völker, welche mit dem alten Rom kämpften, teils sind sie mit anderen Kulturvölkern, die sie rings umgaben, verschmolzen, wie die Goten, die Vandalen, teils trat beides zugleich ein: die höhere Kulturstufe, welche sie besiegte, nahm die besiegten Reste in sich auf, wie die alten Preußen, die Wenden und so viele slavische Völkerschaften durch und in Deutschland, die Iberer, die Kelten durch und in das römische Wesen verschwanden. So war auch zweifelsohne das Loos der Völker, welche vor der Einwanderung der Indogermanen Europa inne hatten. Anders aber ist das Hinschwinden der Naturvölker: wo sie mit höherer Kultur zusammenkommen, auch da, wo diese letztere sich friedlich gegen sie verhält, sehen wir sie von Krankheiten ergriffen werden, ihr physisches und psychisches Vermögen versiechen, und ihre Zahl, oft außerordentlich rasch, sich vermindern. Allerdings sind auch einzelne Naturvölker aufgerieben oder doch stark vermindert durch ganz äußerliche und leicht begreifliche Gründe: so namentlich viele malaiische Stämme, welche durch nachrückende verwandte Völker ins Gebirge zurückgedrängt und dabei gewiss ebenso so stark vermindert worden sind, als durch ihr gleiches Schicksal die Basken in Europa, während sie in ihren Bergen sich in ziemlich gleichbleibender Anzahl halten; so die Bewohner der Warekauri-(Chatam-) Inseln bei Neu-Seeland, die Moreore. welche 1832-35 noch 1500 etwa betrugen, durch die Neu-Seeländer aber, die in jenen Jahren einen Zug nach den Warekauriinseln unternahmen, fast ganz ausgerottet sind, so dass ihre Zahl jetzt nur noch 200 beträgt: und auch diese nehmen, durch Assimilation an die eingewanderten Maoris rasch ab (Travers bei Peterm. 1866, 62). Auch müssen wir hier die schwarze Urbevölkerung Vorderindiens, die dekhanischen und Vindhyavölker erwähnen, weil auch
sie nach Lassen (ind. Altertumskunde 1, 390) allmählich abnehmen. Früher waren sie weiter ausgebreitet und einzelne Reste von ihnen scheinen sich (Lassen a.a.O. 387 ff.) in Himalaya, in Belutschistan, Tibet und sonst erhalten zu haben. Sie wurden durch die nachrückenden arischen Inder und gewiss nicht friedlich in die Gebirge zurückgedrängt (Lassen 366), wo sie nun teils im barbarischen Zustande weiter lebten, teils aber, und so namentlich die südlicheren Dekhanvölker, in die indische Kultur übergingen (Lassen 364. 371). Ein ähnliches Schicksal hatten verschiedene amerikanische Stämme, die von anderen mächtigeren Indianervölkern teils aufgerieben, teils sich einverleibt wurden; auch wird von einzelnen Hottentottenvölkern eine ähnliche Vermischung mit Kafferstämmen erwähnt (Waitz 2, 318).
Doch scheinen auch manche Völker vermindert oder gar verschwunden, ohne es in Wirklichkeit zu sein. Ein solcher Schein ist hervorgerufen, wie Waitz 1, 159-160 zeigt, teils durch Umänderung von Namen, wo man nun fälschlich annahm, weil der Name nicht mehr existiere, so sei auch das Volk erloschen, oder durch Irrtümer der Reisenden, indem sie manche Namen zu weit ausdehnen, andere aber auf völligem Missverständnis beruhen, oder durch falsche Schätzung der Volkszahl, wie man sie oft sehr übertrieben, namentlich bei älteren Reisenden, z.B. für Polynesien bei Cook, findet u. dergl.
Ehe wir nun aber die Gründe für jenes weniger leicht zu erklärende Hinschwinden der Naturvölker aufsuchen, müssen wir den Umfang desselben betrachten, wobei wir außer Europa alle Weltteile zu berücksichtigen haben.
In Asien sterben aus oder sind schon ausgestorben die Kamtschadalen und so rasch ging ihre Verminderung vor sich, das Langsdorff (1803-4, Krusensterns Begleiter) Ortschaften, welche die Cooksche Expedition und La Perouse noch wohl bevölkert sahen, völlig menschenleer fand. Wenn La Perouse 1787 auf der Halbinsel im ganzen noch 4000 Bewohner fand (2,166), so sind die russischen Einwanderer in dieser Zahl, bei der trotzdem auf mehrere Quadratmeilen kaum ein Mensch kommt, schon einbegriffen. Denn Cooks Reisebegleiter (1780) fanden, nach den Mitteilungen eines dort ansässigen Offiziers in Kamtschatka nur noch 3000 Einwohner, wobei die Kurilen schon mitgerechnet sind; sie erzählen selbst, wie sich die Eingeborenen immer mehr mit den einwandernden Russen verbinden und ihre Zahl dadurch immer mehr abnimmt (Cook 3. R. 4, 175). La Perouses Reisegefährte Lessep (41) behauptet, dass nur noch ein Viertel der eigentlichen Kamtschadalen übrig sei; und er war noch nicht ein volles Jahrhundert nach der ersten Unternehmung der Russen (1696) gegen Kamtschatka dort. Dasselbe Schicksal haben außer den Jakuten und Jukagiren in Sibirien Waitz, (1, 164) auch die Aleuten auf den Fuchsinseln und die ihnen verwandten Stämme auf den nächsten Küsten von Amerika, die wir hier gleich erwähnen, weil auch sie wie die Kamtschadalen unter demselben Drucke Russlands stehen. Langsdorff fand auf den Fuchsinseln nur gegen 300 Männer, während er für 1796 1300 und für 1783-87 gar 3000 und mehr angibt. Das Steigen der Zahlen, welches wir im Anfang dieses Jahrhunderts finden, ist keineswegs tröstlich. Denn wenn Chamisso (177, zweite Note) nach aktenmäßigen Mitteilungen für 1806 die Aleuten der Fuchsinseln auf 1334 Männer und 570 Frauen, 1817 dagegen auf 462 Männer und 584 Frauen angibt, so versieht er erstlich diese allerdings auffallenden Zahlen selbst mit einem Fragezeichen; und zweitens, wenn sie auch richtig sind, Langsdorff sich geirrt und die Volkszahl sich nicht durch russische Einwanderer vermehrt hat: Das Sinken der Bevölkerung von 1806-1817 ist gewiss eben so arg als wie wir es bei Langsdorff geschildert finden. Der offizielle Bericht von 1860 bei Peterm. 1863, 70 gibt 4645 Bewohner der Fuchsinseln an: allein hier sind jedenfalls die Russen, welche jetzt auf den Inseln ansässig sind, mitgezählt, obwohl die Mischlinge, 1896 Seelen, noch besonders angegeben werden und diese Vermehrung, welche sich auf Kamtschatka gleichmäßig findet, ist nur eine scheinbare.
Bekannt ist das Aussterben der Ureinwohner Amerikas, deren Zahl man in Nordamerika für die Zeit der Entdeckung etwa auf 16 Millionen, jetzt kaum noch 2 Millionen schätzt (Waitz b, 16). 1864 betrug die Zahl der Indianer in den Vereinigten Staaten etwa 275,000; 1860 zählte man noch 294,431; 1841 aber, auf kleinerem Gebiete 342,058 Seelen, so dass sich also hier in 23 Jahren ein Verlust von nahezu 70,000 Menschen herausstellt (eb. 18). Noch geringere Zahlen gibt Behm (105 ff.) an, nämlich 268,000 unabhängige Indianer für die Vereinigten Staaten, 155,000 für britisch Nordamerika. Und während d'Orbigny (1838) für den von ihm bereisten größeren Teil von Südamerika 1,685,127 Indianer zählte (Waitz b, 16). So stellt Behm auch hier geringere Zahlen auf: Brasilien hat nach ihm (a.a.O.) 500,000 unabhängige Indianer, die drei Guyanas 9770, Venezuela 52,400, Neu-Granada 126,000, Ekuador 200,000, Peru 400,000, Bolivia 245,000, Chile 10,000, die Staaten der argentinischen Republik 40,000, Patagonien und Feuerland 30,000, also zusammen 1,613,170 und zwar für ganz Südamerika. So viel aber betrug allein die Bevölkerung von Chile zur Zeit der Entdeckung (Pöppig 385 Anmerkung) nach einer der kleinsten Annahmen. Mittelamerika hatte um 1800 zwei und eine halbe Million unvermischter Ureinwohner und diese Zahl war im Wachsen (Humboldt a 1, 107); aber zur Zeit der Entdeckung betrug die Volkszahl in Tenuchtitlan, der alten Hauptstadt von Mexiko und dem ihm nahe gelegenen Tezkuko allein nach mittleren Angaben fast eine Million und das Land war dicht bedeckt mit großen und volkreichen Städten. Behm nimmt als jetzige unabhängige Urbevölkerung nur 6000 an (a.a.O.), eine Zahl, welche gegen Humboldts Angaben außerordentlich gering ist: allein Behm schätzt hier nur die Indianer ab, „welche sich den Behörden vollständig entziehen“, während Humboldt auch die Eingeborenen mitbegreift, welche sich am europäischen Leben so gut wie die spanischen Mexikaner beteiligen. Behm (114) schätzt diese auf 4,800,000. Natürlich geht dies Aussterben auch jetzt noch weiter, wofür v. Tschudi 2, 216 ein Beispiel gibt: die Malalies, ein araukanischer Stamm, 1787 noch über 500 Individuen stark, schmolzen in jener Zeit durch Kriege auf 26 Seelen zusammen. Obwohl sie nun 70 Jahre lang ansässig sind und ungefährdet gelebt haben, ist ihre Zahl doch nicht höher als auf einige über dreißig gestiegen.
In Afrika sind es die Hottentotten zunächst, welche in den Kreis unserer Betrachtung hineingehören. Während sie früher sich weit hin in das Innere von Südafrika ausdehnten und in eine zahlreiche Menge von einzelnen Stämmen zerfielen, finden wir sie jetzt auf sehr viel kleinerem Gebiete und aufgerieben bis auf 3 Stämme, die Korana, Namaqua und Griqua (Waitz 2, 317 ff.), deren Zahl fortwährend im Fallen ist. Auch die Kaffern müssen hier erwähnt werden, denn im brittisch Kafraria hat sich 1857 die Bevölkerung um mehr als die Hälfte vermindert: sie betrug am Anfang des Jahres 104,721 Seelen und am Ende desselben nur noch 52,186 (Peterm. 1859 S. 79 nach dem Population Return v. John Maclean Chief Commissioner): nach Behm jedoch (100) 1861 74,648 Eingeborene.
Es bleibt uns nun noch Australien und Ozeanien zu betrachten übrig, wo an vielen Orten die Bevölkerung rasch hinschwindet, so namentlich in Neuholland. Doch ist es gerade für dies Land schwer, ja ganz unmöglich, Zahlen aufzustellen, weil die Stämme fortwährend hin- und herziehen und daher alle Zahlangaben sehr wenig zuverlässig sind (Grey 2, 246). Die, welche Meinicke a 177 aufstellt, beweisen dies zur Genüge, und selbst die bei Behm (72) sind nicht sicherer. Nur von Südaustralien, Queensland und Viktoria hat er bestimmte Zählungsergebnisse und so ist seine Gesamtziffer 55.000 nur eine sehr ungefähre. Alle Quellen aber berichten einstimmig, dass die Bevölkerung wenigstens der Küsten reißend abnimmt; dass Stämme, welche früher nach Hunderten zählten, jetzt vielfach bis auf ebenso viel Zehner zusammengeschmolzen sind. Die Bevölkerung Tasmaniens betrug 1843 noch 54 Individuen, 1854 noch 16 (Nixon 18) und ist jetzt wohl ganz ausgestorben.
Wenn auch nicht so reißend, so vermindern sich doch auch die Melanesier an verschiedenen Gegenden ihres Gebietes: so nach Reina (Zeitschr. 4., 360), die Völker der kleinen Inseln in der Nähe von Neuguinea: so nach D'Urville 5, 213 die Bewohner von Vanikoro, nach Turner 494 die Eingeborenen der neuen Hebriden, wie z.B. die Bevölkerung von Anneitum 1860, welche Turner auf 3513 Seelen schätzt, 1100 Menschen durch eine Masernepidemie verlor (Muray bei Behm 77) und die von Erromango 1842 durch eine gefährliche Dysenterie um ein Drittel vermindert wurde (Turner a.a.O.); und so finden sich noch verschiedene Angaben zerstreut.
In Mikronesien ist die Bevölkerung der Marianen, welche bei Ankunft der Spanier 1668 mindestens 78,000 Einwohner gehabt haben, für die aber auch 100,000 durchaus nicht zu hoch gegriffen ist (Gulick 170) gänzlich ausgestorben. Schon um 1720 hatten die Inseln (und zwar nur noch die beiden südlichsten) nicht mehr als etwa 2000 Einwohner, und von diesen waren sehr viele von den Philippinen her verpflanzte Tagalen. Ponapi (Puynipet, Ostende der Karolinen) hatte nach Hale (82) 15.000 Bewohner, welche Annahme vielleicht etwas, aber nicht viel zu hoch ist[A]; jetzt hat sie (Gulick 358) noch 5000, Kusaie (Ualan) hatte 1852 12-1300, 1862 nur noch 700 Menschen (Gulick 245).
In Polynesien betrug auf Tahiti die Bevölkerung zu Cooks Zeiten (1770) etwa 15-16,000 Seelen (G. Forster nach einer spanischen Beschreibung von Tahiti a.d. Jahre 1778 ges. Werke 4,211, Bratring 104, welcher derselben Quelle folgt oder wenigstens einer nahe verwandten). Dieselbe Zahl fand Wilson noch im Jahre 1797; Turnbull (259) gibt nur 5000 an im Jahre 1803, Waldegrave bei Meinicke b, 113 6000 für 1830 und Ellis 1, 102 für 1820 etwa 10,000, welche Zahl Virgin auch für 1852 angibt (2, 41). Mögen auch diese Zahlen unbestimmt und schwankend und Turnbulls Angaben negativ übertrieben sein: so viel ist sehr klar, dass seit der Entdeckung durch die Europäer die Entvölkerung dieser Insel, welche indes nach den Aussagen der Eingebornen (Virgin 2, 41) schon früher begonnen hatte, rasch fortgeschritten ist; bis unter die Hälfte der früheren Kopfzahl sinken die Angaben. Auf den übrigen Societätsinseln war das Verhältnis (Meinicke a. a. O.) ein ähnliches. Auch jetzt scheint das Aussterben, obwohl langsamer, fortzugehen: der offizielle französische Bericht für 1862 gibt für Tahiti 9086 Bewohner an (Behm 81).
Auf Laivavai, einer der Australinseln, betrug die Bevölkerung 1822 mindestens 1200, 1830 nur noch etwa 120 und 1834 kaum noch 100 Seelen (Mörenhout 1, 143). Günstiger ist Meinickes Schätzung, welcher auf der ganzen Gruppe Ende 1830 etwa 5000 Seelen, für 1840 nur noch 2000 annimmt (a.a.O. 114). Rapa schätzte Vankouver 1795 auf 1500 Einwohner, Mörenhout (1, 139) 1834 nur noch auf 300 und diese waren in stetem Abnehmen. Auch die Herveygruppe, welcher Ellis 1, 102 10-11,000 Bewohner gibt, ist jetzt viel minder zahlreich bewohnt, namentlich Rarotonga, welches durch eine furchtbare Seuche im höchsten Grade gelitten hat (Williams 281).
Ganz ebenso schlimm ist es in Hawaii, wo nach Ohmstedt 262, die Bevölkerung in den Jahren 1832-36 von 130,000 auf 102,000 Seelen, also in 4 Jahren um 28,000 Seelen gesunken ist! Mag Ohmstedt nun auch Recht haben, dass die Bevölkerungsziffer für 1836 zu gering ist, weil eine Menge Geburten nicht angezeigt worden sind: so ist das Hinschwinden trotzdem ganz außerordentlich, zumal die Insel zu Cooks Zeiten, der 400,000 Einwohner angibt, wohl an 300,000 nach Jarves Berechnung (373) hatte. Die Zahlen bei Meinicke (b, 115-16 nach der Sandwich Isl. gazette) sind zwar nicht genau dieselben, das Verhältnis der Abnahme aber bleibt, auch wenn wir ihnen folgen, unverändert. Nach Virgin 1, 267 hatte die Hawaiigruppe 1823 etwa 142,000 Seelen, 1832 noch 130,313, 1836 108,579 und 1850 betrug die Zahl nur noch 84,165! also in 78 Jahren hat sich die Bevölkerung um ein Drittel gemindert und die Zahl der Geburten verhielt sich zu den Todesfällen wie 1:3! Auch jetzt noch schreitet die Verminderung fort: Die Zahl der Eingeborenen betrug nach dem Zensus von 1860 nur 67,084 Seelen (Behm 85).
Auch auf dem Markesasarchipel, dessen Bevölkerung nach Meinicke (b, 115) 22,000 Menschen beträgt, ist ein Hinschwinden bemerkt: So verlor Nukuhiva (Rodriguet in Revue de 2 mondes 1859 2, 638) von 1806-12 zwei Drittel seiner Bevölkerung durch Hungersnoth. Auf Neu-Seeland beträgt die Abnahme der Bevölkerung in den letzten 14 Jahren etwa 19-20 Percent; 1770 betrug sie etwa 100,000 und 1859 noch 56,000 (Hochstetter 474, nach Fenton). Nach offiziellen Berichten im Athenäum (Zeitschr. 9, 325), welche zu Hochstetters Angaben nicht ganz stimmen, war die Zahl der Eingebornen 1858 87,766, und zwar, auffallend genug, 31,667 Männer und 56,099 Frauen. Dagegen treffen die offiziellen Berichte von 1861 (Meinicke c 557) mit Hochstetter überein: denn sie geben 55,336 Eingeborene an. Letzteres ist wohl das richtigere. Nach Fenton (Reise der Novara 3, 178) verhielten sich bis gegen 1830 die Sterbefälle und Geburten zur Gesamtbevölkerung wie 1: 33,04 und 1: 67,12.
Auf Samoa nimmt nach Erskine 104 die Bevölkerung, 37,000 Seelen, gleichfalls ab, und zwar soll die Abnahme nach den Berichten der Missionäre in 10 Jahren auf einer Insel von 4000 bis zu 3700 oder 3600 vorgeschritten sein (eb. 60).
Auch die Pageh auf Engano, ein den Polynesiern ähnlicher malaiischer Stamm auf einer kleinen Insel südlich von Sumatra sterben aus nach Wallands Urteil, der auf der Insel eine äußerst geringe Kinderzahl vorfand--nur fünf im Ganzen (Zeitschr. 16, 420).
§ 2. Empfänglichkeit der Naturvölker für Miasmen. Krankheiten, welche spontan bei der Zusammenkunft der Natur- und Kulturvölker entstehen.
Indem wir uns nun anschicken, die Gründe für dies Hinschwinden aufzusuchen, wollen wir zuerst vernehmen, wie man sich über die Lebensunfähigkeit dieser Stämme geäußert hat. Pöppig (386) sagt von Amerika: „Es ist eine unbezweifelte Tatsache, dass der kupferfarbene Mensch die Verbreitung europäischer Zivilisation nicht in seiner Nähe verträgt, sondern in ihrer Atmosphäre ohne durch Trunk, epidemische Krankheiten oder Kriege ergriffen zu werden, dennoch wie von einem giftigen Hauche berührt ausstirbt. Die zahlreichen Versuche der Regierungen haben Sitte und Bürgertum unter jener Rasse nie einheimisch machen können, denn ihr fehlt die nötige Perfektibilität. Dieser Mangel macht die durchdachten und menschenfreundlichen Pläne der Erziehung zunichte und rechtfertigt den Vergleich jener Menschheit mit jener eine eigentümliche Physiognomie tragenden, aber niederen Vegetation, die das dem Meere entstiegene Land zuerst in Besitz nimmt, aber in dem Maße wie höher ausgebildete und kräftigere Pflanzen sich entwickeln, sich vermindert und zuletzt auf immer verschwindet. Wie sehr das menschliche Gefühl sich gegen eine solche Annahme sträubt, so glauben wir doch in den Amerikanern einen von der Natur selbst dem Untergang geweihten Zweig unseres Geschlechtes zu sehen. In den leer gewordenen Raum tritt eine geistig vorzüglichere , beweglichere, aus dem Osten stammende große Familie. Wie diese ihrer Bestimmung zur allgemeinsten Verbreitung gehorsam sich ausdehnt und die entlegensten Wildnisse sich unterwirft, so legt die Urbevölkerung sich zum Todesschlafe nieder und verschwindet selbst aus dem Gedächtnisse des neuen Volkes. In weniger als einem Jahrhundert wird vielleicht die Forschung über die ersten Bewohner eines ganzen Weltteils dem Gebiete der Archäologie überwiesen werden müssen, und dann erst wird das Tragische und Rätselhafte ihres Schicksals begriffen (?) und tief empfunden werden.“
So schrieb 1840 ein deutscher Gelehrter, der lange Reisen in Amerika gemacht hatte. Auch Carus Phantastereien von Tag-, Nacht- und Dämmerungsvölkern (17 ff.) gehören hierher; seine westlichen Dämmerungsvölker, „sie, die wirklich dem Untergange zugewendet sind und ihrem Verlöschen mehr und mehr entgegengehen“, sind die Amerikaner; seine Nachtvölker, welche sich „über Afrika ausdehnen und hinab gegen Süden über Australien (!), Van Diemensland und einen Teil von Neuseeland (als Papus!!) erstrecken“, stehen noch tiefer in ihrer geistigen Entwickelung und Fähigkeit. Ganz ähnlicher Ansicht über die Neuholländer, wie Pöppig über die Amerikaner, scheint Meinicke zu sein, nur dass er sich verhüllter ausdrückt; doch nennt er sie einen „dem Untergang geweihten “ Volksstamm (c 522) und spricht hier n. a 2, 215 von ihrer „gänzlichen Unbildsamkeit“. Viel direkter hat man von der Unbildsamkeit, von dem nohwendigen Untergang, von der geringen Lebensfähigkeit der tieferstehenden und mangelhaft organisierten Rassen in Amerika (Waitz 3, 45) und den Kolonien in Afrika, Neuholland und Polynesien gesprochen; da man denn sich auch weiter kein Gewissen machte, den Untergang, welchem diese Rassen nun doch einmal geweiht seien, damit auf ihren Trümmern sich das bessere Leben höherstehender Rassen entwickeln könne, mit allen Mitteln beschleunigen zu helfen.
Aber auch vorurteilsfreie Forscher sehen in diesem Hinschwinden etwas Rätselhaftes, so Waitz 1, 173, wenigstens in Beziehung auf Australien und Polynesien, da hier eine Hauptursache der Entvölkerung, welche in Amerika so wirksam war, der Druck durch die Weißen, in Polynesien ganz wegfalle, in Australien wenigstens nicht weitgreifend gewirkt habe. „Begreiflicher Weise, fährt er jedoch fort, ist das Aussterben eines Volkes, das früher kräftig und gesund gewesen ist, nicht damit erklärt, dass man ihm die Lebenskraft abspricht oder einen ursprünglichen Mangel der Organisation zuschreibt, und es hat an sich schon etwas sehr Unbefriedigendes für eine so seltene und abnorme Erscheinung einen geheimnisvollen Zusammenhang anzunehmen, dem sie ihre Entstehung verdanke; man wird vielmehr hier wie überall nach dem natürlichen Zusammenhange der Sache zu suchen haben, wenn man sich auch schließlich zu dem Geständnisse genötigt finden sollte, dass es bis jetzt nicht gelingen will, denselben vollständig aufzuklären.“
Wir wollen sehen, ob wir zu diesem Geständnis genötigt werden.
Auch Darwin (2, 213) sieht bei diesem Aussterben, für welches er viele natürliche Gründe anführt, auch „noch irgendeine mehr rätselhafte Wirksamkeit“ tätig. „Die Menschenrassen, sagt er, scheinen auf dieselbe Art aufeinander zu wirken, wie verschiedene Tierarten, von denen die stärkere die schwächere vertilgt.“ Er macht darauf aufmerksam, dass fast bei jeder Berührung der Naturvölker und der Weißen, oft auch von Stämmen ein- und desselben Volkes, welche in verschiedener Gegend wohnen, seuchenartige Krankheiten entstehen, oft bei völliger Gesundheit der Schiffsmannschaft und der von ihr besuchten Völkerschaft, „von denen alsdann vorzugsweise die niedere von beiden Rassen oder die der Eingeborenen, welche in ihrem Lande von Fremden aufgesucht werden, zu leiden hat“ (Waitz 1, 162). Und hierzu lassen sich die Beispiele allerdings häufen. So sagt Humboldt (a 4, 392), dass in Panama und Calao der Anfang großer Epidemien des gelben Fiebers „am häufigsten durch die Ankunft einiger Schiffe aus Chile bezeichnet werde“, obwohl doch Chile selbst eines der gesündesten Länder der Welt sei und das gelbe Fieber gar nicht kenne; aber die schädlichen Folgen der außerordentlich erhitzten und durch ein Gemisch von faulen Dünsten verdorbenen Luft, an welche die Organe der Eingeborenen gewöhnt seien, wirkten mächtig auf Individuen aus einer kälteren Region. Ähnlich verhält es sich mit dem Ausbrechen des gelben Fiebers in Mittel- und Nordamerika, das eingeschleppt zu haben so häufig die eine der genannten Gegenden Besuchern aus der anderen vorwirft (Humboldt a.a.O. 384). Die „grausame Epidemie“ von 1794, wo Verakruz ungewöhnlich heftig vom gelben Fieber heimgesucht war, fing an mit der Ankunft dreier Kriegsschiffe (eb. 423). Ebenso schreiben die Einwohner Egyptens das Ausbrechen der Pest der Ankunft griechischer Schiffe zu und umgekehrt die Bewohner Griechenlands und Konstantinopels egyptischen (eb. 384), wobei keineswegs immer an eine Einschleppung zu denken ist. Auf Rapa (Australinseln) traten tödliche Krankheiten nach dem Besuch von englischen Schiffen auf, welche die Hälfte der Eingeborenen dahinrafften (Mörenh. 1, 139); auf Tubuai (Australinseln) ward die Bevölkerung durch Krankheiten, welche mit der Mission 1822 auftraten, auf die Zahl von 150 heruntergebracht (eb. 2, 343). Raivavai, welches 1822 noch 1200 Einwohner hatte, besaß 1830 etwa noch 120 durch gleiches Schicksal (eb. 1, 143). Williams (283-84) spricht es als seine eigene Erfahrung aus, dass die meisten der Seuchen, die er in der Südsee erlebte, durch Schiffe, deren Mannschaft ganz gesund sei und nur auf ganz erlaubtem, gewöhnlichem Wege mit den Eingeborenen verkehrte, veranlasst wurden. Das erste Zusammentreffen zwischen Europäern und Eingeborenen, sagt er, ist fast immer mit dem Fieber, mit Dysenterie u. dergl. bezeichnet; so starb auf Rapa die Hälfte der Eingeborenen aus; so entstand die furchtbare Seuche auf Rarotonga (Herveyinseln), die er 282 schildert. Ganz dasselbe sagt Virgin 1, 268; „Auch nur kurze Besuche von Fahrzeugen haben auf den Inselgruppen der Südsee Krankheiten von mehr oder minder verderblicher Natur verursacht, die sich sogar erst längere Zeit nachher gezeigt haben. Es hat sich dies auch sogar zugetragen, ungeachtet die Besatzung der Schiffe vollkommen gesund war und die Krankheiten sind nicht stets solche gewesen, welche möglicherweise durch eigentliche Ansteckung mitgeteilt werden konnten oder welche in Europa zu denen gehören, deren Beschaffenheit in der Regel mehr oder weniger tödlich ist.“ Von Tahiti erzählt Bratring 145, dass 1775 bei der Anwesenheit der Spanier unter Boenechea ein ansteckendes Katarrhalfieber ausbrach. Nach Cooks Besuch litt die Insel unter Dysenterie (Mörenh. 2, 425) und die Tahitier selbst schrieben schon um 1800 alle Krankheiten den Berührungen mit fremden Schiffen zu (Turnbull 266). Beechey 1, 94-95 berichtet Ähnliches von den Inseln Pitkairn. Bei regnichtem Wetter und bei gelegentlichen Besuchen von Schiffen, sagt er, leiden die Eingeborenen (eine Mischbevölkerung von Tahitiern und Engländern) stärker an Blutandrang (plethora) und Schwären als sonst; sie glauben ganz fest, dass diese Krankheiten durch den Verkehr mit ihren Gästen, mögen diese selbst auch ganz gesund sein, herrühren. Das eine Schiff sollte ihnen Kopfschmerzen, ein anderes Scharbock, das dritte Geschwüre usw. gebracht haben, wie sie denn auch von Beecheys Schiff, dessen Mannschaft ganz gesund war, ähnliches erwarteten: ja sie fühlten schon Kopfweh und Schwindel. Beechey erklärt diese Zufälle durch die Veränderung ihrer Lebensweise während solcher Besuche, da sie gegen ihre sonstige Gewohnheit dann viel Fleisch essen und reichlichere Kleidung tragen. Von Melanesien (Tanna) erzählt Turner 91 nach den Aussagen der Eingeborenen, welche alle Krankheiten, wie Fieber, Dysenterie, Husten u. dergl. „fremde Dinge“ nennen, ganz Gleiches. Auch in Celebes (Waitz 1, 163) herrschte diese Meinung und ebenso auch bei den alten Marianern, welche nach jedem fremden (europäischen) Schiff von einer Seuche heimgesucht zu werden behaupteten; so brachte 1688 ein Schiff von Mexiko, welches mit Verbrechern beladen an der Insel scheiterte, Rheuma, Fieber, Blutungen (le Gobien 376), und die Eingeborenen sahen alle Krankheiten als durch die Spanier eingeschleppt an (ebd. 140). Die Einwohner von St. Kilda (westl. v. d. Hebriden bei Schottl.) sind der festen Ansicht, für die sie eine lange Erfahrung haben, dass der Besuch eines Fremden ihnen Schnupfen bringe (Macculloch bei Darwin 2, 214).
Nach dem medizinischen Teil der Novara Reise (1, 225) glauben die Eingeborenen der Nikobaren, dass die Kokosnüsse von den Bäumen fielen, sobald ein Missionär die Insel beträte. So mag denn auch diese weitverbreitete Ansicht der Grund sein, weshalb in Ponapi, sobald ein Schiff in Sicht kommt, das Volk flieht und der Priester aufs Feierlichste die Götter um Hülfe anruft (Gulick 175), wenn wir es hier nicht mit etwas Religiösem zu tun haben. Jedenfalls ist wohl zu beachten, dass die Naturvölker vor der Bekanntschaft mit den Europäern fast nichts von Krankheit wussten; weder die Marianer (le Gobien 140) noch die übrigen Mikronesier (Chamisso) noch die Polynesier, von denen freilich die Neu-Seeländer, obwohl der Gesundheitszustand auch ihrer Insel im Allgemeinen trefflich war, von schweren Seuchen, die sie schon vor Cook heimgesucht hätten, erzählten (Dieffenbach 2, 12-14), noch die Neu-Holländer, Hottentotten und Amerikaner (Waitz 1, 140-41).
Für die Indianerstämme steigert sich die Wirkung solcher Epidemien noch durch Folgendes, was v. Tschudi, einer der ausgezeichnetsten Kenner der amerikanischen Völker, 2, 216 sagt: „Es ist eine höchst eigentümliche Erscheinung, dass Indianerstämme, die durch Krieg oder Epidemien plötzlich sehr stark reduziert wurden, sich in der Regel nie wieder erholen und nur noch, als wenig zahlreiche Familien gewöhnlich Jahrzehnte lang hinsiechen, bis sie endlich ganz aussterben. Bei ihnen tritt nicht mehr die Vermehrungsprogression ein, wie sie vor dem vernichtenden Schlage stattgefunden hatte, und bei anderen unter den nämlichen physischen Bedingungen lebenden Völkern beobachtet wird. Meines Wissens ist dieses Verhältnis noch nirgends erörtert worden. Ich habe es bei einem genauen Studium der Geschichte der nord- und südamerikanischen Indianer als Regel gefunden. Sehr verminderte Fruchtbarkeit des Weibes ist die Hauptursache: auf welchen physiologischen Einwirkungen sie aber beruht, ist wohl schwer zu ermitteln.“ Waitz freilich (1, 163) bringt Beispiele vom Gegenteil: die Creeks (nach Simpson), die Winibegs (nach Schoolcraft), die Apachen (Kendall) usw. haben sich nach schweren Epidemien wieder erholt. Wir kommen hierauf zurück.
Man hat nun diese auffallende Erscheinung, dass Krankheiten durch Berührung gesunder, aber aus verschiedener Gegend oder Rasse stammender Menschen entstehen, zu erklären versucht. Darwin, der in Shropshire gehört, dass gesunde Schafe, die aber auf Schiffen eingeführt wurden, in einem Pferch zu anderen gebracht, diese krank machen, Darwin meint, dass das Effluvium von Menschen--und wohl auch, nach dem letzten Beispiel, von Tieren--die lange Zeit eingeschlossen gewesen seien, giftig auf andere wirke, namentlich dann, wenn sie von verschiedenen Rassen wären (2, 214); eine Ansicht, welche indes weder von medizinischer Seite noch durch die Erfahrung bestätigt wird.