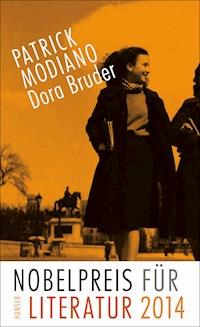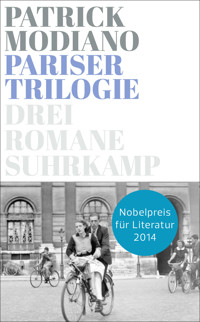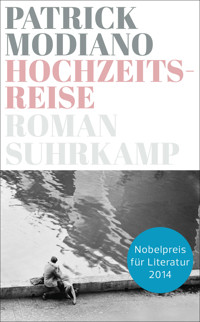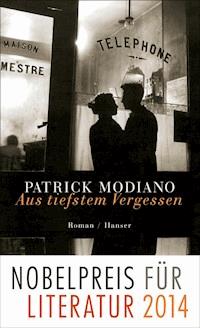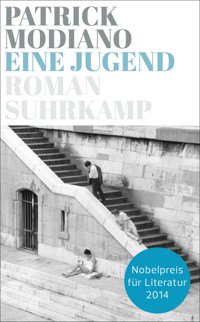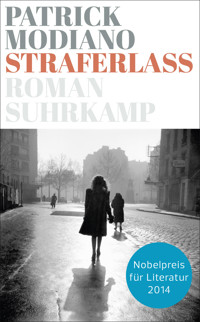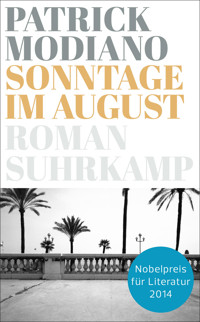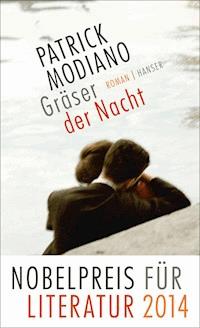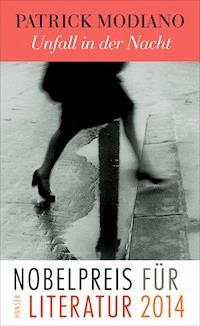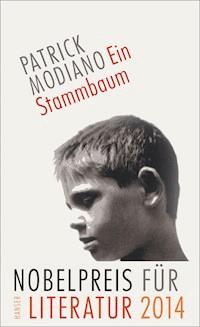Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Vater trifft sich mit dubiosen Russen auf dem Schwarzmarkt, die Mutter ist Schauspielerin in Pigalle. Der Sohn, in Paris auf sich allein gestellt, verkehrt mit rätselhaften Frauen: Mit Madeleine Péraud, einer Esoterikspezialistin, teilt er die Liebe zu bestimmten Büchern. Sie bietet ihm an, bei ihr einzuziehen. Madame Hubersen entführt ihn abends nach Versailles. Mit einer dritten Frau, die in einer fremden Wohnung einen Mann erschossen hat, wird er fliehen und ihr helfen, die Spuren zu verwischen. Fünfzig Jahre später versucht der Erzähler, seine Jugenderinnerungen wie Teile eines Puzzles zusammenzufügen. Nobelpreisträger Modiano vermischt dabei auf unnachahmliche Weise Traum und Wirklichkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 96
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Der Vater trifft sich mit dubiosen Russen auf dem Schwarzmarkt, die Mutter ist Schauspielerin in Pigalle. Der Sohn, in Paris auf sich allein gestellt, verkehrt mit rätselhaften Frauen: Mit Madeleine Péraud, einer Esoterikspezialistin, teilt er die Liebe zu bestimmten Büchern. Sie bietet ihm an, bei ihr einzuziehen. Madame Hubersen entführt ihn abends nach Versailles. Mit einer dritten Frau, die in einer fremden Wohnung einen Mann erschossen hat, wird er fliehen und ihr helfen, die Spuren zu verwischen. Fünfzig Jahre später versucht der Erzähler, seine Jugenderinnerungen wie Teile eines Puzzles zusammenzufügen. Nobelpreisträger Modiano vermischt dabei auf unnachahmliche Weise Traum und Wirklichkeit.
Patrick Modiano
Schlafende Erinnerungen
Aus dem Französischen von Elisabeth Edl
Carl Hanser Verlag
Eines Tages auf den Quais hat ein Buchtitel mein Interesse geweckt, Die Zeit der Begegnungen. Auch für mich gab es eine Zeit der Begegnungen, in einer fernen Vergangenheit. Damals hatte ich oft Angst vor der Leere. Dieses Schwindelgefühl spürte ich nicht, wenn ich allein war, sondern bloß mit gewissen Personen, denen ich gerade begegnet war. Um mich zu beruhigen, sagte ich mir: Es wird schon eine Gelegenheit kommen, dann mache ich mich aus dem Staub. Bei einigen dieser Personen wusste man nicht, bis wohin sie einen vielleicht mitzogen. Der Hang war rutschig.
Ich könnte zuerst einmal von den Sonntagabenden sprechen. Sie machten mich beklommen, wie alle, die den Rückweg ins Internat gekannt haben, im Winter, am späten Nachmittag, wenn der Tag sich neigt. Das verfolgt sie dann in ihren Träumen, manchmal ein Leben lang. Am Sonntagabend trafen sich stets einige Leute in der Wohnung von Martine Hayward, und ich befand mich unter diesen Menschen. Ich war zwanzig, und ich fühlte mich nicht ganz am richtigen Platz. Ein Schuldgefühl überkam mich wieder, als sei ich immer noch Schüler: anstatt zurückzufahren ins Internat, war ich weggelaufen.
Soll ich wirklich sofort von Martine Hayward sprechen und von den paar bunt zusammengewürfelten Typen, die sich an jenen Abenden um sie versammelten? Oder lieber chronologisch vorgehen? Ich weiß es nicht mehr.
Mit etwa vierzehn hatte ich mir angewöhnt, allein durch die Straßen zu schlendern, an freien Tagen, wenn der Schulbus uns an der Porte d’Orléans abgesetzt hatte. Meine Eltern waren nicht da, mein Vater mit seinen Geschäften befasst, während meine Mutter in einem Stück an einem Theater in Pigalle spielte. In jenem Jahr — 1959 — habe ich das Pigalle-Viertel entdeckt, am Samstagabend, wenn meine Mutter auf der Bühne stand, und in den zehn darauffolgenden Jahren bin ich oft dorthin zurückgekehrt. Ich werde darüber noch andere Einzelheiten erzählen, wenn ich den Mut aufbringe.
Anfangs hatte ich Angst, allein herumzuschlendern, doch um mich zu beruhigen, folgte ich immer demselben Weg: Rue Fontaine, Place Blanche, Place Pigalle, Rue Frochot und Rue Victor-Massé bis zur Bäckerei an der Ecke Rue Pigalle, ein komischer Ort, der die ganze Nacht offen hatte und wo ich mir ein Croissant kaufte.
Im selben Jahr und im selben Winter lag ich an Samstagen, wenn ich nicht ins Collège musste, in der Rue Spontini auf der Lauer, vor dem Haus, wo diejenige wohnte, deren Vornamen ich vergessen habe und die ich »Stioppas Tochter« nennen will. Ich kannte sie nicht, ich hatte ihre Adresse durch Stioppa selbst erfahren, auf einem jener Spaziergänge, zu denen mich mein Vater und Stioppa sonntags mitschleiften, im Bois de Boulogne. Stioppa war Russe, ein Freund meines Vaters, den dieser oft sah. Hochgewachsen, das Haar dunkel und glänzend. Er trug einen alten Mantel mit Pelzkragen. Er hatte einige Schicksalsschläge einstecken müssen. Wir begleiteten ihn abends gegen sechs zurück zu der Familienpension, wo er wohnte. Er hatte mir gesagt, seine Tochter sei im selben Alter wie ich und ich könnte mit ihr in Verbindung treten. Offenbar sah er sie nicht mehr, denn sie lebte bei ihrer Mutter und deren neuem Mann.
An den Samstagnachmittagen jenes Winters stellte ich mich, bevor ich meine Mutter in ihrer Theatergarderobe in Pigalle traf, vor das Haus in der Rue Spontini und wartete, dass das verglaste Eingangstor mit den schwarzen Schmiedearbeiten aufgehen möge und ein Mädchen in meinem Alter auftauchte, »Stioppas Tochter«. Ich war sicher, sie würde allein sein, sie würde auf mich zukommen und es wäre ganz einfach, sie anzusprechen. Doch sie ist nie aus dem Haus getreten.
Stioppa hatte mir ihre Telefonnummer gegeben. Jemand hat abgehoben. Ich sagte: »Ich möchte mit Stioppas Tochter sprechen.« Stille. Ich habe mich als »Sohn eines Freundes von Stioppa« vorgestellt. Ihre Stimme war hell und freundlich, als würden wir uns schon lange kennen. »Ruf mich nächste Woche wieder an«, sagte sie. »Dann können wir uns verabreden. Es ist kompliziert … Ich wohne nicht bei meinem Vater … Ich werde dir alles erklären …« Aber in der nächsten Woche und auch in den anderen Wochen jenes Winters folgte ein Klingelzeichen auf das andere, ohne dass jemand sich meldete. Zwei- oder dreimal noch legte ich mich am Samstag, bevor ich die Metro nach Pigalle nahm, vor dem Haus in der Rue Spontini auf die Lauer. Vergeblich. Ich hätte an der Wohnungstür klingeln können, aber wie beim Telefon war ich mir gewiss, niemand würde sich melden. Und dann hat es ab dem Frühling mit Stioppa keine Spaziergänge im Bois de Boulogne mehr gegeben. Auch keine mit meinem Vater.
Ich war lange überzeugt, richtige Begegnungen mache man nur auf der Straße. Darum erwartete ich Stioppas Tochter auf dem Trottoir, gegenüber von ihrem Haus, ohne sie zu kennen. »Ich werde dir alles erklären«, hatte sie am Telefon gesagt. Noch ein paar Tage lang sagte eine immer fernere Stimme diesen Satz in meinen Träumen. Ja, wenn ich ihr hatte begegnen wollen, dann weil ich hoffte, dass sie mir »Erklärungen« gab. Vielleicht konnten die mir helfen, meinen Vater besser zu verstehen, einen Unbekannten, der auf den Wegen des Bois de Boulogne stumm neben mir herging. Sie, Stioppas Tochter, und ich, der Sohn von Stioppas Freund, hatten bestimmt Gemeinsamkeiten. Und ich war sicher, dass sie etwas genauer Bescheid wusste als ich.
Um die selbe Zeit redete mein Vater am Telefon hinter der halboffenen Tür seines Arbeitszimmers. Einige Worte hatten mich stutzig gemacht: »die Russen-Bande vom Schwarzmarkt«. Fast vierzig Jahre später bin ich auf eine Liste mit russischen Namen gestoßen, von wichtigen Schwarzmarkthändlern in Paris während der deutschen Besatzung. Schaposchnikoff, Kourilo, Stamoglou, Baron Wolf, Metchersky, Djaparidzé … Gehörte Stioppa dazu? Und mein Vater unter einer falschen russischen Identität? Ich habe mir diese Fragen ein letztes Mal gestellt, bevor sie sich ohne Antwort verlieren in grauer Vorzeit.
Als ich um die siebzehn war, bin ich einer Frau begegnet, Mireille Ourousov, die ebenfalls einen russischen Namen trug, den ihres Mannes, Eddie Ourousov, genannt »der Konsul«, mit dem lebte sie in Spanien, unweit von Torremolinos. Sie war Französin und stammte aus den Landes. Die Dünen, die Kiefern, die einsamen Strände am Atlantik, ein sonniger Septembertag … Und doch hatte ich sie in Paris kennengelernt, im Winter 1962. Ich hatte mein Collège in der Haute-Savoie mit neununddreißig Fieber verlassen, einen Zug nach Paris genommen und landete gegen Mitternacht in der Wohnung meiner Mutter. Sie war nicht da und hatte den Schlüssel Mireille Ourousov anvertraut, die für ein paar Wochen hier wohnte, bevor sie zurückfuhr nach Spanien. Als ich geläutet hatte, war sie es, die öffnete. Die Wohnung wirkte verwahrlost. Kein einziges Möbel mehr, außer einem Bridge-Tisch und zwei Gartenstühlen im Eingang, einem großen Bett mitten im Zimmer, das auf den Quai ging, und im angrenzenden Zimmer, wo ich in der Zeit meiner Kindheit schlief, ein Tisch, Stoffreste und eine Schneiderpuppe, Kleider und verschiedene, auf Bügeln hängende Bekleidungsstücke. Der Lüster verströmte ein gedämpftes Licht, denn die meisten Glühbirnen waren durchgebrannt.
Ein seltsamer Februar mit diesem gedämpften Licht in der Wohnung und den Attentaten der OAS. Mireille Ourousov war gerade vom Wintersport zurückgekommen und zeigte mir Fotos von sich und ihren Freunden auf dem Balkon eines Chalets. Auf einem der Fotos stand sie neben einem Schauspieler namens Gérard Blin. Sie sagte mir, er habe seit seinem zwölften Lebensjahr in Kinofilmen mitgespielt, ohne die Erlaubnis seiner Eltern, denn er war als Kind sich selbst überlassen. Später, als ich ihn in einigen Filmen sah, schien mir, er habe nie aufgehört, mit den Händen in den Taschen und leicht eingezogenem Kopf herumzulaufen, als schütze er sich so vor Regen. Ich verbrachte in diesen Tagen die meiste Zeit mit Mireille Ourousov. Wir nahmen unsere Mahlzeiten nur selten in der Wohnung. Das Gas war abgestellt, und Essen bereitete man gezwungenermaßen auf einem Spirituskocher. Keine Heizung. Aber es lagen noch ein paar Holzscheite im Kamin des Schlafzimmers. An einem Vormittag sind wir ins Odéon-Viertel marschiert, um eine zwei Monate alte Stromrechnung zu bezahlen, denn wir wollten an den nächsten Tagen nicht mit Kerzenbeleuchtung auskommen müssen. Fast jeden Abend gingen wir aus. Gegen Mitternacht nahm sie mich mit in ein Kabarett der Rue des Saints-Pères, ganz in der Nähe der Wohnung, wenn die Vorstellung längst zu Ende war. Ein paar Gäste standen im Erdgeschoss noch an der Bar, sie schienen sich alle zu kennen und redeten leise. Wir trafen dort einen Freund von ihr, einen gewissen Jacques de Bavière (oder Debavière), ein sportlich wirkender Blonder, von dem sie mir gesagt hatte, er sei »Journalist« und »pendle zwischen Paris und Algier«. Ich vermute, wenn sie nachts manchmal fort war, dann besuchte sie diesen Jacques de Bavière (oder Debavière), der in einer Garçonnière der Avenue Paul-Doumer wohnte. Ich habe sie einmal am Nachmittag dorthin begleitet, weil sie in dieser Garçonnière ihre Armbanduhr vergessen hatte. Jacques de Bavière war nicht da. Zwei- oder dreimal hatte er uns in ein Restaurant bei den Champs-Élysées, in der Rue Washington, eingeladen, La Rose des sables. Viel später habe ich erfahren, dass im Kabarett der Rue des Saint-Pères und in La Rose des sables damals Mitglieder einer in den Algerienkrieg verwickelten Geheimpolizei verkehrten. Und wegen dieses Zufalls habe ich mich gefragt, ob Jacques de Bavière (oder Debavière) nicht dieser Organisation angehörte. In einem anderen Winter, in den siebziger Jahren, habe ich eines Abends gegen sechs aus dem Metroeingang George-V, gerade als ich hinunterwollte, einen Mann hochkommen sehen, in dem ich, ein wenig gealtert, Jacques de Bavière zu erkennen meinte. Ich habe kehrtgemacht und bin hinter ihm hergelaufen, denn ich sagte mir, ich müsste ihn ansprechen und fragen, was aus Mireille Ourousov geworden war. Lebte sie noch immer in Torremolinos mit ihrem Mann, Eddie, dem »Konsul«? Er ging in Richtung Rond-Point des Champs-Élysées, und er hinkte leicht. Vor der Terrasse des Café Marignan bin ich stehengeblieben und habe ihn mit dem Blick verfolgt, bis er in der Menge verschwand. Warum habe ich ihn nicht angesprochen? Und hätte er mich wiedererkannt? Auf diese Fragen weiß ich keine Antwort. Paris ist für mich übersät mit Gespenstern, so zahlreich wie die Metrostationen, all die Punkte auf dem Netzplan, die aufleuchteten, wenn man die Knöpfe für eine Verbindung drückte.