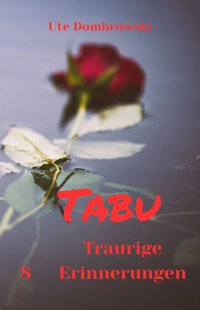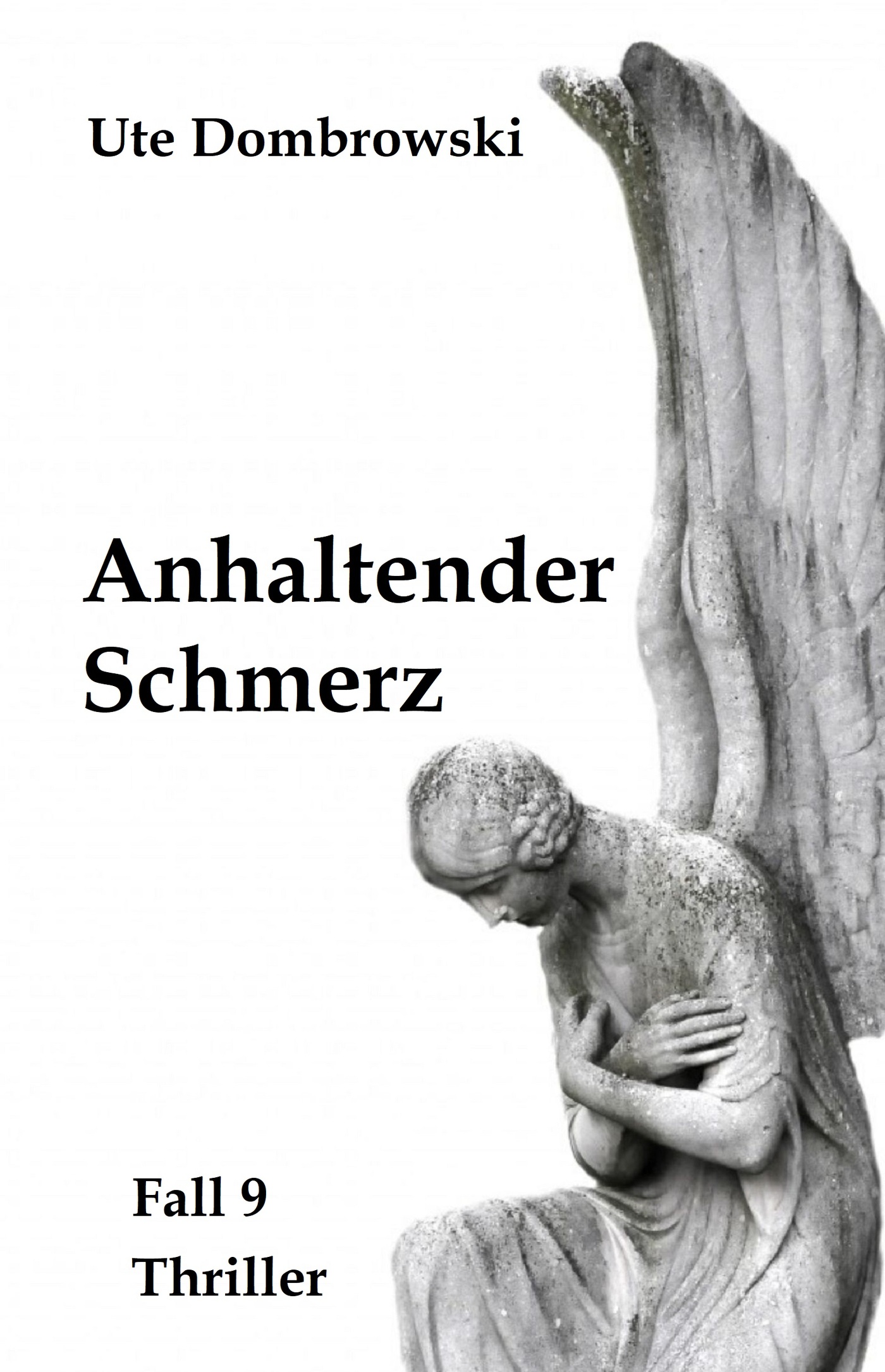Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Eltville-Thriller
- Sprache: Deutsch
Bianca wird im achten Fall auf eine harte Probe gestellt, nicht nur im Job, sondern auch privat. Eine alte Frau ist tot und ihr Sohn glaubt, dass sie keines natürlichen Todes gestorben ist. Nur Bianca nimmt seine Sorgen ernst und muss sich deswegen mit der neuen Staatsanwältin auseinandersetzen, die ihr auch sonst das Leben schwer macht. Dann verschwindet ein Teenager, doch niemand will hören, dass ihm etwas zugestoßen ist, im Gegenteil: Die Staatsanwaltschaft und selbst seine Mutter vermuten, dass er aus Ärger über seine zerstrittenen Eltern weggelaufen ist. Wird Bianca mit ihrem berühmten Bauchgefühl Recht behalten? Geht es hier um mehr, als die Polizei ahnen kann?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ute Dombrowski
Verlogenes Versprechen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Impressum neobooks
1
Verlogenes Versprechen
Ute Dombrowski
1. Auflage 2019
Copyright © 2019 Ute Dombrowski
Umschlag: Ute Dombrowski
Lektorat/Korrektorat: Julia Dillenberger-Ochs
Satz: Ute Dombrowski
Verlag: Ute Dombrowski Niedertiefenbach
Druck: epubli
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors und Selbstverlegers unzulässig.
Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
„Der Tod, das Schicksal aller, kommt, wann er kommen soll.“
William Shakespeare
Aus: „Julius Cäsar“
2. Aufzug, 2. Szene, Cäsar
„Es tut mir leid. Die Ärzte haben alles getan, was möglich war, es ist schrecklich, dass auch die neue Chemotherapie nicht wirksam war.“
„Du hast doch gesagt, dass es diesmal gut wird!“
Tränen liefen über Janoschs Wangen und er zitterte. War es jetzt soweit? Musste er sterben?
„Was denkst du … wie lange noch?“
„Das kann ich dir nicht sagen. Eine Woche oder ein Monat oder ein Jahr …“
„Wird es wehtun? Habe ich dann noch meine sieben Sinne beisammen?“
„Janosch, als dein Freund würde ich dir so gerne Hoffnung machen, aber als Arzt muss ich realistisch sein. Da selbst nach der Knochenmarktransplantation der Krebs zurückgekehrt ist, sehe ich keine Möglichkeit mehr.“
„Macht noch eine Chemo! Oder bestrahlt mich erneut! Was ist mit einer Immuntherapie?“
„Du bist so geschwächt, dein Immunsystem ist sozusagen nicht mehr vorhanden. Geh heim und tu das, was du immer schon mal machen wolltest. Erfülle dir Wünsche. Lebe und wenn es soweit ist, werde ich für dich da sein und dir die Schmerzen vom Leib halten.“
„Konrad, sei bitte ehrlich. Gibt es im Ausland eine Möglichkeit für mich? Oder etwas Experimentelles? Ich gebe all mein Geld …“
„Ich bin immer ehrlich zu dir gewesen, Janosch, wir kennen uns doch so lange … glaube mir, ich würde alles, ALLES versuchen, um dich am Leben zu halten. Besuche deine Mutter, Schwester, Freunde. Genieße die Zeit, die dir bleibt. Du hast das Glück, finanziell unabhängig zu sein, reise noch ein bisschen, nicht zu weit weg, nicht zu lange, fahre ans Meer oder in die Berge.“
„Danke …“, murmelte Janosch.
Er sah Konrad Knibbel, der ihn heute zum Onkologen begleitet hatte, noch einmal an und seufzte.
„Das ist Scheiße.“
„Ich weiß. Alles Gute. Komm nächste Woche zum üblichen Termin zu mir.“
Als Janosch vor der Tür stand, rieb er sich die Augen. Er dachte: Jetzt bin ich siebenunddreißig, muss nicht arbeiten, habe weder Familie noch Kinder, auch die meisten Freunde haben sich von mir abgewendet und dazu habe ich einen Krebs in mir, der mich töten wird.
Austherapiert, das war das Wort, vor dem er sich seit Jahren fürchtete. Austherapiert, das war sein Todesurteil. Womit hatte er das verdient?
„Nein, ich gebe nicht auf! Es muss doch noch etwas geben, was mir hilft. Morgen, morgen beginne ich nochmal zu recherchieren.“
Ganz in Gedanken lief Janosch durch die überfüllte Stadt zum Bahnhof, nachdem er sich von seinem Freund verabschiedet hatte. Konrad hatte noch einen Termin und konnte Janosch nicht heimbringen. Der kranke Mann sah nicht die Menschen, die ihn verstört aus dem Weg gingen, denn die Tränen der Verzweiflung bahnten sich nach wie vor ihren Weg. Janosch spürte sie nicht, denn er konnte nur eines denken: Ich will nicht sterben!
Im Zug starrte er aus dem Fenster und als er in Eltville ausstieg, waren die Tränen versiegt. Er irrte durch die Altstadt heim und schloss die Haustür zweimal ab.
Janoschs Haus befand sich am Ende der Straße zu den Weinbergen, eine Hecke verbarg es vor neugierigen Blicken. Die Rollläden waren heruntergelassen, um die Welt aus seinem Leben auszusperren.
Janosch ließ sich auf die Couch fallen und schaltete den Fernseher an, aber er sah nicht, was lief. Er dachte an den Tag vor fünf Jahren, an dem sein Freund Konrad nach einem Routinecheck die furchtbare Diagnose stellte: Knochenmarkkrebs. Weitere Untersuchungen zeigten, dass es eine besonders aggressive Form war, die schon in die Leber gestreut hatte. Janosch war sich sofort bewusst gewesen, dass nur das volle Programm mit Operation, Knochenmarktransplantation, Chemotherapie und Bestrahlung helfen würde und weil er leben wollte, begab er sich euphorisch in die Hände der Spezialisten. Konrad, sein alter Schulfreund, war immer an seiner Seite gewesen.
Die Operation brachte den gewünschten Erfolg, ein Knochenmarkspender war relativ rasch gefunden worden und die Chemotherapie zerstörte die Krebszellen. In dieser Zeit ging es Janosch schlecht, aber er kämpfte und überlebte. Ein Jahr später war er frei von Krebs.
Janosch ging regelmäßig zur Nachsorge und war zuversichtlich, mit der Energie, die er aufgebracht hatte, als Sieger aus dem Kampf zu gehen. Ein weiteres Jahr später wurden alle Hoffnungen zerschlagen. Der Krebs war mit ganzer Macht zurückgekehrt. Sein Kampf begann von vorn, aber jeder Gedanke an eine Heilung wurde zunichte gemacht, denn der Krebs hatte weiter gestreut. Neue Operationen waren nötig und mit jedem Schnitt ins Fleisch verlor Janosch an Kraft. Und nicht nur das. Die Haare, die langsam nachgewachsen waren, fielen erneut aus, der Appetit war verschwunden und wenn Janosch sich im Spiegel betrachtete, sah er einen abgemagerten, totkranken Mann, einem Geist ähnlicher als einem Menschen.
Bis zu seiner Erkrankung war er ein normaler junger Mann gewesen. Sein Vater hatte ihm nach dessen Tod durch einen Unfall das Haus und ein dickes Bankkonto hinterlassen, sodass er ganz seiner Leidenschaft nachgehen konnte: dem Zeichnen. Er war nicht sehr erfolgreich, aber da er finanziell unabhängig war, genügte es ihm, ab und zu mal ein Bild zu verkaufen. Ansonsten lebte er in den Tag hinein, traf sich mit Freunden, schlief ab und an mit einer Frau und freute sich des Lebens.
Dieses Leben war lange vorbei. Einzig Konrad verstand, was mit ihm los war. Viele Freunde hatten Angst vor dem Krebs und zogen sich zurück, andere wussten nicht, wie sie ihr herzzerreißendes Mitleid in Worte fassen sollten und der eine oder andere ärgerte sich, dass er Janosch nun nicht mehr ausnutzen konnte. Sie hatten ihn nach und nach im Stich gelassen.
„Ihr miesen Typen, wenn es hart auf hart kommt, dann zeigt sich, wer die wahren Freunde sind.“
Seine Familie, die aus der dementen Mutter und einer kinderreichen Halbschwester bestand, hielt sich ebenfalls zurück.
Friderike sagte immer: „Ich will dich nicht mit den Kindern belasten, du brauchst ja Ruhe. Besuch doch die Mutti, dann habt ihr beide etwas davon. Melde dich, wenn ich etwas für dich einkaufen soll.“
Janosch hatte sich nicht gemeldet, auch seine Mutter besuchte er nur selten. Die Frau schaute ihn an wie einen Fremden, also was sollte er da? Sie war in einem guten Pflegeheim und die Pfleger verstanden sehr gut, dass der schwerkranke Sohn sich nicht um seine Mutter kümmern konnte.
Am Abend war er noch einmal aus dem Haus gegangen, um am Rhein dem Wasser nachzuschauen, das wie sein Leben an ihm vorbeifloss. Erschöpft ließ er sich auf eine Bank fallen, denn eine große Müdigkeit war über ihn gekommen. Er hatte sich kaum noch auf den Beinen halten können und hörte auch die Frau, die ihn jetzt ansprach, wie durch eine Nebelwand.
„Hallo, geht es Ihnen nicht gut? Kann ich Ihnen helfen?“
Er reagierte nicht, erst, als ihm jemand auf die Schulter tippte. Sein Kopf fuhr herum und er blickte in freundliche, sanfte Augen. Eine Frau in Sportkleidung beugte sich über ihn.
„Es geht schon, ich muss nur einen Moment ausruhen.“
„Sind Sie sicher? Soll ich Sie nach Hause bringen?“
„Nein, nein, mir geht es gleich wieder gut.“
„Ich setze mich kurz zu Ihnen, ja?“
Janosch nickte. Er schloss die Augen und fühlte sich neben der fremden Frau plötzlich sehr wohl. Ihre warme Stimme hatte sein Herz berührt. Er versuchte gleichmäßig zu atmen und beruhigte sich langsam. Jetzt schaute er zur Seite, wo die Frau immer noch den wachen Blick auf ihn gerichtet hatte.
„Ist das nicht lächerlich? Ich schaffe es nicht mal ohne Pause spazieren zu gehen.“
„Sie sehen nicht so aus, als wenn Sie darüber lachen könnten.“
Janosch nickte.
„Sie müssen hier nicht warten. Gehen Sie ruhig.“
„Nein, auf keinen Fall. Ich gehe erst, wenn es Ihnen wieder gut geht.“
Janosch begann zynisch zu lachen, aber Tränen rannen dabei über seine Wangen. Er lachte, bis ein Hustenanfall ihn ausbremste.
„Gut geht … gut geht … gut geht … ein toller Witz.“
Er presste die Hände vor sein Gesicht.
„Es wird mir nie wieder gut gehen, also könnte es sein, dass Sie hier bis in alle Ewigkeit sitzen. Oder nein, wenn Sie Glück haben, bin ich morgen tot.“
„Das hört sich nicht positiv an. Wollen Sie mir erzählen, was passiert ist?“
Janosch schaute der Frau in die Augen. Sie strahlte immer noch eine unbeschreibliche Ruhe aus.
„Ich bin Janosch.“
„Ich bin Bianca.“
Er lächelte.
„Ich habe Krebs und es geht dem Ende zu, sagt mein Freund und Arzt, Dr. Konrad Knibbel. Mit ihm war ich heute beim Onkologen.“
„Das tut mir leid. Ich kann mir vorstellen … nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Was für eine Art Krebs ist es?“
„Knochenmark, Metastasen in Leber, Darm und Lunge.“
„Ich wurde mal angeschossen, aber das kann man, denke ich, nicht vergleichen. Gibt es Behandlungsmöglichkeiten?“
„Austherapiert. Wer hat Sie denn angeschossen?“
„Ein Verbrecher, ich bin Polizistin.“
„Ah, das ist sicher ein aufregender Job. Wissen Sie, jetzt verstehe ich auch, warum Sie so ruhig sind. Sie haben wohl öfter mit Menschen zu tun, die neben der Spur sind?“
Bianca nickte. Der Mann straffte sich und stand auf.
„Ich habe es nicht mehr weit. Danke, dass Sie auf mich aufgepasst haben. Vielleicht mache ich wirklich, was mein Arzt gesagt hat: mich amüsieren, so lange es noch geht.“
Bianca nickte erneut und wünschte dem Mann alles Gute. Sie schaute ihm hinterher, als er sich mit schlurfenden Schritten in Richtung Weinberge entfernte.
2
Bianca lief wie jeden Abend am Rhein entlang. Sie musste sich ablenken, denn Eric war noch nicht wieder zurück. Er wollte sein Leben ordnen und dazu gehörte seine Ehe mit der Frau, die mit einem lauten Knall in Biancas Leben eingedrungen war.
Mit klopfendem Herzen musste sie an den Moment denken, wo er ihr entgegengeschleudert hatte: „Ich bin verheiratet.“
Sie hatten sich gestritten und das hätte man wohl wieder in Ordnung bringen können, doch dieser eine Satz hatte Bianca den Boden unter den Füßen weggerissen. Später hatten sie sich ausgesprochen und Eric hatte versprochen, alles zu klären. Nach der Lösung des letzten Falles, der alle an ihre Grenzen geführt hatte, hatte er Urlaub genommen und war an die Nordsee gefahren.
Das war vor zwei Wochen gewesen. Sie telefonierten ab und zu und er machte einen gelösten Eindruck. Aber Bianca spürte, dass ihr Freund das nur vorspielte. Morgen endlich wollte er zurückkommen. Sie hatten beim Telefonieren kein Wort über die Frau gesprochen, die wie eine bedrohliche Gewitterwolke über Biancas Leben hing. Darum war sie jeden Abend gerannt, als ginge es um ihr Leben.
Als sie heute den Mann getroffen hatte, der auf einer Bank zusammengebrochen war, wollte sie eigentlich noch eine Weile am Rhein sitzen und ihren Gedanken nachhängen. Das Wetter war alles andere als winterlich, es war mild und oft schien die Sonne.
Im Nachhinein war sie über die Ablenkung froh gewesen. Schon auf dem Friedhof, wo sie wie immer stille Zwiesprache mit Michael gehalten hatte, hatte sich eine große Unruhe in ihr breitgemacht und sie war angespannt. Der Mann, der sich als Janosch vorgestellt hatte, hatte sie aus ihren Grübeleien geholt. Er tat ihr wahrhaftig leid, wie er sich so dahingeschleppt hatte und dann kraftlos auf die Bank gesunken war. Erst hatte sie gedacht, dass er betrunken war, aber seine ausgemergelte Gestalt mit dem glänzenden kahlen Schädel ließ erahnen, dass er nüchtern, aber schwer krank war.
Jetzt hatte sie geduscht und dachte über den Mann nach, der den Tod schon direkt vor sich sah. So nah, dass er bereits seinen Atem spüren konnte. Er musste verzweifelt sein, schwach, voller Schmerzen und hatte allen Grund dazu. Was waren dagegen schon ihre eigenen läppischen Probleme?
„Morgen“, murmelte sie zu ihrem Spiegelbild. „Eric wird kommen und mich in den Arm nehmen. Ich vertraue ihm.“
Der skeptische Blick, den sie im Spiegelbild entdeckte, sagte etwas anderes. Sie schüttelte die letzte Unsicherheit ab und ging ins Bett. Mit der Hand auf Erics Kopfkissen versuchte sie zu schlafen. Es war Freitag und sie konnte morgen ausschlafen. Die Verbrecher waren gnädig gewesen und hatten Eltville verschont, nur Kleinigkeiten waren vorgefallen und so genossen Bianca und Hannes eine ruhige Zeit.
Ferdinand war seit einer Woche wieder zuhause und musste sich weiter erholen. Die Zwangspause machte ihn unruhig, er wollte endlich wieder arbeiten, aber alle waren froh, dass der Schuss keine tödliche Wunde hinterlassen hatte. Wie gut, dass die Täterin nicht die Absicht gehabt hatte, ihn zu erschießen. Bianca hatte ihn aus dem Krankenhaus abgeholt und viel mit ihm über den Fall geredet, der nicht so ausgegangen war, wie sie wollten. Wenn Bianca Ferdinand im Krankenhaus besucht hatte, war sie auch immer zur Intensivstation gegangen, wo Mia, die Frau, die Ferdinand angeschossen hatte, um ihr Leben kämpfte.
Sie nahm ihr Handy und rief den Freund an.
„He, Ferdinand, Lust auf Pizza?“
„Kannst du nicht schlafen?“
„Nein, ich habe einfach keine Ruhe. Hast du Zeit?“
„Ach, Bianca, natürlich habe ich Zeit, für dich doch immer.“
„Gut, ich bringe eine Tiefkühlpizza mit, schmeiß schon mal den Herd an.“
Bianca schlüpfte aus dem Bett, zog sich ihre Jogginghose und den dicken Lieblingspulli an. Sie öffnete den Tiefkühlschrank, um die Pizza herauszunehmen. Mit einem Lächeln machte sie sich auf den Weg zu Ferdinand.
Der Kommissar saß zuhause im Sessel, sah fern und dachte an Bianca. Der Kuss kam ihm in den Sinn, aber es fühlte sich an, als wäre es ein anderer gewesen, der die Kollegin und Freundin geküsst hatte. Nein, das war ich nicht, dachte er und lauschte in sich hinein. Freundschaft, nicht mehr, war das, was er fühlte. Zufrieden nickte er.
Als es klingelte, öffnete er und Bianca lief an ihm vorbei in die Küche. Sie nahm die Pizza aus der Schachtel, löste die Folie ab und schob sie in den vorgeheizten Backofen.
„Salamipizza, wenn es in Ordnung ist.“
Ferdinand winkte ab und holte das große runde Brett aus dem Schrank. Sie setzten sich an den Küchentisch und schauten sich an.
„Schieß los!“
Bianca strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und lachte.
„Du kennst mich ziemlich gut, oder? Ich werde gerade verrückt vor Angst, obwohl Eric morgen zurückkommt. Die ganze Zeit war ich relativ ruhig, aber jetzt ist mir wirklich schlecht. Vorhin war ich bei Michael, doch der konnte mich nicht beruhigen. Ich habe ein ganz merkwürdiges Gefühl.“
„Habt ihr denn die ganzen zwei Wochen nicht miteinander telefoniert?“
„Doch, aber ich hatte nicht den Mut zu fragen und Eric hat auch nichts gesagt. Heißt das, er hat jetzt reinen Tisch gemacht? Oder heißt das, er hat sich wieder in sie verliebt? Hat er womöglich niemals aufgehört sie zu lieben?“
„Jetzt mach dich nicht verrückt! Er ist wegen euch dorthin gefahren, nicht wegen ihr. Du musst ihm vertrauen!“
„Ich weiß, aber das Warten ist verdammt schwer. Ich schäme mich, weil ich denke, ich bin nicht gut genug für ihn. Was, wenn er sich für sie entschieden hat? Sie haben eine Menge zusammen durchgemacht.“
„Ich kann verstehen, dass du Angst hast, aber ich denke, das ist unnötig.“
„Mein Bauchgefühl …“
„… kann auch mal falsch sein.“
Bianca seufzte, dann dachte sie an Janosch.
„Es ist so albern, dass ich mir um so einen Kram Gedanken mache.“
Dann erzählte sie von der Begegnung auf ihrer Joggingrunde.
„Weißt du, dagegen fand ich meine Sorgen und Nöte lächerlich. Stell dir vor, du musst sterben und das ganz sicher.“
„Ich stelle mir das furchtbar vor. Wenn ich solch ein Schicksal hätte, wüsste ich nicht, was ich mache.“
Bianca dachte an Alexander, der den alten Mann von seinem Leiden erlöst hatte, aber jetzt schossen ihr die Tränen in die Augen. Ferdinand ließ sie weinen, denn er ahnte, dass Bianca gerade vollkommen durcheinander war. Er kannte die Geschichte, die zwei Kollegen das Leben gekostet hatte. Wenn ich todkrank wäre, dachte er, dann würde ich selbst bestimmen wollen, wie es endet.
„Ich würde kämpfen, bis es nicht mehr geht“, sagte Bianca leise.
Dann war die Pizza fertig und sie aßen schweigend. Zwei Stunden später fuhr Bianca heim und eine bleierne Müdigkeit senkte sich über sie. Sie schloss die Augen und fiel in einen unruhigen Schlaf. Nach langer Zeit träumte sie wieder von Alexander und der Explosion, doch dieses Mal rettete sie Michael und Benedikt, indem sie Alexander erschoss, bevor er das Haus in die Luft sprengen konnte.
3
Janosch hatte sich zuhause wieder einmal an den Computer gesetzt, um nach Möglichkeiten für eine letzte Therapie zu suchen. Er las jeden Artikel, aber alles, was dort publiziert wurde, kam für ihn nicht infrage. In seiner langen Leidenszeit hatte er viel gelernt und sein Freund und Arzt Konrad Knibbel hatte alles gründlich mit ihm besprochen. Janosch war müde, aber da er sowieso keinen erholsamen Schlaf finden würde, recherchierte er unermüdlich weiter. Gegen Morgen war er enttäuscht und gelangweilt, sodass er sogar schon die Werbeanzeigen anklickte.
„So ein Mist, das braucht kein Mensch.“
Plötzlich strahlte ihn eine Frau an, die einen weißen Kittel trug. Der blaue Schimmer, der auf ihren Augenlidern lag, unterstrich die Farbe ihrer Augen. Ein gewinnendes Lächeln umspielte ihre Lippen. Zwei kleine Grübchen gaben ihr ein angenehmes Äußeres, das natürlich und gepflegt wirkte. Das blonde Haar fiel ihr locker über die Schultern. Die Frau gefiel Janosch und so wollte er wissen, wer sie war.
„Eine Ärztin wie es scheint. Moment … hier … ah, Prof. Dr. Ramona Zackig, privates Forschungsinstitut für Onkologie und Hämatologie. Sprechen Sie mit Ihrem Facharzt über eine Überweisung. Aha, diese nette Frau könnte meine Ärztin sein.“
Er las weiter, um herauszufinden, wo sich diese Praxis befand. Über die Finanzierung machte er sich keine Sorgen, denn wofür sonst sollte er sein Geld ausgeben, wenn nicht für den Kampf ums Überleben.
Janosch gab den Namen in die Suchmaschine ein und sein Herz machte einen Sprung: Die Praxis der Ärztin befand sich in Eltville, in einer der Villen am Rande der Stadt. Er atmete hastig aus und ein, weil er das Gefühl hatte, hier die Lösung aller Rätsel gefunden zu haben.
„Mensch!“, rief er laut in die nächtliche Stille. „Sie ist eine Professorin und das auch noch in der Onkologie. Ich muss wissen, was sie für mich tun kann.“
In ihren beiden fachlichen Publikationen, die er entdeckte, ging es hauptsächlich um Leukämie, Lymphdrüsenkrebs und Knochenmarkkrebs. Warum hatte er diese Ärztin nicht längst gefunden? Irgendwie hatte er seine Suche oft schon nach drei Seiten erschöpft abgebrochen. Heute hatte er weiter und weiter gescrollt und so war er auf die Werbeanzeige gestoßen. Weiter unten stand ein anderer Name. Dr. Max Hähmann war anscheinend ihr Partner in der Forschung. Unter seinem Namen tauchten jetzt mehrere Artikel auf, die sich ausschließlich mit der Behandlung von Knochenmarkkrebs beschäftigten. Er hatte bereits zwei Medikamente erschaffen, die einen ganz neuen Ansatz zur Therapie zeigten.
Atemlos las Janosch weiter und es war schon hell, als er wieder Hoffnung auf ein Leben geschöpft hatte. Es hörte sich alles sehr wissenschaftlich an und er wollte sich dieser Wissenschaft ergeben, solange sie ihn retten konnte. Er musste sich einen Termin holen, aber so lange er auch suchte, er fand keine Telefonnummer und auch keine E-Mail-Adresse. Ebenso umsonst suchte er nach einer genauen Adresse.
„Ganz exklusiv also. Na dann, morgen werde ich nach dieser Praxis suchen und der Frau so lange auf die Nerven gehen, bis sie bereit ist, mir zu helfen.“
Janosch spürte die erdrückende Müdigkeit, die in diesem Moment die Euphorie verdrängte. Er schleppte sich ins Bett und schlief augenblicklich ein.
Am späten Nachmittag wachte er auf und als ihm einfiel, was er in der Nacht recherchiert hatte, sprang er aus dem Bett. Er fühlte sich stark und voller Hoffnung. Frisch geduscht und mit einer Scheibe trockenem Toast im Magen rief er Konrad an.
„Janosch, ist etwas passiert? Brauchst du meine Hilfe?“
„Nein, nein, es geht mir gut. Ich habe bis eben geschlafen, weil ich die ganze Nacht im Internet unterwegs war. Stell dir vor, ich habe etwas gefunden!“
„Das freut mich wirklich. Komm her!“
Konrad wohnte nur drei Straßen weiter und Janosch machte sich zügig auf den Weg. Einen Moment später saßen sie in einem gemütlichen Wohnzimmer und tranken Tee.
„Schieß los!“, forderte Konrad seinen Freund auf.
„Kennst du eine Professor Doktor Zackig? Sie hat ein Institut hier in Eltville.“
„Ja, ich kenne den Namen. Doch das ist keine Arztpraxis. Sie behandelt dort keine Patienten, die vorbeikommen und man bekommt auch keinen Termin, als wenn man normal zum Arzt geht.“
„Das ist mir egal, kannst du dafür sorgen, dass sie mich anhört? Du erzählst ihr, dass ich fast schon tot bin und überzeugst sie davon, dass sie mir hilft.“
„Ich kann gerne mal nachfragen. Aber mach dir nicht so große Hoffnungen. Diese Frau arbeitet hauptsächlich in der Forschung.“
„Wenn sie mir damit das Leben rettet, kann sie gerne an mir herumforschen.“
„Warte, ich probiere es. Die Onkologie in Wiesbaden hat ihre Nummer.“
Konrad griff zum Telefon, rief zuerst seinen Kollegen in Wiesbaden und danach die Wissenschaftlerin an. Nach einer halben Stunde, in der Konrad Janoschs Krankheit ausführlich beschrieb, legte er auf.
„Sie sagt, sie ist nicht die richtige Ärztin für dich. Aber sie hat mir drei Kollegen empfohlen.“
Janosch sprang auf und lief auf und ab.
„Was soll das heißen? Wie will sie denn nur von Telefon her wissen, dass sie mir nicht helfen kann? Das ist unterlassene Hilfeleistung!“
„Janosch, bitte beruhige dich. Lass uns morgen früh gleich die drei Ärzte kontaktieren, vielleicht können sie etwas für dich tun.“
Konrad machte sich Sorgen um seinen Freund, der sich hier wohl in etwas verrannt hatte. Janosch setzte sich wieder erschöpft in den Sessel. Sein Atem ging schwer und kalter Schweiß hatte sich auf seiner Stirn gebildet. Mühsam versuchte er sich zu beruhigen.
Dann rollten Tränen der Verzweiflung über seine eingefallenen Wangen und tropften auf seine Knie.
„Sie will mir nicht helfen. Was ist das für eine Ärztin? Was kann man denn noch falsch machen bei mir? Ich krepiere doch so oder so!“
Seine Schultern bebten und Konrad sah ihn voller Mitleid und Schmerz an. Er würde seinem Freund so gern helfen, aber es gab wirklich nichts mehr. Jede neue Chemotherapie oder gar eine Immuntherapie würden ihn töten. Er ging hinüber zum Sessel und legte einen Arm um Janosch.
„Bitte mach, was wir gestern besprochen haben. Genieße die letzte Zeit! Und ich erkundige mich morgen nach den drei Spezialisten. Einverstanden?“
Janosch nickte und erhob sich. Er zog sich die Jacke an und verabschiedete sich. Langsam schlenderte er durch die Stadt. Seine Füße trugen ihn automatisch zu den Villen am Stadtrand. Welches Haus konnte es sein? Irgendwann blieb er stehen und sah durch die schmiedeeisernen Gitter eines großen Tores. Es war längst dunkel. Am Klingelschild stand „R.Z.“ und ein Schauer lief über Janoschs Rücken.
„Das muss es sein. R … Z … Ramona Zackig. Frau Professor, ich komme morgen wieder.“
Er sah das Licht in den Fenstern im Erdgeschoss. Mit einem Seufzen lief er heim.
4
Der Samstagmorgen begann mit viel Licht, das in Biancas Schlafzimmer fiel. Sie hatte vergessen, die Rollläden herunterzulassen. Um zwei Uhr war sie heimgefahren und ins Bett gefallen. Das Gespräch mit Ferdinand hatte ihr gutgetan und sie war bereit für Eric. Es war acht Uhr, in zwei Stunden würde er zurückkommen von der Nordsee und sie musste sich der Angelegenheit stellen.
Eine halbe Stunde später sprang sie aus dem Bett, duschte, machte eine Haarkur, während deren Einwirkzeit sie sich Kaffee kochte und zwei Scheiben Toast in den Toaster schob. Es duftete köstlich und wie zur Bestätigung des schönen Morgens brach die Sonne durch die Wolken.
„Das kann ja nur gut werden“, murmelte sie, als sie den Tisch deckte.
Sie setzte sich und frühstückte. Dabei las sie noch einmal Erics Nachrichten auf dem Handy und versuchte, irgendwelche Worte und Sätze zu entdecken, die ihr Angst machen könnten. Nichts, dachte sie, nichts, worüber ich mich sorgen muss. Er kommt nachher zu mir zurück und dann können wir endlich neu anfangen.
Ferdinands Kuss kam ihr in den Sinn, aber sie konnte die Erinnerung rasch wieder ausblenden. Das Jahr hatte mit Katastrophen begonnen, auch der Fall hatte ihnen alles abverlangt, doch jetzt wollte sie nur noch nach vorne schauen.
Mit Eric an ihrer Seite.
Wenn er heute mit guten Nachrichten heimkam.
Nun schlich sich doch wieder ein leiser Zweifel in ihre Seele und sie musste an ihr letztes Telefonat denken, bei dem sie ein merkwürdiges Gefühl im Bauch hatte. Was war an der Nordsee geschehen?
Bianca hatte sich zusammengerissen, um nicht das gesamte Internet nach Einträgen über diese Violetta Cherney-Ströckwitz zu durchsuchen. Ihre Freundin Riva hatte das vorgeschlagen, als die beiden zwei Stunden miteinander telefoniert hatten. Riva und ihr Mann hatten sich zu einer Reise durch Europa aufgemacht und Bianca vermisste die Gespräche und Abende mit ihr.
Sie hatten am Telefon alles besprochen und Riva hatte ihr unverblümt gesagt: „Wenn sie so aussieht, wie sie heißt, dann musst du ein Auge auf deinen Schatz haben. Hast du schon recherchiert?“
„Nein, ich will das nicht!“
„Tja, meine Liebe, beschwere dich hinterher nicht. Denk nur daran, dass du das bei Eric auch mal hättest tun sollen.“
„Eric hat gesagt, er klärt das und danach können wir uns eine gemeinsame Zukunft aufbauen. Ich vertraue ihm.“
„Da hat sich schon so manche Frau geirrt.“
„Riva! Mach mich nicht verrückt. Wenn ich ihm nicht vertraue, ist das doch wohl keine Basis für eine Beziehung. Nein, nein, ich werde warten, bis er kommt und mir alles sagt.“
„Gut, wenn es schief geht, weißt du ja, wie du mich erreichst. Ich finde zwar, du solltest es anders machen, aber egal, ich halte zu dir.“
„Wann kommst du denn wieder heim? Ich vermisse unsere schönen Abende.“
„Januar, Februar, März, April, Mai … so ist die Planung. Der Januar ist ja schon um. Süße, wir können jederzeit telefonieren. Was machen die Verbrecher?“
„Im Moment sind sie gnädig, zumal ich Ferdinand noch nicht wieder im Büro habe.“
„Der arme Kerl, geht es ihm besser?“
„Ja, viel besser. Sie wollte ihn nicht erschießen, sondern nur aufhalten. Hätte sie ihn töten wollen, hätte Ferdinand keine Chance gehabt. Ich bin froh, dass es ihn noch gibt. Es wäre schrecklich gewesen, auch noch an seinem Grab zu trauern.“
Nach dem Frühstück räumte Bianca auf und sah sich zufrieden um. Noch eine Stunde, also setzte sie sich auf die Couch, schaltete den Fernseher ein und zappte durch die Kanäle.
Pünktlich um zehn Uhr hörte sie den Schlüssel im Schloss, schaltete den Fernseher wieder aus und lief in den Flur. Die Tür ging auf und Eric stand mit Reisetaschen und einem Lächeln vor ihr. Wortlos flog sie in seine Arme. Eric presste Bianca an sich, als würde er sie nie wieder loslassen wollen. Endlich suchte er ihren Mund und küsste sie lange. Dann ließ er sie los, zog seine Jacke aus und hängte sie an den Haken, um Bianca ins Wohnzimmer zu folgen.
„Was für eine Fahrt, wie gut, dass es keine Staus gab. Ich bin so froh, wieder zuhause zu sein.“
Zuhause, dachte Bianca, er hat zuhause gesagt. Das gab ihr direkt ein gutes Gefühl zurück. Sie ließen sich auf die Couch fallen und hielten sich wieder fest. Eric schaute Bianca in die Augen.
„Hast du mich vermisst?“
Sie nickte.
„Du hast mir auch gefehlt. Ich freue mich auf das Leben mit dir.“
„Hast du klären können, was du wolltest.“
„Wir haben uns ausgesprochen, dass unsere Ehe zu Ende ist und dass ich eine neue Frau habe. Wir haben die Scheidung in Angriff genommen.“
Ah, dachte Bianca, das hört sich gut an, aber irgendwie habe ich ein komisches Gefühl.
„Das ist sehr gut, ich möchte nämlich den Rest meines Lebens mit dir verbringen und du sollst mein Mann sein, nicht ihrer.“
„War das gerade ein Heiratsantrag?“, fragte Eric lachend und küsste Bianca auf die Stirn.
„Nein, ich denke, du verstehst, wie ich das meine. Wir müssen nicht heiraten, denn ich fühle mich dir auch so verbunden.“
„Da habe ich aber Glück gehabt.“
„He! Was soll das heißen?“
Bianca knuffte Eric in die Seite.
„Vielleicht mache ich dir irgendwann einen schönen Antrag, aber jetzt ist erstmal wichtig, dass ich geschieden werde, damit das alles im Reinen ist.“
„Was hat sie gesagt?“
„Sie hat mir zugestimmt, dass wir lange genug getrennt sind und wünscht mir … uns alles Gute.“
„Sehr gut. Dann lass uns nicht mehr drüber reden, denn das belastet mich doch sehr.“
„Ich liebe dich und wir gehören zusammen.“
Sein Blick war klar und offen und Bianca beschloss, ihm zu glauben und ihre Zweifel über Bord zu werfen.
„Was machen die Verbrecher?“
„Sie sind im Urlaub.“
„Und Ferdinand?“
„Es geht ihm besser, aber er ist noch krankgeschrieben. Ich arbeite zurzeit mit Hannes und das funktioniert ganz gut. Es ist gerade sehr ruhig und entspannt. Weißt du, als ich auf dich gewartet habe, habe ich mir ständig Sorgen gemacht“, erklärte Bianca ehrlich, „dass du wieder mit deiner Frau zusammenkommst und mein Kopfkino hat mich einigen Schlaf gekostet, da wäre es schon besser gewesen, wenn ein schwerer Fall mich abgelenkt hätte. Aber dann habe ich beim Laufen einen Mann getroffen, der sehr krank ist und bald sterben wird. Er war auf einer Bank zusammengesackt und ich hatte ihm meine Hilfe angeboten. Als ich wieder zuhause war, ist mir in den Sinn gekommen, dass unsere Probleme winzig sind im Gegensatz zu richtigen Problemen. Und da war ich zuversichtlich.“
Jetzt hatte Bianca feuchte Augen und Eric strich ihr sanft über den Rücken.
„Du musst dir keine Sorgen machen, alles wird gut, bei uns jedenfalls. Hast du ihn noch einmal wiedergesehen?“
Bianca schüttelte den Kopf.
„Er hat Krebs und niemand kann ihm mehr helfen. Das tut mir echt leid.“
„Schlimmes Schicksal, vielleicht treffen wir ihn mal und können ihm eine Freude machen.“
„Das wäre eine schöne Sache. Danke, dass es dich gibt und dass unser Leben so gut läuft, auch wenn es mal kleine Hürden gibt.“
Eric ging duschen, danach fuhren sie in den Rheingau zum Mittagessen und der Tag endete nach einem langen Spaziergang auf der Couch. Am Abend rief Bianca Ferdinand an und berichtete von Erics Rückkehr.
5
Janosch stand am Montagmorgen vor dem Tor und schaute auf die Villa, die ein wenig zurückgesetzt unter alten Eichen lag. Seine kalten Hände umklammerten die Gitterstäbe und eine Träne lief ihm über die Wange. Er wusste nicht, ob er einfach klingeln oder abwarten sollte, dass jemand hinauskam.
Seine Überlegungen wurden vom Anblick eines Teenagers unterbrochen. Der Junge, der etwa sechzehn Jahre alt sein musste, hatte die große Eichentür ins Schloss fallen lassen. Er trug einen Helm in der Hand und lief um das Haus herum. Einen Moment später sah ihn Janosch mit einem knatternden Roller auf das Tor zukommen, dessen schmiedeeisernen Gitter sich wie von Zauberhand öffneten. Janosch war zur Seite gesprungen, aber der Jugendliche hielt neben ihm und schob das Visier des Helms hoch.
„Sie müssen klingeln, wenn Sie zu meiner Mutter wollen“, sagte er, tippte sich mit zwei Fingern gegen den Helm und fuhr davon.
Es war halb acht, also war der Junge auf dem Weg zur Schule. Bei der Kälte mit dem Roller, dachte Janosch und schüttelte sich. Wie kam der Junge darauf, dass er zu dessen Mutter wollte? Kamen öfter Patienten ins Haus? Oder waren es nur Lieferanten?
Diese Gedanken beschäftigten Janosch, als er durch das Tor schlüpfte, ehe es geschlossen war. Jetzt stand er in der parkähnlichen Anlage, die im Sommer wohl in allen Farben blühte. Heute war alles trist und grau und die kahlen Bäume reckten ihre Äste in den diesigen Himmel.
Unter seinen Schritten knirschte der Kies, als er auf das Haus zuging. Sein Herz klopfte, denn in seinem Inneren kämpfte die Hoffnung auf Leben mit der Angst, abgewiesen zu werden.
„Hier wohnen Ramona und Kevin und unser Name ist Programm“, las Janosch auf einem Keramikschild neben der Klingel.
Er hatte am Tor nicht geklingelt und nun fand sein Finger den Weg auf den runden Messingknopf. Im Inneren ertönte ein freundliches Geläut mit einer Melodie, die Janosch bekannt vorkam.
Die Frau von der Werbeanzeige öffnete die Tür und sah ihren ungebetenen Gast überrascht an.
„Frau Professor, Ihr Sohn hat mich …“
„Jaja, der Junge ist immer so unvorsichtig. Wer sind Sie und was wollen Sie von mir?“
Sie hatte die Augenbrauen hochgezogen und ihre Lippen waren ein schmaler Strich.
Janosch hatte sich seine Worte gut zurechtgelegt und sagte: „Ich bin Janosch Brickmann und brauche Ihre Hilfe, denn ich möchte nicht sterben. Bitte weisen Sie mich nicht ab und hören Sie ich an. Es wäre noch besser, wenn Sie sich meine Behandlungsakten ansehen könnten. Ich weiß, dass Sie eine bedeutende Forscherin in Sachen Krebs sind.“
Er war außer Atem und sah die Frau jetzt an. Jedoch antwortete sie nicht, sondern wollte eben die Tür zudrücken. Dann schien sie es sich anders zu überlegen. Sie schnaufte und biss sich auf die Unterlippe.
„Kommen Sie herein. Ich habe wenig Zeit, also müssen Sie schnell reden.“
Erleichtert, die erste Hürde genommen zu haben, trat Janosch in einen Flur. Sofort korrigierte er in Gedanken den Begriff in „Eingangshalle“. Die Frau wies mit der Hand auf eine Sitzgruppe und Janosch setzte sich auf die Sesselkante.
„Einen Moment, ich komme sofort.“
Während Janosch betete, dass sie ihm helfen konnte, telefonierte Ramona Zackig mit ihrem Forschungspartner, der heute im Labor arbeitete.
„Kevin hat einen Mann aufs Grundstück gelassen. Er ist krank und wird sterben. Denkst du, wir können ihm helfen? Er ist Mitte … Ende dreißig, vielleicht sollten wir mal …“
Am anderen Ende wurde gesprochen. Dann legte sie auf und nickte. Sie zog sich einen Kittel über und ging zurück zu Janosch, der immer noch mit geschlossenen Augen unbeweglich auf der Kante des Sessels hockte. Sie sprach ihn an und er folgte ihr in eine Art Büro. Janosch achtete nicht auf die Einrichtung, nicht auf das sagenhafte Licht, das aus dem Garten hereinfiel, sondern konzentrierte sich vollkommen auf seine Hoffnung. Es konnte nur gut werden, denn er saß vor der Frau, die an einem Heilmittel gegen Krebs arbeitete.
„Ich habe recherchiert, immer und immer wieder, Frau Professor, ich gebe nicht auf. Austherapiert ist nur ein Wort. Sie können gerne alles mit mir machen, wenn ich nur eine winzige Chance habe zu überleben.“