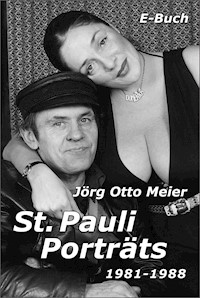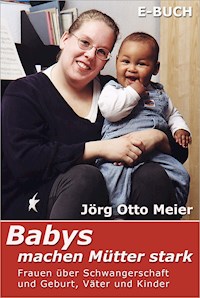16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eigenverlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Jörg Otto Meier porträtierte Werft- und Hafenarbeiter, Lotsen, Kapitäne und Vorstandsvorsitzende, Originale und Prominente. Sie und viele andere schauen bewusst in die Kamera und erzählen ihre Geschichten, in ihrer Sprache, offen und direkt. Zusammen mit zahlreichen Schiffs- und Hafenaufnahmen wirft das Buch realistische, amüsante und teilweise auch skurrile Schlaglichter auf die Welt des Hamburger Hafens. Kurze, unterhaltsame Statements und Anekdoten der Porträtierten laden zum Schmökern ein und sorgen — auch zwischendurch und auf Reisen — für kurzweilige, anspruchsvolle Unterhaltung. Das Hafenbuch Hamburg bietet ein breites Spektrum authentischer Zeitzeugen, deren Erinnerungen bis zurück zum zweiten Weltkrieg reichen. Es gewährt recht intime und bisweilen ergreifende Einblicke in die unterschiedlichsten Biografien, Weltbilder und Alltagsphilosophien. »Bücher über den Hafen dürften eine kleine Bibliothek füllen. Dieses hier aber ist ein besonderes, denn der Hafen porträtiert sich sozusagen in ihm selbst ... Mit diesem wunderschönen Foto-Text-Band ist Jörg Otto Meier etwas sehr Seltenes gelungen: Respekt vor Menschenleben und -schicksalen ohne große Worte, aber außerordentlich eindringlich in Szene gesetzt.« Kieler Nachrichten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
INHALT
Dieses Buch . . .
Editorial
Vorwort des Autors
Karl-Heinz Albers
Alter Elbtunnel
Bernhard Agren
Catarina ALT 287
Gerhard Backhus
Shun Kim im Dock
Ernst Blümke
Seute Deern
Kai Braun
Ballonstart
Dieter Bruhn
Altonaer Fischmarkt
Dr. Ernst-Wilhelm Bücken
Kranhaken
Harry Burmeister
Festmacherboote
Jörg Butgen
Taucher Flint V.
Peter Dietrich
HHLA-Hauptgebäude
Hildegard Eismann
Elbe 3
Heinrich Martin Gehrckens V.
Eisgang im Hafen
Vadim Glowna
Ausma Trader
Joachim Groß
Köhlbrandbrücke
Walter Grunwald
Johanna im Einsatz
Ali Gümüs
Puppy F im Schlepp
Ingeborg Herrmann
Containerschiffe
Carlheinz Hollmann
800. Hafengeburtstag
Heidi Kabel
Constant im Dunst
Jens Kastner
Oriana bei Nacht
Helmuth Kern
Van Carrier
Harald Kubiatowicz
Schlepperparade
Heinz Kunert
Regina Maersk
Käppen Lührs
Belatrix
Lumpi
Borstel
Hans-Jürgen Mohr
Boxer
Dr. Karl-Ludwig Mönkemeier
Schornstein
Alfred Moos
Rickmer Rickmers
Musa Boyali
Dockarbeiter
Heinz Oestmann
Museumshafen
Rudi Otto
Osaka Bay
Klaus Petersen
Aue Hamburg
Claus Raabe
Ems Ore
Ingrid Reuß
Hafenrundfahrt
Dr. Eckhard Rohkamm
Antriebsschraube
Helmut Sadelfeld
Aalsmeergracht
Klaus Schade
Regina Maersk
Uwe Schmalfeldt
Bananenverkäufer
Horst Seemann
Werftschuppen
Karl Sprenger
Poller mit Stahlseil
Peter Tamm
P&O im Dock
Annaliese Teetz
Oriana wird begrüßt
Hans Trieglaff
Barkassen
Dr. John Henry de La Trobe
Royal Princess
Robert Waider
Erica
Schiffsregister
Lexikon
Impressum
Jörg Otto Meier
Von Menschen und großen Pötten
Das Hafenbuch Hamburg
Tolino Edition
Überarbeitete Neuausgabe
der Duoton-Druckversion von 1996,
erschienen im Dölling & Galitz Verlag, Hamburg.
Hamburg, im Februar 2017
© Jörg Otto Meier
Fotos, Texte und Cover
sind urheberrechtlich geschützt.
Impressum
Dieses Buch . . .
... ist nicht nur ein Porträt des Hamburger Hafens mit seinen Menschen, Schiffen, Kaianlagen und Docks; es ist ein Spiegelbild dessen, wie wir alle fühlen, denken und handeln: höchst unterschiedlich und dennoch einig auf der Suche nach Anerkennung und „’n büschen Glück”.
JOM, im Juli 1996
Editorial
Die Fotografien und Texte entstanden im Zeitraum von fast drei Jahren: von August 1988 bis Februar 1990 und von März 1995 bis Juni 1996. Sie vermitteln einen sehr persönlichen Einblick in die faszinierende Welt des Hamburger Hafens.
Die Auswahl der Porträtierten geschah rein subjektiv und ergab sich aus spontanen Begegnungen und Recherchen mit ganz persönlichem Interesse an menschlichen Schicksalen und Lebensläufen aus unterschiedlichen und höchst gegensätzlichen Gesellschaftsbereichen.
In diesem E-Buch erscheinen 45 Porträts, atmosphärisch eingebettet in weitere 45 Hafen- und Schiffsfotografien. Kamera: Hasselblad 500 CM mit den Brennweiten 80, 150 und 250 mm. Filmmaterial: Kodak Tri-X pan, ISO 400.
Die Interviews, aus denen sämtliche Texte hervorgingen, entwickelten sich spontan aus der jeweiligen Situation, wurden im O-Ton aufgezeichnet, redigiert und mit den Porträtierten abgestimmt.
Das E-Buch wurde der Neuen Deutschen Rechtschreibung angeglichen. Die Worte „Schiffahrt” und „selbständig” behielten jedoch aus ästhetischen Gründen ihre bewährte Form.
Vorwort des Autors
Von 1975 bis 2002 habe ich auf St. Pauli gelebt. Fünfundzwanzig Jahre! Der Südwest-Wind trug oftmals Schiffssignale, Hafengeräusche und Gerüche bis vor meine Haustür in die Annenstraße. Fast täglich zog es mich zum Wasser hinunter, einem unbestimmten Fernweh folgend: über die Simon-von-Utrecht-Straße, die Reeperbahn, durch die Davidstraße, vorbei an der Herbertstraße bis hin zur Hafentreppe. Welch ein Blick überwältigte mich dort immer wieder jeden Tag! Kräne, eingedockte Schiffe, die St. Pauli-Landungsbrücken mit ihrer einmaligen Architektur. Und dann der Himmel, der hier höher und weiter erscheint als anderswo. Darunter der schimmernde Elbstrom. Und ganz hinten, unsichtbar weit in der Ferne: Cuxhaven, meine Heimatstadt mit der Kugelbake und der vorgelagerten Insel Neuwerk und ihrem Seeräuberturm.
Hamburg und der Hafen hatten mich schon als Kind fasziniert. Einer meiner großen Brüder wurde damals vom gestrengen Vater als Vierzehnjähriger auf große Fahrt geschickt, nicht ganz freiwillig und zum Leidwesen unserer Mutter. An der „Alten Liebe” vor Cuxhaven erklomm er, von einer schaukelnden Barkasse aus, die haushohe Bordwand eines Frachters und kehrte erst nach einem unendlich lang erscheinenden, bangen Jahr – das Segelschulschiff Pamir war 1957 unter dramatischen Umständen im Atlantik gesunken – nach Hamburg zurück. Welch ein Abenteuer, ihn mit meinen Eltern im unüberschaubaren Labyrinth des nächtlichen Freihafens abzuholen. Der große Pott lag, wie eine uneinnehmbare dunkle Festung, im Reiherstieg. Über eine schwankende Gangway ging es hinauf an Bord. Und da stand er endlich: unser Seemann! Aus dem Jungen war ein Mann geworden. Die damals grobspaßige und bisweilen lebensgefährliche Äquatortaufe, der raue Ton an Bord, zermürbende Seekrankheiten und vor allem das Heimweh hatten ihn reifen lassen. Zugleich waren aber auch all seine romantischen Seefahrts-Illusionen in sich zusammengebrochen. Trotzdem: unser Vater blieb ungerührt und erlaubte keinen Ausstieg ohne Abschluss. Und so musste mein Bruder wieder auf Große Fahrt hinaus auf See und brachte es schließlich, und nicht ohne Stolz, bis hinauf zum Kapitän. Vier goldene Streifen zierten fortan seine Uniform.
„Von Menschen und großen Pötten” ist also keine nüchterne Reportage, sondern eine sehr persönliche Hommage an die Seefahrt und den Mikrokosmos des Hamburger Hafens mit seinen sprachlichen Eigenarten, seiner Direktheit und seinem deftigen Humor. Bei jedem Porträtierten entdeckte ich zu meinem Erstaunen immer auch einen gewissen Anteil meiner Selbst und fühlte mich oftmals seltsam vertraut und berührt, wenn mir ein bislang fremd Geglaubter aus der Seele sprach, ohne es zu ahnen. Deshalb übermitteln all diese Texte nicht nur die Ansichten meiner Gesprächspartner, sondern umschreiben bisweilen auch mein eigenes, sehr emotionales Weltbild.
Ich danke allen Beteiligten für ihr offenherziges Mitwirken und das mir entgegengebrachte Vertrauen!
Hamburg, im Februar 2017
Karl-Heinz Albers
Schiffer des Dampfschleppers Claus D., 60 Jahre
Ich kann schon gleich morgens „O sole mio” singen. Die andern müssen erst mal ’n Kaffee haben und ’ne Dusche.
November 1988
Ich kann mich als echten . . .
... St. Paulianer bezeichnen, weil ich in meiner Wohnung in der Seilerstraße geboren bin mit Hebamme. Ich bin da aufgewachsen, bin zur Volksschule Seilerstraße gegangen, normalen Abschluss, nicht sitzengeblieben. Überall in der Nachbarschaft wohnten meine Freunde. Aber die sind ja alle weggezogen, zum Teil auch im Krieg umgekommen. Zwei Freunde sind Juden gewesen. Über Bäcker Röhlk am Hamburger Berg wohnte einer: Dieter Hammer. Mit dem spielten wir. Der Hamburger Berg hieß früher ja noch Heinestraße. Und im Judenkrankenhaus, das war ja das Heine-Krankenhaus – die Ärzte waren alles Juden –, bin ich ’n paar Mal gewesen, wie ich so meine Kinderkrankheiten hatte. Dieter musste dann nachher den Stern tragen, und er ist auch ins KZ gekommen. Das Makabre war aber, es gab so Autos zum Aufziehn, ’n Mercedes mit Hitler drin, da spielte er immer mit.
Wir waren damals ’ne ganze Clique hier. Der Hafen war ja unser Kampfgebiet.
Mit ’n Fahrrad durch ’n Elbtunnel: „Wer als Schnellster drüben ist!” Da haben wir Seeleute gespielt.
Ich brauchte ja nur die Davidstraße rauf, dann war ich ja schon im Hafen. Baumwall, die ganze Küste, wo jetzt die Promenade ist, das war alles Hafen. Die ganzen Gehrckens-Schiffe haben da gelegen, und die Schuten waren am Fischmarkt. Da haben wir dann rumgebutschert und gespielt. Sonnabends, sonntags war da ja kaum Betrieb. Man ist mit dem Hafen eben groß geworden. Hier wohnten ja auch viel Werftarbeiter – Werftgrantis haben wir immer gesagt –, die unterhielten sich in der Ketelkloppersprache. Die Dampfschiffe hatten ja Kessel, und da drin setzte sich dann Stein fest. Die Ketelklopper mussten in den Kessel rein und diese Steine abkloppen. Ja, und die hatten ’ne eigene Sprache wie die Sintis. Die nahmen bei jedem Wort immer die ersten beiden Buchstaben weg und setzten die hinten ran, und dann kam noch ’n i dazu; also zum Beispiel Glas: Asgli. Und so konnten die sich dann separat unterhalten, dass die andern das nicht mitkriegten. Das war ’ne Zunft.
Am Eichholz und in derDitmar-Koel-Straße, da waren die ganzen Zunftkneipen: Mauerleute, Zimmerleute, Hafenarbeiter. Die kamen dann von der Schicht rüber und haben noch schnell einen genommen: Lütt un Lütt. Blohm + Voss hatte 40.000 Menschen beschäftigt damals, und die sind alle durch ’n Tunnel gegangen. Die meisten haben auf St. Pauli gewohnt. Das war ’n richtiges Arbeitergebiet. Du hörtest da ja noch die Niethämmer von der Werft. Heute wird das ja alles geschweißt. Das war ein Leben! Das war wie Musik! Das hat mich angezogen, und das reizte uns natürlich als Jungs. Schon in der Schule haben wir abgemacht: „Heute Treffen! Durch ’n Tunnel! Is doch klar!” Wir hatten da ja auch unsere Leute. Wenn mal ’n Sack kaputtging, dann durften wir das aufsammeln, was da rauskam. Wir haben aber nie was gestohlen. Wir haben immer gefragt, und die Schauerleute haben uns dann Apfelsinen oder Bananen gegeben.
Ich weiß noch eine Story: Wir wollten mit ’ner ganzen Staude Bananen durch ’n Zoll – nicht geklaut, die hatten wir so gekriegt! –, da haben die Zollbeamten gesagt: „Nö, geht nicht! Alle rein hier und die ganze Staude aufessen!” Das konnten wir natürlich nicht.
Du kannst ja nur zwei Bananen essen als Kind, dann bist du voll; das stopft ja so.
Da haben die sich natürlich köstlich amüsiert, wie wir dann nicht mehr konnten. Na, aber dann haben sie doch gesagt: „Den Rest nehmt man mit, aber lasst euch ja nie wieder hier sehn!” – Das sind so Erinnerungen. Dann kamen die Wochendampfer an – ich rede von vorm Krieg. Von einem Schiff, da kannten wir den Kapitän und die Steuerleute. Die holten uns sogar rauf zum Mittag, ob wir sechs, zehn oder zwölf waren, und dann gab’s was zu essen. – Ich hab ’ne schöne Jugend gehabt. Wir waren vier Jungs zu Hause. Ich war der Jüngste. Und alle vier Jungs haben im Hafen gearbeitet. Mein Vater kommt ja schon von der Seefahrt; der fuhr noch auf Segelschiffen.
Während des Krieges musst ich Seefahrt machen bei der Handelsmarine. Ich wurde ganz jung eingezogen mit 15 Jahren. Und wie der Krieg zu Ende war, hab ich mich wieder auf den Hafen geschmissen und hab ’ne Ewerführerlehre und eine Schipperlehre gemacht und mit Erfolg bestanden und bin somit wieder im Hafen gewesen. Ich bin dann zur Feuerwehr gegangen, wie der Umschlag hier im Hafen so langsam nachließ, der Beruf Ewerführer fast auszusterben drohte und die Schipper- und Ewerführereien von großen Firmen geschluckt wurden. Ich bin dann auf’m Löschboot gewesen. Da hab ich als Beamter über 25 Jahre lang meinen Dienst gemacht. Ich hab etliche Einsätze mitmachen müssen, Schiffsbrände und Schuppenbrände und was sonst noch bei der Feuerwehr anläuft.
Ich bin dann mit 55 pensioniert worden: Verschleiß des Körpers.
Da hab ich gedacht: „Was nun? Nun hast du keinen Hafen mehr.” Dann wurde mir aber der Dampfschlepper Claus D. angeboten. Der hat ’ne ähnliche Form wie der Schlepper, wo ich früher meine Lehrzeit drauf gemacht hab. Das Schiff liegt jetzt im Museumshafen, und ich bin dort als Crewleiter tätig. Die Mannschaft musste ich mir über Annonce suchen. Das mussten ja vor allen Dingen Leute sein, die mit Dampf umgehen konnten. ’n Schipper kriegt man ja leicht, aber ’n Maschinist, der mit Dampf umgehen kann, ist ’ne Rarität. Das Schiff haben wir ’84 gekriegt und haben es dann vollkommen überholt. Da war viel, viel Arbeit dran. Wir sind immer noch nicht fertig. Die Maschine ist noch ganz und gar raus und wird gerade von dem Maschinisten überholt. Ich hoff, dass wir mit dem ganzen Schiff in zwei Jahren fertig sind.
Ich treff mich übrigens jetzt im Winter des öfteren mit Hafenschippern am Altonaer Bahnhof, und zwar in der Einkaufszone. Die treffen sich da jeden Tag um zehn Uhr morgens, und dann wird bei Eduscho ’n Kaffee getrunken und geklönt, und dann weiß ich so ziemlich übern Hafen Bescheid, denn die sind zum Teil noch immer so’n büschen in’ne Gang. Bei Urlaubsvertretungen oder zum Hafengeburtstag fahren die noch. Bei mir ist das genauso wie bei denen: Meine Liebe zum Hafen ist geblieben. Ich war jetzt auf Fuerteventura: herrlich und schön. 24 Grad hatten wir, Wasser 20. Aber nach drei Wochen hatt ich Heimweh. Kannst du dir das vorstellen?
Ich bin ’ne Frohnatur, wo sich viele schon drüber beschwert haben. Ich kann schon gleich morgens „O sole mio” singen. Die andern müssen erst mal ’n Kaffee haben und ’ne Dusche. Ich bin schon voll am Ball. Ich geh auch auf alle Menschen zu. Ich hab zum Beispiel junge Mädels im Hause wohnen, die haben gesagt: „Is ja doll, Kalli, dass wir gleich mit dir so wahnsinnig Kontakt kriegen.” Aber das liegt eben auch daran, dass ich auf die zugegangen bin. Ich bin ja hier der Ältere. Das ist eben meine Natur, und ich hab da viele Menschen durch kennengelernt.
Ich bin auch einer, der sagt: „Wo kann man eventuell mal was Gutes tun?”
Ich hab Rentner versorgt zum Beispiel, die oben bei mir im Haus gewohnt haben. Ich hab für die eingekauft. Das ist für mich aber so ganz selbstverständlich. Man könnte vielleicht noch viel mehr machen, aber ich hab durch den Schlepper natürlich viel, viel an der Hacke. Nebenbei segel ich auch. Ich mach den Steuermann bei Clippers und mach da meine Törns mit. Dadurch hab ich auch viele Jugendliche kennengelernt, die sehr begeistert sind von mir. Ich mach ’n bisschen Musik, und dadurch kommt das vielleicht auch: Gitarre raus und geh unkompliziert an alles ran.
Ich spiel ab und zu mal mit ein oder zwei Leuten zusammen auf Schiffen und neben dem St. Pauli-Theater in der Kneipe oder privat auf Feten. Ich selber mach ja auch ab und zu mal so was und sag: „Komm, da müssen mal Leute rein in meine Wohnung, dass das mal ’n bisschen anders riecht.” Dann ruf ich an, jung und alt. Ich finde, das müsste man öfter mal machen. Das ist ja auch keine Geldfrage. Die verdienen heute alle einigermaßen, und dann wird zusammengelegt, oder man bringt was mit.
Ich mag Menschen gern. Aber es gibt nicht mehr viele gute Menschen, muss ich leider sagen; vielleicht nur ein Drittel der Menschheit. Also ich bin anders erzogen, und irgend jemand was wegnehmen oder was stehlen ist für mich nicht drin. Dann hätt mein Vater mich windelweich geschlagen. Und heute ist das alles so . . . Bei mir im Haus sind schon zwei Einbrüche gewesen! Da ist ja nichts mehr heilig! Mein Auto ist zweimal aufgebrochen worden, Radio raus und all so was. Das kann ich nicht begreifen.
Alter Elbtunnel
Landungsbrücken, Mai 1995
Bernhard Agren
Fischauktionator im Ruhestand, 69 Jahre
Freier Sonnabend? So’n Blödsinn kannten wir doch überhaupt nicht!
März 1989
Ich bin 1952 Auktionator geworden . . .
... Mein erster Dampfer hatte etwa 3.500 Zentner Fische gefangen, und ich hatte das große Glück, dass er eine hervorragende Qualität mitbrachte, dass eine hervorragende Nachfrage bestand, und dass ich deshalb hervorragend verkaufen konnte. Aber nach einer Stunde Auktion war meine Stimme weg. O Gott! hab ich gedacht und hab alles Mögliche versucht. Ich habe sogar an das Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein gedacht, wo der Wolf Kreide gefressen hat, um eine etwas weichere Stimme zu kriegen.
Ich hab tatsächlich ’n halbes Stück Kreide gegessen. Aber das hat auch nichts genützt.
In der Mittagspause bin ich schnell den Berg hoch. Da war ’n Onkel Doktor. „Tja”, sagt er, „da kann ich Ihnen einen guten Rat geben: Acht Tage nicht sprechen!” – „Ja”, sag ich, „Herr Doktor, das ist gerade das, was ich nicht kann. Ich muss morgen früh wieder versteigern.” Und am nächsten Morgen ging’s auch irgendwie wieder. Das kann ein Außenstehender wahrscheinlich gar nicht so begreifen, aber es ist anstrengend, über ein, zwei Stunden laut zu sprechen. Da kriegt man Schweißausbrüche! Aber irgendwie hat sich das denn wieder eingespielt. Und dann lernte ich auch von mir selbst aus das Sprechen. Ich hatte immer, ähnlich wie die Opernsänger, den Kragen offen, damit die Stimmbänder da nicht gegenschlugen. Wir haben später Auktionatoren ausbilden wollen, haben die sogar an die Rednerschule geschickt. Aber das wurde trotzdem nichts. Dazu gehört ein Naturtalent – und ’ne laute Stimme. Ich war zuletzt im Kriege Feldwebel und Zugführer, hatte also relativ früh gelernt, vor der Front zu stehen und laut zu brüllen.
Na, und dann kamen die 50er-Jahre, der Wiederaufbau. Der Fischmarkt war durch Bomben beschädigt und teilweise zerstört. Alles wurde wieder aufgebaut. In Hamburg-Altona bestand seit Jahrzehnten eine potente, große Heringsindustrie. Die Firmen Appel und Ide, und wie sie alle hießen, kauften und verarbeiteten zum Teil 1000 und 15hundert Kisten à 120 Pfund. Damals wurden so viele Heringe gefangen, das muss so ’53, ’54 gewesen sein, da haben selbst die Fischmehlfabriken diese Massen nicht mehr aufnehmen können. Allerfeinster, bester Hering! Das hat sich nachher aber alles zurückentwickelt. Die Flotten und die Schiffe wurden ja größer, und so ist es dann leider dazu gekommen, dass Anfang bis Mitte der 60er-Jahre der Hering immer weniger wurde. Die letzte große Reederei, die Cranzer Fischdampfer AG, hat 1969 ihre Pforten geschlossen mangels Fisch. Danach haben sich hier Großhändler, Industrielle und zum Teil der Einzelhandel zusammengeschlossen und haben von dieser Gesellschaft drei Dampfer übernommen und ein viertes Schiff dazugekauft aus Bremerhaven. Das war dann die sogenannte Hamburger Fischfang. Die hat aber nur noch drei Jahre gehalten, und ab ’72 gibt es hier in Altona keine Anlandungen mehr mittels Trawler. Und nun ist man ja dabei, das Hafenbecken hier am Ausrüstungskai zuzuschütten.
Als der Fischmarkt noch florierte, waren wir manchmal morgens schon um vier in der Halle, und nachmittags um halb vier waren wir noch nicht wieder raus aus dem Büro, weil so viel zu tun war. Das war nicht immer so, aber an vielen Tagen und Wochen. Wir waren mit viel Spaß bei der Arbeit. Uns brauchte auch niemand zu sagen: „Ihr müsst schneller arbeiten! Ihr müsst morgen nicht um vier, ihr müsst schon um halb vier in der Halle sein!” Das haben wir uns abends selbst überlegt.
Dieses Leben hatte natürlich zur Folge, dass wir relativ früh zu Bett gingen. Neun, halb zehn war Sense. Also sechs Stunden brauchte ich schon zum Schlafen, auch wenn wir jung waren. Als ich hier anfing, war ich 26 Jahre alt, ich war gerade Familienvater geworden. Die Tochter war gerade geboren. Das Familienleben musste da ein wenig zurückstehen. Das war eben so. Da wurde nicht lange rumgekaspert. Und vor allen Dingen, das ging ja nun auch die ganze Woche so. Freier Sonnabend? So’n Blödsinn kannten wir doch überhaupt nicht! In den Wintermonaten, wenn nicht soviel zu tun war, konnten wir sonnabends schon mittags um zwei Feierabend machen. Das war schon ’ne große Errungenschaft.
Hart war’s, wenn ich mich völlig heiser gebrüllt hatte und nun am nächsten Morgen wieder dasselbe Theater machen musste. Wir waren mit vier sogenannten Verkaufsgespannen, also vier Auktionatoren und vier Protokollführern unterwegs. Wir haben versucht, den Preis für den Reeder möglichst hochzutreiben. Damals hat der sogenannte Konsumfisch, Rotbarsch, Seelachs und Kabeljau, ja nur um die 14, 15 Pfennige das Pfund gekostet. Wir haben hier per Pfund versteigert, obwohl’s ja eigentlich per Kilo üblich ist. Es wurde viertelpfennigweise hochgezählt. Das hörte sich in etwa so an: „18 Pfennig per Pfund war der Einsatz, meine Herrn. Viertel, halb, dreiviertel, 19, viertel, halb, dreiviertel, 20 für Meier. Wieviel will er haben? Fünfmal will er haben! Also fünfmal für Meier!” In der Art lief das ab, nur eben so schnell, dass Außenstehende das nicht verstehen konnten.
Nach der Auktion wurden die Abrechnungen für den Reeder geschrieben. Der wollte ja nun wissen, was sein Dampfer an Erlös gebracht hatte. Das waren so 50- bis 60.000 Mark. Wenn es an 80.000 Mark heranging, war das schon hervorragend. Heute erlösen die paar Fischdampfer, die wir noch haben in Bremerhaven, allerdings schon mal weit über 400.000 Mark. Fisch ist ja heute teuer. Der Rotbarsch kostet heute zirka 1 Mark 20 das Pfund in der Auktion. Die Reederei gab die Abrechnung wiederum zu ihrer Heuerstelle, zu ihrer Zahlstelle. Die Mannschaften warteten schon. Die waren ja am Gewinn beteiligt. Und dann waren wir da fleißig am Rechnen.
Damals gab’s ja keine Computerrechnung. Damals gab’s nur Kopfrechnen und notfalls auch noch so ’ne kleine Kurbelmaschine.
Na, irgendwann ’68 bin ich dann Prokurist geworden und hab in den letzten sechs, sieben Jahren unsere drei Tiefkühllagerhäuser geleitet. Aber das ist ein abgeschlossener Lebensabschnitt, und der ist jetzt zu Ende. Ich empfinde das heute als sehr angenehm, nicht mehr unbedingt mit der Uhr arbeiten zu müssen: „Du musst dann und dann dort und dort sein!” Es hört sich vielleicht lächerlich an, aber es ist schon ein schönes Gefühl, in aller Ruhe vor dem Rasierspiegel zu stehen: „Hallo, ich hab doch Zeit!” – Ich hab trotzdem immer etwas vor. So ist das nicht. Ich würde es als schrecklich empfinden, wenn ich morgens früh aufsteh, mich hübsch mache, wie ich immer zu meiner Frau sage, mich dann in den Sessel setze und sag: „Was mache ich jetzt? Nun kommt, Leute, unterhaltet mich mal!” Das schließt nicht aus, dass ich, wie gestern bei diesem ollen Mistwetter, eben zu Hause bleibe. Da gibt’s genug zu tun. Wir lesen sehr intensiv die Zeitung. Das muss halt sein, obwohl ich nicht alles glaube, was da drin steht. Aber man muss informiert sein über alles. Nein, ich empfinde das Leben als sehr schön, ich bin, meine ich, gesund, abgesehen von meinen Augen. Da muss ich ein wenig aufpassen. Ich hab ’n grünen Star. Na, mit 67 Jahren? Nun sagen Sie schnell, ich sehe jünger aus, wie 63! Na, ich kann mich nicht beklagen.
Vor einigen Wochen wurde in den Nachrichten wieder über Polen berichtet. Da sagte ich zu meiner Frau: „Wir haben weiß Gott durchaus Gründe, über vieles zu meckern: zum Beispiel die Hafenstraße, oder dass heute kaum noch jemand im Dunkeln über die Straßen laufen darf, weil er tatsächlich befürchten muss, überfallen zu werden.
Aber wir haben das schönste Deutschland, was wir bisher in unserer Geschichte gehabt haben.”
Das ist meine feste Überzeugung, und da lass ich mich auch nicht von abbringen. Ich habe als Kind die Weimarer Zeit mitgemacht. Gut, wir haben nie darunter zu leiden gehabt, weil mein Vater, wie das so schön heißt, immer in Lohn und Brot stand. Aber man muss sich das mal überlegen: damals, in den 30er-Jahren, als wir das große Arbeitslosenheer hatten von sechseinhalb Millionen Menschen, da wurde echt gehungert! Da gab das keine Sozialhilfe! Da gab das von der Wohlfahrt drei Mark die Woche. Und deswegen versteh ich auch nicht, weil das nun gerade aktuell ist, dass für morgen schon wieder irgendwelche Demonstrationen angesagt sind für die RAF und gegen die Isolationshaft. Dafür hab ich, das tut mir leid, kein Verständnis. Ich bin nicht derjenige, der jemanden, der etwas Verbotenes getan hat, auf ewig verdammt. Jeder kann mal ausrutschen. Man soll auch jedem die Chance geben, wieder in die richtigen Bahnen zurückzukommen. Aber Terroristen sind Leute, die sind rechtskräftig verurteilt, weil sie geschossen haben, weil sie Bomben geworfen haben. Die haben auf nichts Rücksicht genommen! Die gehören in Haft, und die gehören auch schön allein in Haft! Und jetzt noch demonstrieren? Das heißt für uns, wenn wir so etwas im voraus lesen, meine Frau und ich, wir können nicht in die Stadt gehen, ohne Gefahr zu laufen, da irgendwie drin verwickelt zu werden, vielleicht noch ’n Pflasterstein an’n Kopf zu kriegen. Das bestimmen die, ob wir in die Stadt gehen können oder nicht.
Meine Kinder sind einigermaßen ordentlich geworden. Ihre Frechheiten haben sie trotzdem gehabt, aber die haben nichts mit Hasch zu tun gehabt. Die haben keine Fensterscheiben eingeschlagen. Die haben sich nicht vermummt und all so Dinger. Es gehört schon ein wenig dazu, wenn die eigenen Kinder, naja, ich will mal sagen, ordentlich werden sollen. Aber bei uns war ja auch immer jemand zu Hause. Wenn die Mutter mal nicht da war, dann war die Oma da als Ansprechpartner.
Naja, dann kam der große Freizeitboom. Viele machen heute freitags schon mittags Schluss. Freizeit? Jetzt muss ich mich betätigen. Der Vater: „Ich muss heute mein Auto waschen!” und: „Jetzt muss ich zum Fußballplatz!” und was weiß ich noch. Und die Mutter: „Ich geh zum Squash!” und: „Ich geh zum Damenkränzchen!” – Ich gönn es ihnen ja allen, aber die Kinder bleiben häufig auf der Strecke! Dazu kommt heute noch ein gewisser Überdruss.
Heute muss man mit 18 möglichst schon ’n eigenes Auto haben.
Wir waren froh, wenn wir ’n Fahrrad hatten als Kinder. Heute muss es ein Mofa sein. Aber so sind die Wünsche heute. Nein, wissen Sie, jeder soll sein Leben so gestalten, wie er das gerne möchte, aber irgendwo gibt das auch gewisse Leitlinien. Und wenn ich das höre: Da hatte sich einer an ’ner Maschine die Fingerkuppen abgesägt, da sagt der doch glatt: „Hier, gucken Sie mal, jetzt kann ich 14 Tage krank machen!” Was ist das für ’ne Einstellung! – Ganz abgesehen davon, dass die sich dann immer einbilden, sie schädigen ihre Firma. Aber sie schaden ja auch ihren eigenen Kollegen, denn diese Arbeitskraft, die fehlt doch irgendwo. Solche Einstellungen, muss ich wirklich sagen, haben wir nicht gekannt. Oder ich hatte das besondere Glück, in einem anderen Kreise groß geworden zu sein.
Catarina ALT 287
Museumshafen Övelgönne, Juni 1989
Gerhard Backhus
Feuerwehrbeamter und Decksmann auf der Nostra, 54 Jahre
Meine Frau sagt dann immer: „Geh bloß an’n Hafen, sonst wirst du noch gnatterig.”
Juni 1989
Gunter und ich, . . .
... wir gehören so praktisch zur Stammbesatzung der Nostra. Kost ja nix. Wir machen das hier ja als Hobby, und das macht riesig Spaß auf so’n alten Dampfer, der bald 100 Jahre alt ist. Dass du da überhaupt mitmachen darfst, das ist eben das, was uns schon reizt. Ich kann den ganzen Tag hier verbringen. Touristen kommen natürlich auch. Die fragen als erstes immer: „Was kost so’n Dampfer?” Und einige glauben das gar nicht, dass das Schiff nun wirklich noch segelt, weil das ja ’n Museumshafen ist. Aber in diesem Museumshafen sind ja alle Schiffe noch fahrbereit. Und das gibt’s eigentlich nirgendwo. Bei schönem Wetter, sonnabends, sonntags, ist Völkerwanderung. Dann kannst du hier immer nur stehn und Auskunft geben. Aber das machen wir ja gerne. Mitunter machen wir ’ne Schiffsführung und spinnen ihnen mit ’n bisschen Seemannsgarn die Hucke voll, aber so, dass sie’s nicht merken. Danach schmeißen sie was in die Schiffskasse.
Ich bin hier ’n bisschen weiter längs geborn und war eigentlich immer am Hafen. So nach ’n paar Tagen, wenn ich denn mal weg war, muss ich hier auch schon wieder runter. Meine Frau sagt dann immer: „Geh bloß an’n Hafen, sonst wirst du noch gnatterig.” Aber sie ist eigentlich auch ganz froh, dass ich so’n Hobby hab.
Denn irgendwo rumhängen, das liegt mir nicht. Ich muss immer ’n bisschen was tun.
Ich bin ja eigentlich übers Kochen zur Segelei gekommen. Aber nun macht mir das mehr Spaß, an Deck zu fahren. So langsam beherrsch ich diesen Kram auch: Vorsegel, Großsegel und Besan. Das klappt schon alles ganz gut. Bloß hier am Ruder, da hab ich immer ’n bisschen Schwierigkeiten; da guckt Klaus immer, weil ich nicht nach Kompass fahren kann. Ich muss immer was sehn. An Deck ist doch ’n bisschen mehr action, denn unten in der Kombüse, da bist du einsam bei schön Wetter, und die andern hängen alle an Deck. Alles sagt: „Ich helf dir! Ich helf dir!” Aber dann machs’ das doch alleine.
Ich hab natürlich so einige Stürme schon mitgemacht.
Und wenn dir da unten die Töpfe durcheinander wirbeln in der Kombüse, dann wird das ganze Kochen so’n bisschen kompliziert. Aber wenn mir dann einer sagt: „Es kann nicht gekocht werden, und um 12 kann nicht gegessen werden”, das ist totaler Unsinn. Dann werden die Töpfe eben angelascht, und dann wird da ’n bisschen weniger reingepackt, damit das oben nicht überweg geht. Da musst du dich eben selbst auch so’n bisschen anbinden, und dann geht das. Es muss eben gehn. Die müssen ja was zu essen haben. Naja, ich mein, wenn die See nun ’n bisschen zu stark ist, dann kommen die schon von selbst an und sagen: „Ich hab keinen Hunger!” Dann kannst du vorher schon die Portionen so’n bisschen reduzieren und Tee kochen und Zwieback hinlegen. Dann machen sie das schon freiwillig, dass sie dabeigehn. Aber sowie der Dampfer wieder gerade liegt, haben sie wieder Hunger. Dann musst du schon was haben, womit du die Back vollstellen kannst.
Wir opfern eigentlich unsern ganzen Urlaub für die Clipper-Reisen, damit wir mit Jugendlichen unterwegs sind. Das ist ja auch ’ne schöne Aufgabe. Und ich komm wunderbar mit den Jungs klar, auch mit den Mädchen, denn an und für sich sind sie unkompliziert. Die machen eigentlich alles ganz selbständig, wenn man die von Anfang an für voll nimmt und sich nicht hinstellt als Respektsperson. Das ist meiner Meinung nach auch überholt, wie die Alten das früher gemacht haben. Ich hab sie ja noch kennengelernt, wie sie das goldene Parteiabzeichen trugen. Da wurde ja noch Unterricht gemacht nach dem Motto Zucht und Ordnung, vor der Tafel stehn, drei Zentimeter davon ab. Und konntest du die Aufgabe nicht, dann hast du schon ein’ im Genick gehabt, und bist mit ’n Kopp gegen die Tafel gegangen. Zu Haus durftest du natürlich auch nichts sagen, weil die Eltern ja die Einstellung hatten: „Das wird schon richtig sein, was der Lehrer macht!” Das war natürlich totaler Quatsch, war das! Schwachsinn! Und nachher, nachdem sie entnazifiziert wurden, waren sie wie umgewandelt. Da haben sie mit dir Meister Jakob gesungen.
Wenn man jetzt so die Jugendlichen sieht am Spritzenplatz in Altona, dass die sich aufbäumen, die Jungs, sich ja bunt anmalen, und die Mädchen auch, dass die ’n Frust haben, wenn sie ihre 40, 60 Bewerbungen losgeschickt haben und nichts bekommen an Arbeit, dann kann ich das verstehen. Aus Protest würd ich mich auch so anmalen. Ja, natürlich! Man muss sich nur Gedanken machen, warum die das machen. Da kann man nicht als Rentnerehepaar, wo sie beide satt ihre Rente bekommen, die Leute auch noch anmachen und sagen: „Ihr sollt mal lieber sehn, dass ihr Arbeit kriegt!” Und wenn die zu mir sagen: „Hast du mal ’n paar Groschen?” Warum sollen sie die nicht kriegen? Also, ich mach das eigentlich immer. Ja, und auch so, wenn mir einer erzählt, dass er Angst hat, da vorbei zu gehn ... Ich weiß gar nicht warum? Die tun dir wirklich nichts. Und bei der Hafenstraße seh ich das Ganze an und für sich so als Politikum an.
Die sind doch ganz froh, dass sie die Hafenstraße noch haben.
So können sie dann von sich ablenken, von dem Scheiß, den sie selber machen. Den können sie damit immer schön vertuschen. Den können sie auf der dritten Seite als Dreizeiler bringen. Dafür kommt der Aufmacher ganz vorne drauf: „Hafenstraße hat wieder das und das gemacht!” Geräumt haben sie ihre Bauwagen ja neulich selbst. So, wie ich das seh, hat die Hafenstraße unsere Polizei, unsern Senat, damit so richtig vorgeführt. Allein die Polizei war auf Randale aus. Die hatten ja wohl schon ihre ganzen Einreißbirnen und alles irgendwo in ’ner Seitenstraße stehn. Aber hat nicht geklappt. Und nun müssen sie sich natürlich wieder was einfallen lassen, damit sie die Grundstücke kriegen.
Shun Kim im Dock
Blohm + Voss, Dock Elbe 17, Juli 1995
Ernst Blümke
Polizeihauptmeister bei der Wasserschutzpolizei, 49 Jahre
Ein schweres Problem unserer Zeit zeigt sich bei mir an den Landungsbrücken: die Einsamkeit der alten Leute.
Mai 1989
Die Beamten der Wasserschutzpolizei . . .
... Hamburg werden grundsätzlich aus der Seefahrt rekrutiert. Einstellungsvoraussetzung ist das nautische oder technische Patent hier in Hamburg. Ich bin 18 Jahre zur See gefahren, als Steuermann und als Kapitän. Und wie das eben so ist bei der Seefahrt, wenn man verheiratet ist und Kinder hat, dann sucht man sich etwas anderes, möglichst an Land. Diese Situation trat bei mir erst so mit dem 30. Lebensjahr ein. Bei 35 liegt bei den meisten Behörden die Altersgrenze, und ich hab mir das auch mit 35 noch im letzten Moment überlegt. Die Ausbildung, die läuft über zweieinhalb Jahre in Alsterdorf. Man erlernt einen neuen Beruf. Man setzt sich da also wieder auf die Schulbank und bekommt den polizeilichen Unterricht.
Das ist nicht ganz unproblematisch, wenn man so einem Seemann das Marschieren beibringen will oder das Grüßen oder das Geradestehen.
Aber es funktioniert. Ein großes Handicap ist eigentlich die gesundheitliche Voraussetzung, denn es wird eben auch eine gewisse sportliche Leistung verlangt, und da fallen unsere Kollegen von der Seefahrt sehr oft durch. Ja, es ist eben doch schwierig, wenn man an Bord ist und nicht so die Möglichkeit hat, sich sportlich zu betätigen. Und dann sind da natürlich auch schon die ersten Wehwehchen mit 35, ob das nun der erhöhte Blutdruck ist oder etwas anderes. Und darum haben wir Schwierigkeiten, aus der Seefahrt zu rekrutieren.
Der Verdienst spielt natürlich auch eine Rolle. Ich hab zuletzt noch auf einem Zyprioten angemustert als Erster Offizier, hab 4500 netto gehabt und fing mit 1200 Mark bei der Wasserschutzpolizei an. Das soll man erst mal der Ehefrau klarmachen. Aber die ist auf jeden Fall dafür und sagt, ihr Mann soll zu Hause sein, damit dieses Zigeunerleben endlich aufhört, vor allem, wenn schon ein Kind da ist. Als mein Sohn geboren wurde und ich noch zur See fuhr, kam meine Frau im nächsten europäischen Hafen, mit dem Jungen in der Babytasche, mit Sack und Pack an Bord; was man eben so alles braucht: Windeln, Babynahrung und sonst was. Na ja, dieses Zigeunerleben sollte eben zu Ende sein, und da ist die Auswahl für einen Seemann ja nicht groß.
Ich bin ’74 angefangen am Revier 1 hier an den St. Pauli-Landungsbrücken. Dann kam im Rahmen der großen Polizeireform die Zentralisierung. Das heißt, man wollte die kleinen Reviere zusammenziehen. Man wollte das Großraumrevier. Die kleinen Reviere vor Ort wurden aufgelöst, und das große Revier an der Ellerholzschleuse wurde gebaut. Das ist nun das Revier 2. Das ist mein zuständiges Revier.
Es hat nicht lange gedauert, bis die Bevölkerung merkte, dass ihre Polizei nicht mehr sofort kam. Wenn zum Beispiel hier an den Landungsbrücken jemand ins Wasser fiel, dauerte es 20 Minuten mit der Barkasse, bis wir da waren. Dann kam dazu, wenn hier nachts Jugendliche oder Betrunkene was zerstörten, einbrachen. Wir kamen immer zu spät, so dass diese Leute hier drüben zu Recht sagten: „Das muss geändert werden!” Man fing sogar von den Barkassenführern an, selbständig kleine Gruppen zu bilden, die sich über Nacht hier aufhielten. Also das war kein Zustand, so dass die Revierführung drüben zu der Einsicht kam: „Hier muss wieder einer rüber!” Und da ich vom Revier 1 sowieso so’n bisschen Ahnung hatte, hab ich mich bereiterklärt. Seitdem sind das nun schon sechs Jahre. Ich mach hier den sogenannten Tagesdienst. Ich gehe zwölf Stunden Dienst, von morgens 7 bis abends 19 Uhr. Im Sommer verändere ich das ’n bisschen; da komm ich später, um 9, und bleib dann bis 22 Uhr. Meine Aufgabe ist hier, die Verbindung zur Wasserschutzpolizei zu halten, aber auch der Bevölkerung so eine Art Ansprechperson zu sein.
Ein schweres Problem unserer Zeit zeigt sich bei mir an den Landungsbrücken: die Einsamkeit der alten Leute. Die gehen hier an ihrem Hafen spazieren. Ja, das ist ihr Hafen; sie sind ja Hamburger Bürger. Da, wo sie zu Hause sind, mögen sie kaum noch jemanden ansprechen. Die Nachbarn sagen schon: „Die ist ja tüdelig!” nur weil sie eben immer jemanden ansprechen. Deshalb werd ich auch oft gefragt von den alten Leuten: „Sagen Sie mal, bin ich eigentlich tüdelig?” Und ich muss es ihnen dann bestätigen, dass sie’s nicht sind, aber dann auch ganz ehrlich. Der Supermarkt bietet ihnen ja keine Möglichkeit zum Gespräch. Da werden sie an der Kasse weitergeschubst, und ihre Rente kriegen sie nicht mehr am Postschalter, sondern aufs Girokonto. Wenn sie dann noch in der Zeitung lesen, dass Klingelgangster unterwegs sind, dann lassen sie die Haustür auch zu.
Wenn die dann hier spazieren gehen und sehen mich in Uniform, dann denken sie: „Naja, der haut mir ja kein’ übern Kopf.” Das sagen sie mir dann auch glatt: „Sie tun mir doch nichts?” – „Nein, nein, ich tu Ihnen nichts.” Das ist dann ganz drollig. Die wollen mir dann ihre Geschichten erzählen. Das ist sicher nicht polizeirelevant. Das wäre eigentlich die Aufgabe einer ganz anderen Behörde. Aber das ergibt sich eben so dabei. Die Kollegen, die freuen sich natürlich.
Ich bin der Wanderprediger oder derjenige, der den Omas hier so die Fähre nach Finkenwerder zeigt.
Die Leute können oft nicht unterscheiden zwischen den Uniformen der HADAG und der Polizei. Manchmal sagen sie sogar Kapitän zu mir. Das wird von meinen Kollegen natürlich so leicht belächelt. Aber die sind auch heilfroh, dass da einer ist, der hier freiwillig rüber geht, weil sie selber von der Mentalität her, von der Seefahrt, etwas wortkarg sind. Also: „Setz den Blümke hier mit der Barkasse ab und dann schnell wieder weg.”
Alle zwei Tage kommt die Englandfähre, und dann bin ich hier noch Passbeamter. Dazu kommt noch das Schiffahrts-Polizeiliche. Das Barkassenunglück mit der Martina vor einigen Jahren, bei dem es viele Tote gegeben hat, darunter auch Kinder, das wirkt sehr lange nach. Wir haben die Sicherheitsbestimmungen verschärft, aber es ist natürlich immer das Wirtschaftliche, was da im Wege ist, bis man das so durchgesetzt hat. Und wenn mit den Hafenrundfahrten viel Geld verdient wird bei schönem Wetter, dann entsteht natürlich oft so bei den Eigentümern die Neigung: „Ja, Gott, nimm man ruhig ’n paar mehr Leute in die Barkasse rein. Das ist ja bares Geld.” Ich muss überprüfen, ob das Rettungsmaterial tatsächlich erneuert worden ist oder nicht und ob derjenige, der die Barkasse fährt, wirklich dazu befugt ist.
Dann kommt noch dazu: Alkohol. Bei diesem warmen Wetter lockt die Flasche Bier auch so’n bisschen. Da hab ich mir das zur Regel gemacht, dass ich sämtliche Barkassenschipper selber ansprech und nutze die Nähe, um festzustellen, ob sie nach Alkohol riechen. Sollte ich da was feststellen, mach ich sie darauf aufmerksam: „Also, heute is ja wohl nicht!” Ich finde, es ist das Beste, dass man diese Leute auf dem Vorwege darauf aufmerksam macht. Ich versuche ihnen klar zu machen: „Eure Schädigung ist das, Leute!” Das ist natürlich immer etwas leichter, wenn man die Personen kennt. Also, ich kann wirklich sagen, dass ich alle hier auf den Landungsbrücken kenne. Das ist natürlich auch manchmal schmerzlich. Neulich ist ein junger Schiffsführer, der sich gerade erst selbständig gemacht hatte, ertrunken bei Brücke sechs. Und da vorne, an Brücke neun, ist er ’n paar Tage später wieder aufgetrieben. Ich musste ihn auffischen. Das war natürlich besonders traurig. 41 Jahre alt, ’n junger Kerl.
Grundsätzlich gilt für mich, dass ich allen Leuten immer offen gegenübertrete, dass ich ihnen nichts vormache.
Man kann nicht sagen: „Was macht das Geschäft?” Und in Wirklichkeit will ich nur riechen, ob er Alkohol getrunken hat.
Das muss man ihm sagen. Das ist ganz wichtig, dass man dem Bürger gegenüber nicht als Kontrahent auftritt und ihm das auch klarmacht. Es kommt hier zum Beispiel häufig vor, dass jemand mit einem Fahrrad rücksichtslos zwischen den Leuten durchrast, die hier spazierengehen, dass ich sag: „Nee, dem verpasst du ’n Denkzettel!” Aber ich mach dem auch klar, warum, und dass das seine Polizei ist, dass er die letzten Endes finanziert, mit dem Zweck, dass auch er geschützt wird. Ich frage denn auch, ob er auch ’ne Oma hat. So ein Oberschenkelhalsbruch kann für so einen alten Menschen doch das Ende bedeuten. Da kann auch die Endoklinik meist nichts mehr machen. Ich hab’s leider erlebt, dass so ein alter Mensch von einem Rad angefahren wurde, dalag und verletzt war. „Das heilt wieder”, sagen die Leute. Eben nicht! Und: „Die haben ja auch Augen im Kopf und können ausweichen!” Ja, aber die sind nicht mehr so beweglich! – Viele werden dann doch sehr nachdenklich, wenn ich ihnen das erkläre. Ich finde, das ist auch eine Aufgabe der Polizei, den Leuten das klarzumachen.
Ich hör hier aber auch sehr oft böse Worte über die Polizei. Wenn ich für die England-Fähre zum Beispiel weiträumig absperren muss und sage: „Würden Sie bitte weiter zurückgehen! Hier ist es gefährlich! Die Leinen können brechen!” Dann erleb ich, dass die Leute gegen ihre Polizei, die sie eigentlich beschützen soll, schimpfen: „Ist das alles, was Sie hier wollen? Uns hier wegjagen? Uns harmlose Bürger? Kümmern Sie sich doch um die Hafenstraße!” Das sagen die Leute ganz bitterböse. Da haben Sie was zu tun! Da können Sie absperren, und da können Sie wegschicken!
Das ist eine Sache, mit der alle Kollegen zu tun haben, weil die Leute das einfach nicht mehr verstehen. Die können’s nicht nachvollziehen, wenn hier einer verkehrt parkt, und fünf Minuten später ist einer von uns da und gibt ein Verwarngeld, und da drüben beobachten sie alle möglichen Verfehlungen in der Hafenstraße, die nicht geahndet werden.
Durch die Hafenstraße ist das Rechtsbewusstsein der Leute gestört. Dadurch haben sie das Vertrauen in ihre Polizei oft nicht mehr. Einmal wurde mir von einer älteren Dame gesagt: „Im Dritten Reich, da war ja vieles nicht richtig, aber das mit der Hafenstraße hätten die auf keinen Fall geduldet.”
Und dann meinte sie sogar noch: „’ne Bombe sollte man da reinschmeißen!”
Da hab ich der alten Dame gesagt: „Meine Güte, Sie sind doch bestimmt auch Mutter.” – „Ja, natürlich.” – „Denken Sie mal dran, dass da Mütter sind, die um ihre Kinder bangen, wenn man da ’ne Bombe rein werfen würde!” – „Meine Kinder nicht! Die würden bei so was nicht mitmachen!” Aber nachher wurde sie doch ganz nachdenklich. Und zuletzt sagte sie denn auch: „Wissen Sie, da hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Natürlich sind das ja alles Jugendliche, und eigentlich könnten sie einem ja leid tun.” Das ist ja auch genau der Punkt.
Ich hab früher auch gerne Polizisten geärgert, unsern Dorfgendarm. Toll war das. Aber es war doch in dem Moment vorbei, wenn der bei mir an der Tür stand und meinen Vater verlangte. Dann war Schluss. Dann gab’s was an’e Backen. Und das fehlt eben einfach da an der Hafenstraße.
Da muss einfach irgendwo der Punkt gesetzt werden. Da muss den Leuten klargemacht werden: „Wenn ihr in einer Gesellschaft leben wollt, dann geht das nur auf Gegenseitigkeit und nicht gegeneinander. Wer Freiheit beansprucht, der muss auch den anderen diese Freiheit lassen!” Und die politisch Verantwortlichen haben versäumt, denen das klarzumachen.
Man hätte doch ’n alternatives Wohnmodell machen können. Warum denn nicht? Aber es muss dann auch irgendwo eine Grenze gesetzt werden. Diese Grenze hat man einfach leichtsinnig überschreiten lassen. Mehr ist das eigentlich nicht. Und diesen Leuten, denen würd’s da blendend gehen, wenn sie diese Erfahrung mal machen würden. So geht’s auch bei meinem Sohn. Der fordert mich manchmal ganz schön raus, und ich muss höllisch aufpassen und sagen: „Bis hier und nicht weiter!” Aber dann geht’s ihm gut, denn er weiß, woran er sich halten kann.
Seute Deern
Landungsbrücken, März 1995
Kai Braun
Allroundkünstler, 25 Jahre
Ich denk, ich kann nichts in diesem Leben verlieren, weil Hauptsache, ich hab mich selber.
Mai 1989
Eben kam ’ne Band vorbei, . . .
... nicht ’n Spielmannszug mit Marschmusik, sondern richtig so Jazz mit Flair. Ich hab ’n paar Zettel runtergeworfen: „800 Jahre Hafenstraße”. ’n paar heben die auf. Manche sehn das aber gar nicht, wie viele Menschen eben halt. Sie gehn immer an was vorbei und denken so konsummäßig: „Möglichst viel kaufen”, nie selber irgendwie kreativ sein, weil die sich selber auch drücken. Das ist ja das Blöde, ne.
Die denken auch immer: „Was sagen andere Menschen dazu?”
Wenn ich das machen würde, was meine Eltern von mir wünschen, dann würde ich jetzt gar nicht hier sein, beziehungsweise würde an vielen Sachen auch vorbei gehn und wär mit ’n 40-Stunden-Job irgendwo in ’ner Firma. Für mich ist das Leben nur dann reizvoll, wenn ich von jedem immer ’n bisschen mal was aufnehmen kann. Nie das Gleiche machen, immer wieder was anderes. Man sagt ja eigentlich: „Der Mensch ist so’n Gewohnheitstier.” Aber dadurch verkalkt der auch, denk ich so, ne. Ich hab auf Sozialstation gearbeitet, nur mit alten Leuten zu tun gehabt. Und dann seh ich, die Menschen, die das ganze Leben irgendwie viel gemacht haben, lesen oder viel gereist sind, die sind selbst im hohen Alter, sind die echt fit drauf. Wenn jetzt ’n Mensch ’n ganzes Leben lang irgendwie industriemäßig gewesen ist, der ist dann nachher so drauf, möcht ich sagen, der raucht noch seine Zigaretten, aber mehr kommt da auch nicht rüber. Der ist zwar tierisch lieb, aber es kommt kein Einfall mehr. In unserer Gesellschaft ist das leider so. Da siegt immer die Ersatzbefriedigung.
Jetzt war ich vor einer Woche in Flensburg gewesen, zwei Tage, beim Freund so. Der wohnt an’er Förde. Schön am Strand spazieren gegangen, Meeresrauschen gehört. Ich war so was von entspannt! Man denkt ja immer: „Oh, dass ja nichts geklaut wird!” Aber meine Jacke hab ich einfach an’n Strand hingelegt, weil das tierisch warm war. Kam wieder, lag immer noch da.
Ich denk, ich kann nichts in diesem Leben verlieren, weil, Hauptsache, ich hab mich selber.
Den ganzen materiellen Scheiß, möcht ich mal so sagen, den brauche ich irgendwie gar nicht. Klar, ’n paar Sachen hab ich auch. Aber ich könnt mich von allen trennen.
Wollt mal auswandern vor drei, vier Jahren, nach Australien, und da hab ich das gelernt. Ich hatte ’ne Plattensammlung von drei bis vierhundert Scheiben und hab alle fürn Heiermann verkauft und teilweise auch verschenkt. Da sah ich auf einmal, wie einfach das alles geht. Meine Freunde haben gesagt: „Wenn du mal ’ne Kassette aufnehmen willst, kannst du.” Also da sieht man, wenn man was gibt, das bekommt man automatisch wieder. Das ist wie so ’ne Waage. Ich hab früher öfter mal was geklaut, und das wurde mir dann auch wieder geklaut. Jetzt bin ich auf’n fairen Ding, und jetzt geht das echt easy ab.
Hier auf’n Hafengeburtstag sieht man überall das Eingefahrene in unserer Gesellschaft. Immer, wo viel Werbung gemacht wird, da sind die Leute dann auch, anstatt mal andere Werte zu sehn. In mein Familienkreis sind zum Beispiel alle gegen die Hafenstraße. Ich bin eher so’n Reflexionsmensch und sag: „Warum seid ihr dagegen? Ihr schaut euch das ja nicht mal selber an!”
Ihr lest alle nur die Bild-Zeitung und seid völlig davon manipuliert unglücklicherweise.
Guck ich so meinen Verwandtenkreis an, auf Deutsch gesagt, da gibt es auch Arschlöcher. Aber es gibt eben auch viele liebe Leute. Die kann man jetzt nicht über einen Kamm scheren nach so’n Schubladensystem, um das einfach zu haben: das ist die Kategorie Menschen, und das ist die Kategorie Menschen. Aber die meisten sind immer voreingenommen. Ich hab zum Beispiel in’e Hafenstraße letztens gesehn, da kommen Leute aus Wandsbek vorbei, leicht angetrunken, und machen Randale. Das ist doch genauso, wie wenn jetzt zu meinen Eltern irgendwelche Leute kommen und machen da Randale auf’n Grundstück. Im Grunde genommen könnten sie ja ’n großen Zaun machen, dass nur die Leute reinkommen, die tatsächlich gut drauf sind. Aber tun sie nicht, um den Leuten zu zeigen: „Guckt euch das an, wie wir hier leben! Wir sind für jeden offen!” Und die Leute nutzen das so schamlos aus und machen noch Randale. Dadurch, dass andere Menschen ihre Aggressionen da ablassen, geht das wieder auf Kosten der Hafenstraße, dass die Leute sagen: „Die sind die Bösen!” Aber das ist eben halt unsere Gesellschaft. Ich hab das heute gar nicht mehr so drauf, mich soweit auseinanderzusetzen, dass das ’n Streitgespräch wird. Wenn ich seh, er ist festgefahren und hat so’n festes Bild, da muss ich mich gar nicht mehr mit dem Menschen abgeben. Ich sag zwar noch meinen Kommentar und: „Informier dich!” Aber ich sag nicht: „Eh, Alter, wie bist du denn drauf!” Dann wär ich ja genauso, wie er auch. Entweder hört er sich das an, oder er hört sich das nicht an. Und wenn er sich’s nicht anhören will, dann denk ich: „Okay, sein Ding.”
Hier gibt’s über 1000 Leute, da könnt ich überhaupt nicht mit ins Gespräch kommen.