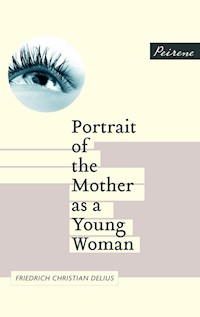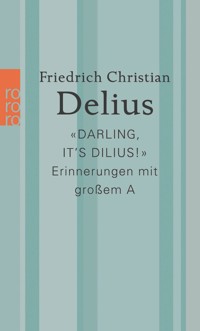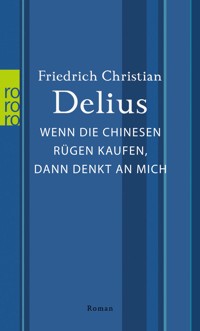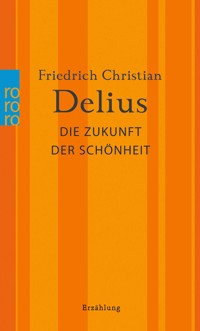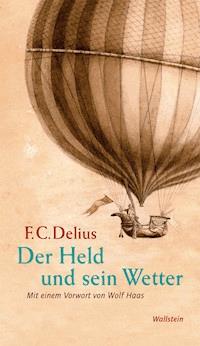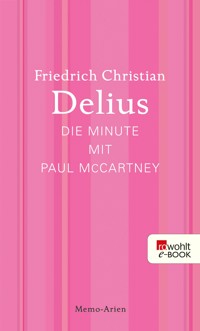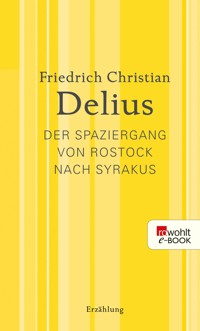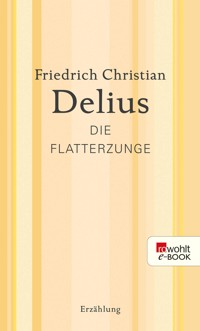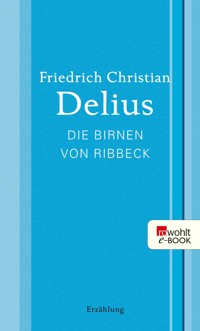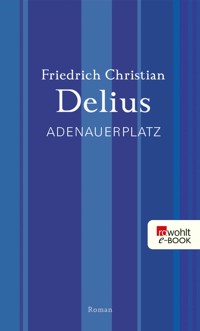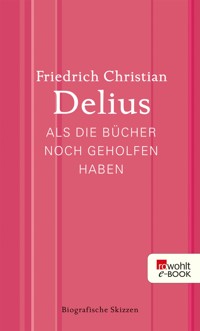9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von A (wie Achtundsechzig) bis Z (wie Zweifel) führt Friedrich Christian Delius' kleiner lexikalischer Leitfaden. Hier finden sich Antworten auf die drängenden Fragen der Gegenwart: Wo bleibt der Roman zur deutschen Einheit? Sind Steuerzahler Anarchisten? Wie wild wird der Westen? Wem nützt die Literatur? Warum Preußen? Wie funktioniert der Hitlertest? Wer war Helmut Horten? Einer der vielseitigsten deutschsprachigen Schriftsteller fügt vermischte Texte aus dreißig Jahren zu einem Wörterbuch ganz eigener Art – eine unterhaltsame literarisch-politische Zeitlese. Ganz nebenbei entsteht das Porträt einer Generation, die einst keinem über dreißig traute und heute mit Vergnügen sechzig wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Friedrich Christian Delius
Warum ich schon immer Recht hatte – und andere Irrtümer
Ein Leitfaden für deutsches Denken
Selbstporträt mit Schimpansen
Wenige Tage nach dem Ende der Schlacht von Stalingrad nicht weit vom Vatikan in das warme Frühlingslicht von Rom geboren, die Mutter eine milde Mecklenburgerin, der Vater ein westfälischer Pfarrer, zwischen hessischen Wäldern und Fachwerkhäusern, Bücherregalen und Fußballplatz Lesen und Schreiben gelernt und zugleich stotternd und stumm geworden – wo fängt es an, das Ich, das mit gelähmter Zunge zur Sprache drängt und im Alter von zehn Jahren mit der Schreibmaschine des gefürchteten Vaters sich einen «Weltplan» tippt? Und als «Beruf» angibt: Dichter.
Dies Rätsel habe ich auch in der Erzählung «Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde» nicht gelöst, und ich will es nicht lösen, denn es treibt mich voran. Wer schweigt und stottert, mag, im Idealfall, ein besonders glühender Liebhaber der Sprache sein. Widerspruch – erst gegen die Sprache der Väter und Götter, dann gegen die Sprachen der Floskeln, der Macht, der Ideologie. Sich am Schopf der eigenen Lyrik aus dem Sumpf ziehen – mit solchem Sublimationsgewinn läßt sich wuchern. Es zog mich ins Zentrum der deutschen Widersprüche, anderthalb Jahre nach dem Mauerbau. Aber was wäre Berlin gewesen ohne den Weg durch die Mauer, ich brauchte Gesprächspartner in beiden Berlins. Doch bei allem bescheidenen Größenwahn hätten wir uns nie vorgestellt, uns 30Jahre später in einer Akademie wiederzutreffen.
Der politische Schub von 1965, 1966, 1967, 1968 hat mich nicht gehindert, zehnmal mehr Jean Paul und Fontane zu lesen als Marx. Theorie war meine Sache nie, und der Höhepunkt meiner Studentenbewegung war eine Dissertation über «Der Held und sein Wetter». Eine Maxime von Friedrich Schlegel begleitet mich seit 1965: «Jeder Satz, jedes Buch, so sich nicht selbst widerspricht, ist unvollständig.»
Sie sehen, im Grunde wär ich gern ein Romantiker. Bin aber nun etikettiert als literarischer Chronist der Gegenwart, als politischer Autor gar, überdies geadelt von Literatur-Prozessen bis hoch zum Bundesgerichtshof. Ich staune manchmal darüber, eine gewisse politische Wachheit scheint offenbar nicht mehr selbstverständlich zu unserm Berufsbild zu gehören. In Deutschland steckt schnell in der sogenannt politischen Ecke, wer die Auswirkungen historischer Ereignisse auf die Gemütslage und das Verhalten von Subjekten und Figuren nicht vergißt, ja sogar poetisch mitdenkt. Als wäre nicht jede Liebesgeschichte mit gesellschaftlichen Banden beschwert. Zur Abwechslung der Schubladen würde ich gern einmal als heimatloser Heimatdichter wahrgenommen werden: Köln, Bielefeld, Wiesbaden, Ribbeck, Wehrda, Rostock, Hiddensee, Berlin hätte ich zu bieten.
Wo sind denn nun Ihre Wurzeln? Wie links oder rechts sind Sie denn? Wo ist Ihr Standpunkt? Ich fühle mich, obwohl Westmensch, als Einheitsgewinner und Gegner der Jammer-Fraktion. Das neue Jahrhundert hat bereits im Jahr 1989 begonnen. Warum ich trotzdem immer noch kein Zyniker bin, habe ich auf 99Seiten zu beantworten versucht. Der Meinungsmarkt schert mich weniger als Fakten, Fragen, Suche und der Humor, nachsichtig oder frech.
Wenn Sie mich zum Beispiel bei Feierlichkeiten, gerade bei akademischen, verhalten oder gar lächeln sehen, dann denke ich vielleicht daran, daß wir zu 98,6Prozent Schimpansen sind. 1,4Prozent Mensch, und was für ein unendlicher Raum der Freiheit, der Sprache, der Möglichkeiten!
Sie sehen hier einen Mann, den Sie, nach Akademie-Maßstäben, für verhältnismäßig jung halten werden. Bitte, vergessen Sie nicht, daß Sie einen Veteranen vor sich haben. Einen aus der letzten Generation, die noch ohne Fernsehbilder erzogen worden ist. Aus der Generation, die es so gut hatte wie keine vor ihr und so gut, wie es keine nach ihr haben wird, und die dies Privileg verdammt schlecht genutzt hat. Einen altmodischen Menschen, der die bewußtseinserweiternden Wirkungen von Sprache und Dichtung bei allen Zweifeln lieber überschätzt als unterschätzt. Und der heute immer noch wie der Zehnjährige davon träumt, ein Dichter zu sein.
Achtundsechzig
Die Bilder, Berichte und Dokumente aus alten Zeiten lügen nicht, aber sie lügen doch. Sie zeigen die Leute aus den ersten Reihen, die wildesten Gesichter, die nacktesten Kommunarden, die plakativsten Plakate, die unordentlichsten Wohnungen, die rotesten Fahnen, die spektakulärsten Aktionen. Zitiert werden die kämpferischsten Reden, das auffälligste Polit-Kauderwelsch, die euphorischen – und nicht die skeptischen Stimmen.
Zu diesem schlechten, aber mediengerechten Brauch gehört es, daß bei allen entsprechenden Jubiläumsfeierlichkeiten in unziemlich privilegierter Weise meistens solche Veteranen zu Wort kommen, die schon 1968Wortführer waren. Zeitzeugen, die sich im Kreise drehen und vor unsern Augen fossilieren, selbst wenn sie selbstkritisch Richtiges, Nachdenkenswertes sagen. Seit dreißig Jahren vermitteln sie das gleiche Bild: Wir haben den Durchblick.
Keine politische Bewegung ist so auf ihre eigenen Mythen und Klischees hereingefallen wie die 68er. Die meisten dieser Klischees sind sogar nicht einmal falsch. Trotzdem sage ich: Alles war anders, nämlich viel widersprüchlicher, mehrdeutiger, spielerischer.
Falls also zu 68 noch etwas Erhellendes zu sagen ist, dann wäre es vielleicht dies: von der Suche zu sprechen, der Suche auch nach der eigenen Nützlichkeit und dem Gebrauchswert eigenen Tuns, von der Ambivalenz und der Mehrschichtigkeit, die das hektische Leben wie das übereifrige Lernen bestimmten. Was heute uniform erscheint, war einmal Pluralität. Die 68er-Bewegungen, ich bestehe auf dem Plural, sind in sich sehr widersprüchlich gewesen, viel widersprüchlicher, als es selbst die besten Fotos von Michael Ruetz zeigen. Zu jeder These gab es eine Gegenthese. Synthesen waren verpönt, sie hätten schließlich die Ernsthaftigkeit unterminiert und wären versöhnlerisch gewesen. Jeder Ideologisierung folgte ein Gegenprogramm, das sich bald wieder ideologisch verengte und dann von einer neuen Gegenidee angegriffen wurde, die ihrerseits erstarrte, usw. Der Wettlauf auf den getippten, hektographierten oder gedruckten Papieren um das möglichst revolutionäre, möglichst allgemeingültige Ideengut mußte so ganz logisch entweder implodieren oder zum Stillstand kommen. Das sollten heutige Forscher, Betrachter, 68er-Hasser und Nostalgiker beachten: Wer immer sich Details, Bilder, Sätze, Thesen aus den Strömungen dieser großen Zirkulation herausfischt und die Gegenbilder, -sätze, -thesen wegläßt, wandelt auf dem bequemen Pfad der Legendenbildung.
Afrika → Obszönitäten des Alltags
Allgemeinplätze → Zersetzen
Amerikahaus → Studentenbewegung
Anarchisten
Die Avantgarde der deutschen Anarchisten sitzt nicht auf der Höhe, sondern vor der Höhe, in Bad Homburg. In der Stadt am Taunus leben viele Bürger, die beim Umgang mit Geld ein geschicktes Händchen haben. Hier gibt es die höchste Millionärsdichte und einen hohen Anteil von Spitzenverdienern vor allem aus der Frankfurter Finanzwelt.
Deshalb war die fiskalische Revolution der 90er Jahre hier zuerst zu beobachten. 1996 hat das Finanzamt Bad Homburg in der Endabrechnung keine Einkommensteuer-Einnahmen mehr verbuchen können, es mußte sogar 3020836Mark zurückerstatten. 1997 betrug das Minus 50Millionen.
Wer ab und an solche Statistiken liest, wird den Trend zum Minus nicht ganz überraschend finden. Seit Beginn der 90er Jahre haben sich die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen um etwa 50Prozent erhöht, die Zahl der Einkommensmillionäre ist ebenfalls um die Hälfte gestiegen, und die Zahl der Vermögensmillionäre hat die Million überschritten – gleichzeitig ist das Aufkommen aus der Einkommensteuer steiler abgestürzt als die japanischen Börsenkurse. Laut Statistischem Bundesamt von 1992 bis 1996Jahr um Jahr von 42Milliarden auf 33, auf 26, auf 14, auf 11Milliarden Mark.
Seit Theo Waigel mit der Sonderabschreibung Ost die größte Milchmädchenrechnung aller Zeiten erfunden und damit seinen Platz im Guinness-Buch der Rekorde gesichert hat, können die Finanzämter Vollzug melden. Diese fiskalische Revolution ist freilich dem Bundesfinanzminister nicht allein zuzuschreiben. Es ist eine gesamtgesellschaftliche, eine historische Leistung, die einen Moment der Würdigung und des Nachdenkens verdient. Früher, wir erinnern uns, waren Finanzämter dazu da, Steuern zu berechnen und einzutreiben. Heute bleibt ihnen nicht viel mehr als zu prüfen, ob alles mit rechten Dingen zugeht, wenn Verluste über Verluste gemacht werden. Und ob das Spiel der wohlhabenden Leute, nicht nur keine oder fast keine Steuer zu zahlen, sondern möglichst noch aus der Staatskasse belohnt zu werden, mit legalen oder halblegalen oder illegalen Regeln gewonnen wird. Aus den Finanzämtern, zumindest den Abteilungen für Einkommensteuer, sind virtuelle Goldgruben geworden.
Am Ende des Jahrhunderts sind wir nun so weit: Mit den direkten Steuern finanzieren, vereinfacht gesagt, nur die Angestellten und Arbeiter diesen Staat. Während der zahlungskräftige Teil der Bevölkerung, der von den heute selbstverständlichen Freiheiten am meisten profitiert, am wenigsten beisteuert und sich aus der Verantwortung für das Gemeinwohl verabschieden darf.
Unbeschränktes Privateigentum, schrankenlose Freiheit für den einzelnen, Beseitigung des Staates, das sind die Parolen der 90er Jahre – und es sind zugleich die Parolen des individualistischen Anarchismus des 19.Jahrhunderts. Neu ist nur: Der Staat lädt selbst zur Anarchie ein. Wir haben es heute mit einem staatlich geförderten Anarchismus zu tun, den man als Turbo-Anarchismus bezeichnen könnte.
Die Sucht, mit allen Mitteln Verluste auszuweisen, beschleunigt die Schulden-Katastrophe und führt zur Erosion des demokratischen Systems. Sie entspricht dem «kleinbürgerlichen Rückzug aus dem öffentlichen Leben», den Andrzej Szczypiorski an den Deutschen heute beobachtet. In der Mentalität der Verlust-Macher hat die Flucht vor der Verantwortung vielleicht nicht einmal den größten Anteil. Vielmehr mischt sich hier die Lust am Untergang mit der Lust an einer legalen und modernen Form kollektiver Anarchie. Der Wunsch, das menschliche Leben nur vom Willen und der Einsicht des einzelnen bestimmt sein zu lassen – da sind wir wieder beim naiven Glauben der frühen Anarchisten.
Das alles mag nur ein Nebenaspekt der großen Wende der 80er Jahre sein, als das betriebswirtschaftliche Denken über das volkswirtschaftliche siegte. Diese Entwicklung wird nicht aufzuhalten sein, auch nicht durch eine neue Regierung. Der Triumph der Shareholder und Verlustmacher über die Werte- und Verantwortungsträger ist marktwirtschaftlich konsequent und unumkehrbar, weil er die Dynamik eines immer besser legitimierbaren Egoismus auf seiner Seite hat.
Deshalb dürfte aber auch das emanzipatorische, staatskritische Element, das im Turbo-Anarchismus steckt, nicht zu einer neuen Bündelung konstruktiver Kräfte, zu einem neuen Gesellschaftsvertrag führen. Vielmehr fördert der Anarchismus von oben den Vandalismus von unten. Je reicher wir werden (privates, allein im Inland angelegtes Geldvermögen: 5,3Billionen Mark) und je mehr wir diesen Reichtum festzuhalten und zu vermehren suchen, desto mehr Verwahrlosung – im mangelhaft ausgestatteten Bildungswesen, in der Rechtspflege, der Jugendarbeit, der Kulturförderung usw., kurz, bei der Verteidigung der Zivilität unserer Gesellschaft.
Ist das «Sozialneid», ist das «kulturkritisch» oder «populistisch», wenn man sagt: Der Grund für die Verwahrlosung Deutschlands liegt im Reichtum der Deutschen?
Antisemitismus → Termine
Apartheid → Donnerstag, blauer
Arbeit ruiniert die Welt
FALK Also. Dieser Clausius hat im vorigen Jahrhundert den Entropiesatz entdeckt. Entropie ist die Summe der nicht mehr nutzbaren Energie. An der Wärmelehre exemplifiziert: Alle Energieumwandlung führt letztlich zu Wärme von niederer Temperatur, bis sie keine Arbeit mehr leisten kann. Die Menge der Energie bleibt erhalten, aber die Qualität der Energie verfällt mehr und mehr. So ähnlich. Der unumkehrbare Prozeß des Absinkens der Energiequalität führt dahin, daß am Ende das gesamte Geschehen im System Kosmos im sogenannten Wärmetod zum Stillstand kommt.
CASPAR Eine Physiker-Formel für den Untergang. Was hat das mit dem doppelten Europa zu tun?
FALK Alles. Denn es gibt ernsthafte Leute, die diese Formel aufs wirtschaftliche Wachstum beziehen.
CASPAR Wieso?
FALK Weil du anders den Konflikt zwischen Ökonomie und Ökologie nicht kapieren kannst.
CASPAR Eben Kosmos, jetzt Ökonomie und Ökologie. Kannst du nicht noch ein bißchen höher stapeln?
FALK Laß mich doch ein bißchen Honig ziehen aus dem, was ich lese.
CASPAR Und woher hast du den?
FALK Aus der «FAZ», Überschrift: Arbeit ruiniert die Welt, im Feuilleton. Baring zitiert zustimmend und besorgt einen Redakteur der «Süddeutschen», der in den «Gewerkschaftlichen Monatsheften» den Konflikt zwischen Ökonomie und Ökologie für nicht versöhnbar erklärt.
CASPAR Mit Hilfe eines Physikers aus dem 19.Jahrhundert.
FALK Hör erst mal zu. Die These, wenn ich das richtig behalten habe: Die für die Umwelt negativen Folgen der jeweiligen Wachstumsrate wären selbst dann noch größer als der durch den technischen Umweltschutz erzielbare Nutzen, wenn man die gesamte Wachstumsrate für technischen Umweltschutz ausgeben würde. Andersherum: bei begrenzten Ressourcen kein unendliches Wachstum, auch kein hundertprozentiges Recycling.
CASPAR Aber das Ideen-Recycling funktioniert wenigstens. Ein Physikersatz, durch soundsoviel Bücher und Zeitungen gejagt und bestimmt versimpelt, kommt am Ende, verallgemeinert für alles und jedes, bei der «FAZ» an und erschüttert dich!
FALK Lach nur!
CASPAR Und warum geht dir das nicht aus dem Kopf?
FALK Arbeit ruiniert die Welt.
CASPAR Mit Anführungsstrichen?
FALK In der Überschrift nicht.
CASPAR Wenn das die «FAZ» schreibt, werd ich mir das merken. Ein neuer Bürospruch. Ein schöner Satz, noch dazu beweiskräftig, eine Rehabilitierung der Schwätzer, der Nichtstuer, der Künstler… Reden als die effektivste Methode, das allgemeine Desaster aufzuhalten… Ich seh unsere Gespräche schon mit ganz anderen Augen. Irgendwie erinnert mich das dunkel an Mandevilles Bienenfabel. Da war auch so was mit… nein, ich krieg’s nicht hin, kann dir leider nicht mit Zitaten imponieren. – Aber wolltest du nicht auf Europa kommen?
FALK Der Niedergang der europäischen Planwirtschaft, der allgemein als Sieg der Marktwirtschaft gefeiert wird, beschleunigt den Niedergang der Marktwirtschaft, nach Clausius, nach…
CASPAR Den Niedergang! Daher weht der Wind! Endlich bewegt sich mal was zum Guten in Europa, endlich Freiheit für Millionen und etwas Aussicht für die Leute, aus der alten Scheiße rauszukommen, da fangt ihr schon wieder an mit den nächsten Katastrophen-Szenarios! Ich kann das nicht mehr hören! Die letzte schmuddelige Trumpfkarte von euch alten Kapitalismus-Kritikern, daß nun alles noch schlimmer wird! Guck dir den Dreck doch an, in dem sie vegetieren, wird doch höchste Zeit, daß das aufhört! Ich dachte, du wärst ein bißchen schlauer geworden in den letzten Jahren! Siehst du nicht, was los ist in Osteuropa, wo alles kracht? Endlich kracht, weil die Menschen vom alten System mehr als die Schnauze voll haben, nun laß ihnen doch in diesem Trümmerhaufen wenigstens die kleine Hoffnung auf den Markt, auf eine Besserung…
FALK Die laß ich ihnen doch, die sollen sie ja haben, sollen alles versuchen, was sie für richtig halten, um irgendwie Tritt zu fassen, aber…
CASPAR… dein ewiges Aber…
FALK Ich versuche nur, drei Schritte weiter zu denken.
CASPAR Damit du die Leute schon beim ersten entmutigst.
Ausländer → Dachdecker
Baader-Meinhof → Herbst, deutscher → RAF →Staat
Banalitäten → Gesellschaftsspiele, intellektuelle
Banken → Wunschzettel
Beamte → Wunschzettel
Berlin → Höllerer, Walter → Potsdamer Platz → Termine
Berlin-Brandenburg
Berlin-Brandenburg soll «Preußen» heißen? Als Aschermittwochsscherz sehr gelungen. Abgesehen von den hundert richtigen historischen und politischen Bedenken gegen ein Land Preußen: Unsere Gesellschaft hat absolut nichts Preußisches mehr, teils aus guten, teils aus schlechten Gründen. Die Brandenburger und Berliner müssten sich den Titel preußisch erst verdienen: durch Sparsamkeit, Gemeinsinn, Bescheidensinn, Toleranz gegenüber Fremden, Gefängnisstrafen für Landowsky und Partner. Alles preußische Utopien. Mein Vorschlag wäre: Versuchen wir mal, zehn Jahre lang im besten Sinne preußisch zu handeln, dann müssten wir unter anderem mindestens die Hälfte der Beamten entlassen, die Wirtschaftsordnung umkrempeln, die reichen Leute und die großen Firmen müssten wieder Steuern zahlen usw. Und nach zehn Jahren könnte man prüfen, ob wir den Namen verdienen.
Berliner Neujahrswunsch 96
Ich wünsche, daß die Banken dem Land Berlin sämtliche Schulden erlassen, 51,1Mrd DM, in Worten 51100Millionen, damit endlich wieder Politik gemacht werden kann in Berlin. Ich wünsche mehr Sänger in den U-Bahnen und S-Bahnen, manchmal auch im Oberdeck der Busse. Ich wünsche Berlin, daß es nicht zu sehr verschinkelt und auch der Heiterkeit der modernen Architektur Raum gibt. Ich wünsche eine offene Gedächtniskirche auch im Winter und eine Verwaltung, die pro Jahr 5% ihrer Vorschriften, Verordnungen und Durchführungsbestimmungen abschafft. Ich wünsche verständlichere Grafitti. Ich wünsche, daß der Potsdamer Platz im Sommer zum Baden freigegeben und später ein wirklicher Platz wird. Ich wünsche, daß mehr Ausländer zu Inländern werden oder sich wie Inländer willkommen fühlen. Ich wünsche, daß etwa ein Viertel aller Parteiköpfe und Politiker, die sich im Sozialbau ihrer Ämter und Pfründen eingenistet haben, eine Fehlbelegungsabgabe bzw. Fehlbesetzungsabgabe von 70% ihrer Bezüge an die Landeskasse zahlen. Ich wünsche mehr Licht in Lichtenberg, mehr Charlotten in Charlottenburg, mehr Rummel in Rummelsburg, mehr Hauptmänner in Köpenick und mehr Füchse in Reinickendorf. Ich wünsche Berlin viel weniger Arbeitslose und viel mehr Wohnungen. Ich wünsche, daß die gleiche Summe, die an Schmiergeldern gezahlt wird – man spricht von mindestens 20% der von der öffentlichen Hand vergebenen Bauaufträge – auch für Obdachlose gezahlt wird. Ich wünsche, daß alle, die in Kontaktanzeigen Kontaktpersonen suchen, rasch mit den gewünschten Kontakten befriedigt werden, und wünsche, daß die Schrittgeschwindigkeit in den verkehrsberuhigten Zonen eingehalten wird. Ich wünsche Berlin kein Schloß, aber einen Lustgarten, der seinem Namen Ehre macht. Ich wünsche, daß 30% mehr Rentner von ihren Fernsehschirmen loskommen und sich in den letzten Eckkneipen mit teetrinkenden Türken verbrüdern. Ich wünsche mehr Geduld mit dem Schienenersatzverkehr und staufreie Straßen mindestens zwischen Kollwitzplatz und Witzleben. Ich wünsche Berlin, daß die Herren an der Spitze der Verkehrsgemeinschaft Berlin-Brandenburg nicht nur betriebswirtschaftlich rechnen lernen, sondern auch volkswirtschaftlich. Ich wünsche einen lauteren Widerstand der Studenten gegen ihre staatlich verordnete Verschuldung und wünsche einer Schlüsselindustrie dieser Stadt, dem Buch- und Geisteshandel, eine Verdopplung der Umsätze. Ich wünsche eine 300prozentige Erhöhung der Hundesteuer, für Rentner meinetwegen nur 150%. Ich wünsche allen Bonnern, die nach Berlin kommen, an den Flughäfen und Bahnhöfen eine Art Sicherheitsschleuse oder Jungbrunnen, der ihnen etwas vom DIN-genormten Horizont und vom Gartenzwerg-Ordnungswahn elektronisch abwäscht. Ich wünsche weniger Taschendiebe. Ich wünsche mehr Arbeitsplätze in der Stadt und mehr Blumen im Umland zu den Arbeitsplätzen dazu. Auch wenn in Berlin längst jede der endlos vielen «Szenen» nach ihrer Façon selig zu werden trachtet, wünsche ich allen 97Berliner Szenen mehr Offenheit und Freiheit, über den eigenen Tellerrand hinwegzuschauen. Ich wünsche eine herzhafte Fusion zwischen Berlin und Brandenburg. Ich wünsche 7% mehr Heiterkeit in den Gesichtern und 11% mehr Liebespaare auf den Straßen und 4% mehr Richtfeste. Ich wünsche allen Beamten, daß sie den nichtverbeamteten Berlinern das Leben erleichtern und nicht erschweren. Ich wünsche, die Parteiköpfe begriffen, daß der Posten einer Kultursenatorin oder eines Kultursenators vielleicht nicht wichtiger ist als der des Wirtschaftssenators, aber doch wichtiger als der des Regierenden Bürgermeisters. Ich wünsche den Berlinern, daß sie ihre Stadt auch mal als eine große, lebendige Collage wahrnehmen können. Ich wünsche uns allen eine coole Hotline zu den alltäglichen lauwarmen Problemen. Ich wünsche allen 3,2Mio Berlinern mindestens 10% mehr Neugier auf Berlin und allen, urbi et orbi, eine gute Portion der Freundlichkeit und der Geduld von Heiner Müller. Ich wünsche, kurz gesagt, daß die Berliner den Reichtum ihrer Stadt erkennen und damit mehr anzufangen wissen.
Das wären einige meiner bescheidensten Neujahrswünsche, mit denen ich Berlin grüße und den Rest der Welt und, wie die jüngsten Hörer sagen würden, alle, die mich kennen.
Berlusconi, Silvio
«Es ist die Wut zur Vereinfachung», sagte ein Freund, als wir wenige Tage vor den italienischen Wahlen das Phänomen Berlusconi zu erklären versuchten. «Jahrzehntelang hatten die Leute hier ihre verwickelte Politik mit vielen Parteien und ständig wechselnden Koalitionen, jetzt wollen sie den starken Mann mit den einfachen Lösungen.»
Der Tag hätte schöner nicht sein können, ein sonniger Maienmorgen, und der Ort, an dem wir saßen, nicht prächtiger: auf einer Terrasse über den Dächern von Rom. Es räsonniert sich leicht, wenn der Blick weithin über Hügel und Kuppeln, über Bäume und Dachlandschaften schweifen darf.
Über unseren Köpfen brummte ein Flugzeug, das ein wehendes Werbeband mit dem Namen und der Partei jenes Mannes hinter sich herzog – selbst auf den Terrassen gab es kein Entkommen vor der medialen Allmacht des neuen Herrschers, der sich anschickte, in Rom die Macht zu ergreifen.
P., ein Sachverständiger der Politischen Ökonomie und Journalist, lieferte in der Maisonne die erste Erklärung, die mir sofort einleuchtete: Vereinfachungswut. Schon jeder kleine Politiker muss die Kunst der Vereinfachung (und der Wiederholung der immer gleichen Sätze) beherrschen, jeder Ideologe sowieso. Niemand kann sich zum Machthaber großen Stils aufschwingen, der nicht mit einem stark vereinfachten Weltbild antritt. Fließend sind die Grenzen zwischen Politik und Demagogie. Wer die Tricks und Finten der Vereinfachung am besten beherrscht, darf von der Karriere als Diktator träumen.
Auf der anderen Seite, beim Publikum, den Wählern, ist nichts begreiflicher als der Wunsch nach Vereinfachung. Der wird, überlegten wir, gewiss nicht allein vom Ärger über die da oben und vom Überdruss an Terrorismus, Korruption und Bürokratie gespeist. Das allgemeine Gefühl der Unsicherheit, die Erfahrung der ökonomischen Instabilität, das Verschwinden der gewohnten Bindungen und Werte, all das verschafft dem Vereinfacher fruchtbaren Boden. Immer unübersichtlicher, hässlicher und hektischer erscheint die Welt, von immer komplizierteren Interessen beherrscht, wer vermag da der Verlockung einfacher Botschaften zu widerstehen? Wenn Hoffnungen und Utopien verblasst, die Alternativen verwischt sind und nach dem Traum von Gerechtigkeit für alle nur noch der Traum von der herrlichen Ungerechtigkeit des Geldes und der Utopie des Börsengewinns Konjunktur haben, was wundert uns dann an dem Erfolg eines Marktschreiers? Tönt nicht aus allen Ecken das Echo seiner Sätze: «Der Markt macht frei, der Staat unfrei, Kritik ist Verrat, Gemeinsinn Quatsch?»