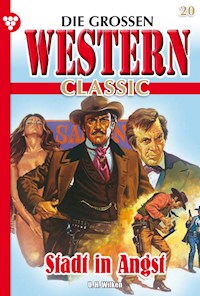3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Dein Tod ist mein Leben Kriminelle überfallen ein Lager der Walagumne-Indianer und richten ein Blutbad an. Das ist der Auftakt einer Serie von inszenierten Unruhen, die den in Kalifornien lebenden Mexikanern gelten. Dahinter steckt der einflussreiche Theodore McKenzie, der alle Mexikaner aus dem Land jagen und noch mehr Macht erringen will. Doch er hat nicht mit Zurdo gerechnet, der für die Rechte aller in Kalifornien lebenden Menschen kämpft. Ein Zuhause wie die Hölle In Kalifornien hat man Gold gefunden. Tausende von Abenteurern und Glücksrittern kommen ins Land, sie nehmen keine Rücksicht auf die dort lebenden Menschen. Die Gier nach Gold ist zu groß. Eine Bande ermordet die Goldsucher, um sie auszurauben. Zurdo nimmt die Verfolgung der Mörder auf. Die Printausgabe des Buches umfasst 276 Seiten. Die Exklusive Sammler-Ausgabe als Taschenbuch ist nur auf der Verlagsseite des Blitz-Verlages erhältlich!!!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Western Legenden
In dieser Reihe bisher erschienen
9001 Werner J. Egli Delgado, der Apache
9002 Alfred Wallon Keine Chance für Chato
9003 Mark L. Wood Die Gefangene der Apachen
9004 Werner J. Egli Wie Wölfe aus den Bergen
9005 Dietmar Kuegler Tombstone
9006 Werner J. Egli Der Pfad zum Sonnenaufgang
9007 Werner J. Egli Die Fährte zwischen Leben und Tod
9008 Werner J. Egli La Vengadora, die Rächerin
9009 Dietmar Kuegler Die Vigilanten von Montana
9010 Thomas Ostwald Blutiges Kansas
9011 R. S. Stone Der Marshal von Cow Springs
9012 Dietmar Kuegler Kriegstrommeln am Mohawk
9013 Andreas Zwengel Die spanische Expedition
9014 Andreas Zwengel Pakt der Rivalen
9015 Andreas Zwengel Schlechte Verlierer
9016 R. S. Stone Aufbruch der Verlorenen
9017 Dietmar Kuegler Der letzte Rebell
9018 R. S. Stone Walkers Rückkehr
9019 Leslie West Das Königreich im Michigansee
9020 R. S. Stone Die Hand am Colt
9021 Dietmar Kuegler San Pedro River
9022 Alex Mann Nur der Fluss war zwischen ihnen
9023 Dietmar Kuegler Alamo - Der Kampf um Texas
9024 Alfred Wallon Das Goliad-Massaker
9025 R. S. Stone Blutiger Winter
9026 R. S. Stone Der Damm von Baxter Ridge
9027 Alex Mann Dreitausend Rinder
9028 R. S. Stone Schwarzes Gold
9029 R. S. Stone Schmutziger Job
9030 Peter Dubina Bronco Canyon
9031 Alfred Wallon Butch Cassidy wird gejagt
9032 Alex Mann Die verlorene Patrouille
9033 Anton Serkalow Blaine Williams - Das Gesetz der Rache
9034 Alfred Wallon Kampf am Schienenstrang
9035 Alex Mann Mexico Marshal
9036 Alex Mann Der Rodeochampion
9037 R. S. Stone Vierzig Tage
9038 Alex Mann Die gejagten Zwei
9039 Peter Dubina Teufel der weißen Berge
9040 Peter Dubina Brennende Lager
9041 Peter Dubina Kampf bis zur letzten Patrone
9042 Dietmar Kuegler Der Scout und der General
9043 Alfred Wallon Der El-Paso-Salzkrieg
9044 Dietmar Kuegler Ein freier Mann
9045 Alex Mann Ein aufrechter Mann
9046 Peter Dubina Gefährliche Fracht
9047 Alex Mann Kalte Fährten
9048 Leslie West Ein Eden für Männer
9049 Alfred Wallon Tod in Montana
9050 Alfred Wallon Das Ende der Fährte
9051 Dietmar Kuegler Der sprechende Draht
9052 U. H. Wilken Blutige Rache
9053 Alex Mann Die fünfte Kugel
9054 Peter Dubina Racheschwur
9055 Craig Dawson Dunlay, der Menschenjäger
9056 U. H. Wilken Bete, Amigo!
9057 Alfred Wallon Missouri-Rebellen
9058 Alfred Wallon Terror der Gesetzlosen
9059 Dietmar Kuegler Kiowa Canyon
9060 Alfred Wallon Der lange Weg nach Texas
9061 Alfred Wallon Gesetz der Gewalt
9062 U. H. Wilken Dein Tod ist mein Leben
9063 G. Michael Hopf Der letzte Ritt
U. H. Wilken
Dein Tod ist mein Leben
ZURDO – Der schwarze GeisterreiterBand 3
Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2023 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-683-5
Dein Tod ist mein Leben
An diesem frühen Morgen des 4. April 1848 kam der gnadenlose Tod lautlos über die Sierra Nevada. Jäh verstummte das schaurige Heulen der Bergwölfe. Knurrend zogen sich die dürren struppigen Tiere hinter die Felsklippen zurück.
Schwerbewaffnete Desperados ritten über steinige Pfade und näherten sich dem Lager der Walagumne-Indianer.
Weiche Winde strichen vom fernen Pazifik herüber. Es sollte wieder ein schöner Tag in Kalifornien werden.
Noch lag die Dämmerung wie ein graues Leichentuch über den stillen Hütten der kalifornischen Indianer. Zwei abgemagerte Hunde erhoben sich aus dem kalten Staub und witterten in den feuchten Dunst.
Überall in diesem paradiesischen Kalifornien herrschte sonntäglicher Frieden. Aber es war die täuschende Stille eines trügerischen Friedens.
Kein Laut störte die Ruhe im Lager der Indianer. Nebelfetzen trieben um die Hütten. Tau tropfte von den Palmen am kleinen Fluss. Dunstschwaden stiegen über den Wassern empor.
Abseits des Lagers stiegen die schwerbewaffneten Männer von den Pferden. Der Morgendunst lag feucht auf den harten Gesichtern. Kalte Augen blickten auf die Hütten. Auf den Läufen der schweren Alston-Reiterpistolen perlte sich der Tau. Die Springfield- und Harpers-Ferry-Gewehre waren feuerbereit. Lederkappen schützten noch die Steinschlösser der Gewehre.
„Fertig?“, fragte ein grobgesichtiger Mann und verzog den Mund zu zynischem Lächeln.
Die anderen Männer nickten gleichmütig und kalt.
Für sie alle war Mord ein gutes Geschäft.
„Umstellt das Lager“, befahl der Anführer mit leiser, frostig klingender Stimme. „Lasst keinen entwischen.“
Man sollte sich seinen Namen merken, Mitch McKenzie. Er liebte die Gewalt und das Töten, und er war der Bruder eines machtbesessenen Politikers.
Fast geräuschlos schlichen sie auseinander. Derbe Stiefel rieben durch den Sand. Tücher waren um die Radsporen geschlungen worden und verhinderten das verräterische Klirren. Wie Schemen glitten die Banditen durch den Morgennebel.
Jetzt durchquerten sie den seichten Fluss. Leise gluckste das Wasser um die Beine. Keiner der Männer sprach. Sie gaben sich Zeichen und blieben auf Sichtweite zusammen.
Die beiden Hunde im Lager liefen um die Hütten und winselten.
*
In einer der Hütten erwachte ein Indianer. Langsam richtete er den Oberkörper auf und horchte.
Pablino hatte keinen Grund, an einen mörderischen Überfall zu denken. Seit vielen Jahren lebten er und seine Stammesbrüder friedlich mit den Mexikanern und Spaniern in Kalifornien zusammen. Sie alle waren Kalifornier und liebten die Fiestas, den Tanz und die fröhlichen Lieder.
Doch an diesem Morgen spürte Pablino Unruhe im Herzen. Er konnte es sich nicht erklären. Nichts deutete auf eine Gefahr hin. Doch die Hunde winselten, als fürchteten sie die Peitsche, und sie kratzten an der Tür seiner Hütte.
Er erhob sich und drückte die Tür zu einem Spalt auf. Die Lagerfeuer von gestern waren längst erloschen. Kalte Asche wehte über den Platz.
Winselnd kamen die Hunde herein und leckten an seinen Händen.
Seine Unruhe wuchs. Er hatte das Gefühl, als würden sich kalte Klauenhände um seinen Hals legen und ihn würgen.
Plötzlich entdeckte er eine verschwommene graue Gestalt im Dunst. Er sah das Gewehr in den Händen, und an der geduckten Haltung des Fremden erkannte er, dass jener Mann nicht in friedlicher Absicht kam.
Pablinos gellender Warnschrei riss die Indianer zu spät aus dem Schlaf. Er stürzte aus der Hütte hervor und schrie wieder, schnellte zurück und packte seine Machete.
Die Hölle brach herein.
Von allen Seiten rasten die Desperados heran und stürmten in die Hütten. Schon peitschten die ersten Schüsse auf. Der Knall stieß aus den Hütten und weckte ein verworrenes Echo im Tal.
Die Walagumne-Indianer wurden fast noch im Schlaf überrascht. In den Hütten geschahen furchtbare Dinge.
Als Pablino seine Behausung verlassen wollte, prallte er mit einem Fremden zusammen. Aufbrüllend wich der Desperado zurück. Das grobe Gesicht verzerrte sich vor Hass. Er drückte die Pistole ab, und das Blei fuhr Pablino in die Knochen.
Stöhnend wirbelte der Indianer zurück und stürzte rücklings auf die Decken und Felle am Boden.
„Hierher!“, schrie Mitch McKenzie draußen vor der Hütte.
Pablino rollte sich herum und kroch weg. Neben der Tür richtete er sich auf. Draußen keuchte ein Mann, trat gegen die Tür und kam herein. Mit letzter Kraft schlug Pablino zu. Die Machete traf den Desperado mit tödlicher Wucht. Enthauptet brach der Bandit zusammen. Taumelnd durchquerte Pablino die Hütte. Von draußen peitschte ein Schuss herein und traf ihn. Schwer prallte er gegen die Hüttenwand und fiel zuckend ins Dunkel.
Mitch McKenzie rannte weiter.
Todesschreie gellten aus den Hütten.
Pablino kroch an der Wand entlang und trat ein Loch hinein. Auf allen vieren verließ er die Hütte und schleppte sich hinter einen Strauch. Hier erschlaffte er, doch er verlor nicht das Bewusstsein. Der flammende Schmerz trieb ihm die Tränen in die Augen. Er sah zurück in das Lager und schloss den bebenden Mund. In seinen Augen flackerte es wie bei einem beginnenden Wahnsinn.
Er konnte nichts tun, nicht fliehen und auch nicht kämpfen. Er musste zusehen, wie die Fremden töteten, wie sie Männer, Frauen und Kinder erschossen und erschlugen. Sie wüteten schlimmer als die Teufel. Sie kannten kein Erbarmen, keine Menschlichkeit. Sie zertraten das letzte Leben unter ihren harten Stiefeln und warfen Feuer in die Hütten. Orangefarbene Flammen loderten, und noch immer herrschte Morgendämmerung.
Pablino weinte wie ein kleiner Junge.
Alles war schlimmer als der scheußlichste Albtraum.
Er verstand nicht, warum dies alles geschah. Er sah, wie die Fremden verschiedene Sachen im Lager ausstreuten, Dinge, wie sie Mexikaner trugen. Und er beobachtete, wie sie ihre eigenen Spuren verwischten.
Überall lagen entseelt Walagumne-Indianer herum. Keiner hatte das Massaker überlebt.
Die Fremden warfen ihre Gefallenen einfach in die brennenden Hütten hinein. Immer wieder erblickte Pablino diesen grobgesichtigen Anführer und hörte, wie die anderen seinen Namen riefen.
Pablino wäre in seiner Hütte verbrannt, hätte er nicht noch die Kraft gehabt, sich ins Freie zu retten.
Über den Bergen ging die Sonne auf. Die ersten hellen Strahlen fielen über die Schulter des Berges und trafen das brennende Lager im Tal. Rauchschwaden trieben im Morgenwind über den Fluss. Heisere Stimmen schallten durch das Tal. Verstummt war das grollende Echo der Schüsse, versickert waren die Todesschreie im Dunst.
Die Fremden liefen davon.
Wenig später wieherten weit abseits auf der steinigen Anhöhe mehrere Pferde, von Sporenstößen gepeinigt. Harte Hufe polterten davon. Hufeisen schlugen Funken. Die Reiter jagten in den erwachenden Tag hinein. An Lassos zerrten sie Sträucher hinter sich her. Das Geäst rutschte über die Spuren und verwischte die Hufeindrücke.
Pablino verlor das Bewusstsein.
*
Als er wieder zu sich kam, lag winselnd ein Hund neben ihm und leckte ihm die Wunden.
Feuer hatte die Hütten zerstört. Aus den Trümmerhaufen stieg noch Rauch in den Morgenhimmel empor. Hitze wehte zu Pablino herüber. Überall roch es nach Rauch und Tod.
Zitternd wälzte er sich auf die Seite. Er wollte sich erheben, doch ihm fehlte die Kraft dazu. Stöhnend sank er zurück und fiel mit dem Gesicht auf das versengte Fell des Hundes.
Plötzlich tönte helles Wiehern über das Tal.
Mühsam hob Pablino den Kopf an und blickte zum Höhenzug empor.
Er glaubte, eine Vision zu haben. Die Luft flimmerte bereits vor Hitze. Der Himmel war strahlend blau. Vom Pazifik wehte eine Brise herüber. Der Wind war in den Palmen. Rauch stieg in Spiralen aus den Aschenhaufen empor.
Wieder wieherte das schwarze Pferd auf dem Höhenzug.
Dort oben verhielt ein einsamer Reiter. Er war völlig schwarz gekleidet. Ein weiter Reiterumhang flatterte im Wind, und die Innenseite leuchtete blutrot in der Sonne.
Es musste eine Vision sein.
Stöhnend schloss Pablino die Augen.
Doch dann hörte er den Hufschlag des schwarzen Hengstes. Der Hund neben dem Indianer winselte heftiger. Pablino blickte wieder über das zerstörte Lager und über die Toten seines Stammes hinweg.
Der schwarze Reiter zog langsam durch das Tal.
Auf einmal zog er am Zügel und lauschte, hörte das Winseln des Hundes und kam dann näher.
Mit einem geschmeidigen Sprung war er vom Pferd und stand vor Pablino. Staub haftete an den weichen Lederstiefeln. Auch die schwarze Kleidung bestand aus Leder. Nur der Umhang war aus Tuch, das wie Samt glänzte.
Vor Pablino kniete er nieder. Lederhandschuhe bedeckten die Hände. Das Gesicht war nicht zu erkennen. Eine schwarze Maske machte es unkenntlich. Ein breiter dunkler Bart gab dem Gesicht einen verwegenen Ausdruck.
Die Stimme, die Pablinohörte, klang ganz ruhig und dunkel.
„Du wirst überleben, mein Freund.“
Pablino erschlaffte. Seine Lippen bewegten sich schwach. Seine Stimme war nur mehr ein Hauch. „Zurdo!“
„Ja, mein Freund“, sagte der geheimnisvolle Maskierte, richtete sich auf und stand reglos vor dem bewusstlosen Walagumne-Indianer. „Zurdo wird wieder reiten.“
*
Wolkenfetzen trieben am bleichen Mond vorbei. Am Talrand kläfften Kojoten. Raunend strich der Nachtwind über die halb zerfallenen Mauern der Hazienda de los Toros im Sacramento-Tal.
Nur wenige Vaqueros saßen fernab am Lagerfeuer und bewachten die Rinder und Stiere im Tal. Wimmernd fing sich der Wind zwischen den Stangen der Corrals am Rincon de los Toros. Hier am Winkel der Stiere endete der Besitz der Monterreys.
Der Haziendero Ricardo Monterrey war schon lange tot, ermordet. Seine Frau war nach Spanien gereist. Ihr gemeinsamer Sohn, Miguel Monterrey, war im fernen Mexiko verschollen, so hieß es jedenfalls.
Nun verwaltete der Nachbar Mark Oliver Shane den Besitz der Monterreys. Er machte seine Sache gut.
Auf der Hazienda war es still.
Im altspanischen Herrenhaus war es dunkel. In einem der Zimmer schlief die blutjunge Guadalupe. In der Unterkunft der Vaqueros waren alle Schlafstellen leer. Die Männer wachten draußen im Tal. Im Küchenhaus schlief der Chinesenkoch Mosquito.
Ein junger Indio lag im Pferdestall und lauschte dem Nachtwind und dem Gekläffe der Kojoten.
Chato war stumm, doch er konnte den Wind verstehen, die Mutter aller Stimmen. Langsam schälte er sich aus der Decke und verließ den Stall. Einsam stand er auf dem großen Hof der Hazienda und blickte suchend umher.
Der Wind rauschte in den Olivenbäumen. Die Schatten der Wolkenfetzen wanderten durch das weite Tal. Sternenlicht erhellte plötzlich einen schwarzen maskierten Reiter am Talrand.
Als Chato ihn erblickte, schillerten Tränen in seinen Augen. Er konnte Zurdo nicht rufen. Doch er winkte ihm zu und öffnete den Mund zu einem lautlosen Ruf.
Nur Chato wusste, dass Miguel Monterrey noch lebte, dass er dort oben am Talrand als der gefürchtete Zurdo verhielt.
Zurdo hatte viele Feinde in Kalifornien. Überall wurde der Reiter mit der schwarzen Maske gesucht, doch die alten Kalifornier verehrten ihn und würden ihr Leben für ihn hergeben. Seitdem die Fremden aus dem Osten über die Sierra Nevada gekommen waren, hingen überall Steckbriefe aus. Zurdo wurde gesucht. Eine hohe Kopfprämie wurde dem gezahlt, der Zurdo niederschoss.
Am Talrand hob Zurdo die linke Hand. Er gab dem Indio Chato ein Zeichen. Chato hastete sofort in den Stall zurück, holte ein ungesatteltes Pferd hervor und jagte durch das Tal.
Dicht neben Zurdo riss er am Zügel.
Zurdo lächelte ernst. Die weißen Zähne blitzten unter der schwarzen Augenmaske.
„Nicht weinen, Chato. Du wirst dort hinter den Felsklippen den Indianer Pablino finden. Bring ihn auf die Hazienda und mach ihn gesund. Das Lager der Walagumnes wurde von Fremden überfallen und niedergemacht. Es waren Banditen aus dem Osten. Sie haben vor den niedergebrannten Hütten Spuren hinterlassen, um den Verdacht auf Mexikaner zu lenken. Pablino hat einen Namen gehört, Mitch McKenzie. Ich muss diesen Halunken finden. Adios, Chato.“
Schon raste Zurdo davon. Der Umhang flatterte im Reitwind. Der trommelnde Hufschlag verlor sich in der Nacht.
*
In den Vorgärten der kleinen Stadt Chico standen Palmen und Blütensträucher. Der Duft der Blumen wehte durch ein geöffnetes Fenster in den Salonraum des großen weißen Hauses.
Zwei Gläser stießen klingend aneinander. Die beiden Männer tranken und setzten die Gläser ab. Sie ließen sich in den tiefen weichen Sesseln nieder und rauchten Zigarren.
„Habt ihr wirklich alle Spuren fein säuberlich verwischt, Mitch?“, erkundigte sich der blassgesichtige Mann und drehte die Zigarre zwischen den Fingern.
„Natürlich, Bruder“, antwortete Mitch McKenzie lächelnd und paffte. „Man wird Mexikaner für den Überfall verantwortlich machen und überall suchen, und viele Kalifornier werden die Mexikaner zu hassen beginnen. So willst du es doch haben.“
„Ja.“ Theodore McKenzie füllte die Gläser. „Politik ist manchmal ein schmutziges Geschäft, Mitch. Natürlich standen die Walagumne-Indianer mir nicht im Weg. Doch dieses Massaker wird den ganzen Hass auf die verdammten Mexikaner lenken. Es gibt noch so manche Mexikaner in Kalifornien, die einflussreiche Posten haben. Man wird sie bald von ihren Sesseln jagen und davontreiben. Kalifornien gehört schon bald den Amerikanern, und wer hier als erster hart durchgreift, der wird so etwas wie ein König von California werden.“
„Und das willst du werden, Bruderherz, nicht wahr?“, Mitch McKenzie lächelte kalt. „Ich verstehe nichts von Politik. Du wirst mich nicht vergessen, wenn du ein mächtiger Mann geworden bist?“
„Natürlich nicht. Du wirst Polizeichef werden. Von Chico bis nach Sacramento ist es nicht allzu weit. Sacramento ist die Hauptstadt. Dort beginnt die Macht.“
„Du willst wirklich hoch hinaus, Bruderherz.“
„Sag nicht immer Bruderherz, verdammt! Ich will das nicht hören. Hoffentlich hast du alles genauso getan, wie ich es dir gesagt habe.“
„Sicher. Meine Leute sind in den Bergen. Wir halten Verbindung miteinander. Ich habe mich hier in Chico in der Cantina einquartiert. Dorthin kommen arme Leute. Niemand wird mich dort vermuten. Du kannst ganz beruhigt sein.“
„Well, dann trink jetzt das Glas aus und verschwinde. Nimm den Hinterausgang. Man braucht dich hier auf dem Grundstück nicht zu sehen.“
„Hast du etwa Angst, Bruder?“
„Unsinn. Ich bin nur vorsichtig. Es darf nichts schiefgehen, verstanden?“
„Das wird es auch nicht. Dafür bin ich ja da.“
Mitch McKenzie trank den Whisky, stand auf und verließ lächelnd den Salon. Er trat aus der Hintertür des Hauses und durchquerte den großen Ziergarten. Quietschend schloss sich hinter ihm das schmiedeeiserne Gartentor.
Lässig schlenderte er zurück und folgte der Straße. An diesem Abend begegnete ihm kein Mensch. Er blieb vor der Cantina stehen, warf die Zigarre zu Boden und zertrat die Glut.
Plötzlich fühlte er sich beobachtet. Er drehte sich um und blickte lauernd umher. Lichtbahnen fielen auf die Straße. Weit hinten trieb ein alter Kalifornier ein paar Maultiere über die Straße. Gegenüber der Cantina kauerte ein junger Mann in einer Hofeinfahrt. Ein alter, zerschlissener Poncho hing mürbe von den Schultern. Das Gesicht war in der Abenddämmerung nicht zu erkennen.
„Verdammt, ich werde schon nervös“, flüsterte Mitch McKenzie vor sich hin. „Wer sollte mich schon suchen? Kein Schwein weiß was davon.“
Langsam betrat er die Cantina.
*
Der junge Mann auf der anderen Straßenseite richtete sich auf und warf den Poncho weg. Er klopfte sich den Staub aus der einfachen Kleidung und überquerte die Straße. Einen Atemzug lang blieb er in der Lichtbahn der Cantina stehen, dann drückte er die Schwingtür auf und ging in den verräucherten Gastraum.
An einem Tisch in der Nähe der Tür ließ er sich nieder. Talglichter flackerten. Kalifornier saßen an den Tischen und tranken. Kastagnetten klapperten, und zwei Männer schlugen die Saiten ihrer Gitarren. Eine junge Mexikanerin tanzte auf einer kleinen Bühne. Ihr dunkles Gesicht glühte vor Anstrengung und Leidenschaft. Der weibliche Körper zuckte im Rhythmus der Musik.
Der junge Mann beobachtete das tanzende Mädchen und schien sich für nichts anderes zu interessieren.
Mitch McKenzie stand an der Theke und drehte sich um. Er blickte zum jungen Mann hinüber, doch er erkannte ihn nicht wieder, denn der Poncho fehlte. Auch hatte der junge Mann ein offenes und sympathisches Gesicht. Er trug wie viele andere auch einen Oberlippenbart. Das Gesicht war von der Sonne Kaliforniens gebräunt. Die dunkelbraunen Augen leuchteten im Schein der Talglichter voller Lebensfreude.
McKenzie wandte sich wieder dem Tresen zu, trank und ging dann nach hinten auf sein Zimmer.
Das Lächeln des jungen Mannes erlosch. Heftig schlugen die Kastagnetten. Das Mädchen wirbelte über die kleine Bühne und stand jäh still, sank in sich zusammen und wartete, bis das letzte Geldstück auf die Bühne geworfen war, sammelte dann das Geld ein und verschwand.
Niemand erkannte den jungen Mann. Er machte einen unscheinbaren Eindruck. Vielleicht war er einer der vielen jungen Kalifornier, die in diesen Tagen ziellos umherzogen und nicht glauben wollten, dass Gold auf dem Grund und Boden des Captain John A. Sutter entdeckt worden war.
Geduldig wartete er, bis die Bedienung an den Tisch kam. Er bestellte ein Glas Wein und sah das Mädchen lächelnd an.
„Señorita, ich möchte Sie etwas fragen.“
„Fragen Sie, Senor.“
„Haben Sie den Amerikaner gesehen, der noch eben an der Theke stand?“
„Si, Senor. Das ist Senor McKenzie.“
„Gracias, Señorita. Wissen Sie, dass Sie sehr schön sind?“
Das Mädchen errötete, lachte leise auf und eilte davon. Es brachte ihm das Glas Wein und blickte dann öfters zu ihm hin. Er trank genüsslich, zahlte und ging dann.
Es war Nacht geworden in der kleinen Stadt Chico.
Hinter den Häusern, verborgen im Schlagschatten eines halb zerfallenen Stalls, stand ein schwarzes Pferd. Der junge Mann erreichte den Hengst und entledigte sich der ärmlichen Kleidung. Alle seine Bewegungen waren schnell und sicher.
Matt schimmerte die weiche Lederkleidung im Sternenlicht. Sorgfältig rückte er die lederne schwarze Maske zurecht. Das Gesicht, das so viel Freundlichkeit ausgestrahlt hatte, verhärtete sich wie zu Stein. Die weichen Züge verloren sich, und in den braunen Augen erschien ein kalter Glanz.
Mit einem kraftvollen Sprung war er im Sattel des schwarzen Hengstes. Schon ritt er an und näherte sich der Cantina.
Dumpf schlugen die Hufe über die Straße.
Der Umhang umgab den schwarzen Reiter. Der flache schwarze Reiterhut warf einen Schatten auf das maskierte Gesicht. Unter dem Umhang steckten der Toledo-Stoßdegen und die Schusswaffe. Am Sattelhorn hing eine zusammengerollte Peitsche. Verborgen im Nacken des Reiters steckte ein Wurfmesser.
*
In der Cantina lachten die Mädchen und die männlichen Gäste. Die Gitarren erklangen. Musik sollte die Schwermütigkeit der Kalifornier verbannen.
Mirch McKenzie war zurückgekommen und stand wieder an der Theke.
Draußen verstummte das Hufgetrappel.
Plötzlich wurde es still in der Cantina.
McKenzie hörte ein Mädchen flüstern. Es war auf einmal kalt um ihn herum. Er starrte in den Spiegel hinter der Theke, doch er konnte die Tür nicht erkennen.
Radsporen klingelten an der Tür. Sie hörten sich an wie fernes Kirchengeläut. Jetzt verstummte auch das Sporengerassel. Der Atem des Todes wehte in die Cantina. Die Türflügel schwangen leise knarrend auf und zu und standen dann still.
Steif drehte Mitch McKenzie sich um.
Vor ihm an der Tür wartete ein Maskierter. Alles an ihm war schwarz. Die Augen funkelten eiskalt in den Sehschlitzen der Larvenmaske. Der Blick brannte auf McKenzies Gesicht.
In diesen Sekunden begriff Mitch McKenzie, dass der Tod zu ihm gekommen war. Es gab kein Entrinnen. Seine einzige Chance war der Kampf. Er trug eine Alston und war auch entschlossen, sie zu benutzen, doch der Anblick des Unheimlichen lähmte auch ihn in den ersten Sekunden. Ein Raunen ging durch die Cantina.
„Zurdo …“
Kaliforniens Geisterreiter war nach Chico gekommen!
Kein Muskel in Zurdos Gesicht erschlaffte. Im trüben Lichtschein wirkte das Gesicht noch härter und kantiger.
McKenzie verkrampfte sich. Langsam senkte er die Hände. Die Rechte öffnete sich krallenförmig.
„Zurdo?“
Seine Stimme klang wie splitterndes Glas. Sie verriet die wilde Entschlossenheit, um das eigene Leben zu kämpfen und Zurdos Leben auszulöschen.
„Ja, Mitch McKenzie“, antwortete Zurdo klanglos und dennoch furchtbar kalt. „Dein Weg ist zu Ende. Die Seelen von über zwanzig erschlagenen und erschossenen Walagumne-Indianer schreien zum Himmel. Du, McKenzie, wirst heute Nacht zur Hölle fahren. Bete, wenn du das noch kannst. Es wird dein letztes Gebet sein.“
Keiner der Anwesenden rührte sich.
Doch in den Augen so manchen Mannes und Mädchens leuchtete es auf. Zurdo lebte. Er war schon oft totgesagt worden. Er schien unsterblich zu sein. Die Legenden waren wahr.
Mitch McKenzie suchte die Chance. Zurdos rechte Hand war zu sehen. Er hielt keine Waffe in der Hand.
Es musste McKenzie gelingen, Zurdo über den Haufen zu schießen. Der geheimnisvolle Maskierte konnte unmöglich mit der Rechten so schnell unter den Umhang greifen und die Waffe packen.
Bösartiges Lächeln erschien auf McKenzies Gesicht. Er hörte die Atemzüge der Menschen in der Cantina und wusste, dass gleich zwei seiner Komplizen nach Chico kommen würden.
Er musste etwas Zeit gewinnen und Zurdo hinhalten.
Draußen schnaubte der schwarze Hengst.
„Worauf wartest du, McKenzie?“, fragte Zurdo ruhig. „Erhoffst du dir Hilfe von deinen Komplizen? Ich würde mich freuen, wenn sie kämen. Dann brauche ich sie nicht erst zu suchen. Sie sind irgendwo in den Bergen, nicht wahr?“
„Ja, du verdammter Hund“, gab McKenzie zu. „Aber ich brauche nicht die Hilfe meiner Freunde. Ich mache dich hier kalt.“
„Dann greif zur Waffe, McKenzie!“
„Ich will dich Hundesohn noch für kurze Zeit lebendig sehen. Ich frage mich während der ganzen Zeit, wie du mich gefunden haben kannst. Natürlich ist das, was du gesagt hast, nicht wahr. Ich kenne keine Walagumne-Indianer.“
„Das Leugnen nützt dir nichts, McKenzie. Die Kalifornier glauben mir. Zurdo hat noch niemals gelogen.“
„Warum nennt man dich Dreckskerl eigentlich Zurdo?“, fauchte McKenzie.
„Du verstehst die alte Sprache in Kalifornien nicht, McKenzie? Sie zu lernen, ist für dich auch zu spät. Warum zögerst du? Im Lager der Indianer hast du nicht gezögert. Du hast mörderisch gewütet. Sogar die Kinder sind erschlagen worden.“
„Dieser Hund lügt!“, behauptete McKenzie heiser. „Glaubt ihm nicht! Holt meine Freunde! Ich gebe euch zehn Dollar. Lauft, Amigos!“
Keiner bewegte sich.
Am Ende der Straße klapperten die Hufe von Pferden.
Zurdo wollte McKenzie nicht gnadenlos niederschießen. Auch dieser Halunke sollte eine Chance haben. Darum täuschte Zurdo ihn, drehte sich halb herum und tat so, als horchte er hinaus.
In dieser Sekunde packte McKenzie die Alston und wollte sie hochreißen. Er starrte in Zurdos Augen. Noch immer nicht rührte Zurdo die rechte Hand. Doch als McKenzie abdrücken wollte, kam Zurdos linke Hand unter dem Umhang hervor. Ein Flammenblitz zuckte durch die verräucherte Cantina. Das Blei traf McKenzie und riss ihn von den Beinen. Leblos lag er vor der Theke. Pulverrauch umhüllte Zurdo. Langsam ging er an den Toten heran. Mit der Spitze des Degens zeichnete er ein Z auf die Stirn des leblosen Banditen.
Wie ein Spuk verschwand er aus der Cantina, lief über den Gehsteig und sprang auf sein bereitstehendes Pferd. Der Hengst raste aus dem Stand los.
Schüsse peitschten über die Straße. Mündungsfeuer flammten vor den Reitern auf.
Der Hengst zuckte zusammen und wieherte schrill, hetzte an den Häusern vorbei und trug Zurdo über die Hinterhöfe.
Die Nacht warf ihren schwarzen Mantel über den Geisterreiter. Wolkenschatten huschten über die Stadt hinweg. Bewaffnete Männer stürmten in die Cantina.
Gebrochene Augen glotzten sie an.
Sie warfen sich herum und verließen die Cantina, sprangen auf die Pferde und ritten suchend aus der Stadt.
Wenig später stießen sie auf Zurdos Spur.
Unterwegs luden sie die Waffen. Die Spur führte in scheinbar unwegsames Gelände. Auf dem Felsboden verlor sich die Spur der Hufe.
Doch als die Banditen mehrere Kreise ritten, entdeckten sie Blutstropfen. Es war dunkles Pferdeblut.
„Wir zwei allein schaffen ihn nicht“, krächzte einer der Reiter. „Du reitest zu den anderen in die Berge. Ich folge dieser Spur, aber ich will keinen Kampf, verstehst du? Wenn ich weiß, wohin er reitet, dann komme ich nach. McKenzie hat irgendeinen Mann in Chico getroffen. Dieser Mann ist unser Auftraggeber. Irgendwann wird er uns in den Bergen finden. Los, hau ab.“
Sie trennten sich.
Vorsichtig folgte der Bandit der Blutspur nach Norden.
*
Auf einer windigen Anhöhe hielt Zurdo an. Erst jetzt hatte er entdeckt, dass der Hengst von einem Streifschuss getroffen worden war. Die ganze Flanke war blutrot. Das Tier schnaubte und prustete vor Schmerzen.
„Wir müssen zum Fluss hinunter“, sagte Zurdo leise. „Dort werden wir rasten.“
Er ritt weiter. Noch in dieser Nacht erreichte er den Fluss. Auf der anderen Seite stieg er ab und kümmerte sich um die Wunde. Hier nahm er auch die Maske vom Gesicht.
Von dem Verfolger war nichts zu sehen.
Zurdo glaubte auch, nicht mehr verfolgt zu werden.
Eine halbe Stunde später ritt er langsam im Fluss entlang und näherte sich dem Besitz des Ranchers Mark Oliver Shane. Im Morgengrauen ritt er vorbei und sah das Ranchhaus im Dunst. Er verließ den Fluss und verschwand zwischen den Hügeln.
Weit hinter ihm zügelte der Bandit das Pferd und blickte zur Shane-Ranch hinüber. Nach einiger Zeit zog er das Pferd herum und ritt der aufsteigenden Sonne entgegen.
An diesem Morgen wurde Mitch McKenzie auf dem alten Friedhof von Chico begraben. Der Bruder, Theodore McKenzie, blieb dem Grab fern.
Er wollte sich nicht als Bruder des Toten zu erkennen geben.
*
Trübe flackerte die Lampe im alten Pferdestall der Hazienda de los Toros. Der Abendwind raschelte in den Ziersträuchern des Gartens. Einst hatten viele geladene Gäste auf der Hazienda große Feste gefeiert. Jetzt lagen die Terrassen verlassen da. Niemand wandelte mehr im großen Garten. Die glanzvolle kalifornische Epoche war vorbei. Verklungen waren die kastilischen Lieder.
Wie träumend saß der Indio Chato im Stall und blickte zum offenen Tor hinaus. Auf einmal richtete er sich geschmeidig auf und verließ den Stall, betrat die Unterkunft der Vaqueros und trat an das Lager des Walagumne-Indianers heran.
Pablino hatte Fieber. Mit unendlicher Geduld hatte Chato sich um ihn gekümmert und ihn verbunden. Die Lippen des Fiebernden bewegten sich, aber die Worte waren nicht zu verstehen.
Chato hörte ein Geräusch, drehte sich halb herum und sah, wie der Chinese Mosquito hereinkam. Stilles, ernstes Lächeln lag auf dem asiatischen Gesicht.
„Du viel für ihn getan haben, Chato“, sagte er. „Pablino dein Freund werden.“
Chato zuckte mit den Schultern. Forschend betrachtete er das graue, schweißnasse und eingefallene Gesicht des Indianers.
Plötzlich war Hufschlag zu hören. Drei Vaqueros kehrten aus dem Tal zurück und saßen vor dem Pferdestall ab. Mit rasselnden Sporen kamen sie heran, traten ein und blieben überrascht stehen.
Ein junges Halbblut näherte sich dem Lager des Indianers. Fragend blickte er Chato und Mosquito an.
„Chato ihn hergebracht haben“, erklärte Mosquito. „Er ihn gefunden am Talrand. Indianer heißen Pablino.“
„Si“, sagte Manuelito und betrachtete den Schwerverwundeten. „Er ist ein Walagumne. Chato, wie hast du ihn gefunden?“
Chato machte mehrere Zeichen. Er wollte mit Manuelito und Mosquito erst im Pferdestall darüber sprechen. Die anderen Männer sollten nichts erfahren. Langsam verließ er die Unterkunft.
Im Stall setzte er sich auf einen alten Sattel und wartete. Nach kurzer Zeit kamen der Chinese und das Halbblut herein.
Manuelitos braune Augen flackerten, als er Chato ansah.
„Du hast uns was zu sagen, was sehr wichtig ist, Chato?“
Der junge Indio nickte. Wieder bewegte er die Hände, und Manuelito übersetzte die Zeichensprache. „Ihr wisst, wer unter der Maske des Zurdo ritt. Don Miguel Monterrey ist in Mexiko verschollen, er ist tot. Es gibt jetzt einen anderen Zurdo. Er reitet für Don Miguel weiter. Er hat Pablino an den Talrand gebracht.“
Schweigend standen Manuelito und Mosquito im Stall. Das junge Halbblut atmete schwer ein und nickte.
„Bueno, Chato, ich habe alles richtig verstanden. Es ist gut, dass es einen zweiten Zurdo gibt. Aber woher weiß dieser Zurdo, dass Don Miguel der Geisterreiter war?“
Chato zuckte erneut mit den Schultern und bewegte die Hände.
„Ich weiß es nicht“, sprach Manuelito nach Chatos Zeichen. „Vielleicht hat Don Miguel mit diesem Zurdo gesprochen, früher schon.“
„Unser Patron ist tot“, seufzte der Chinese Mosquito. „Aber sein Schatten lebt weiter für Kalifornien.“
Der Indio machte mit der flachen Hand eine sanfte Bewegung zum Stalltor hin. Er wollte allein sein. Langsam schritten Manuelito und Mosquito hinaus. Sie beide hatten das Geheimnis des Zurdo gekannt. Sie ahnten nicht, dass der wahre Zurdo lebte und sie jetzt von ihrem Eid befreite. Doch sie würden auch jetzt niemals verraten, dass der junge Monterrey der überall gesuchte Zurdo gewesen war.
Zurdo verdichtete damit das Geheimnis um seine Person. Chato konnte nicht sprechen, und nur Manuelito verstand die Sprache seiner Hände.
*
Zusammengesunken saß Chato allein im Stall.