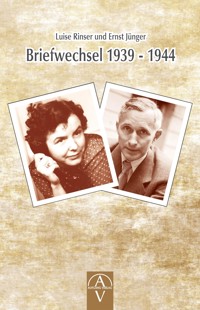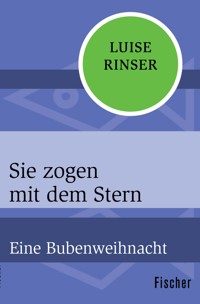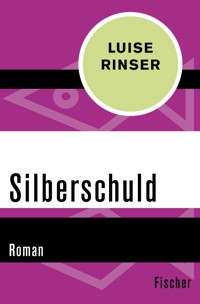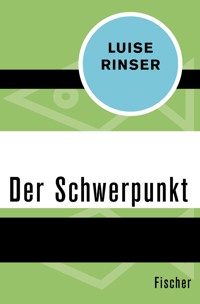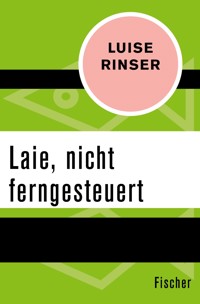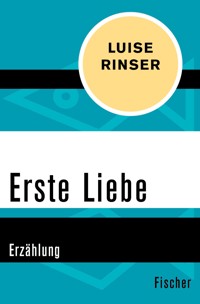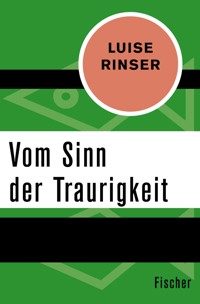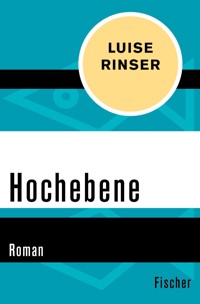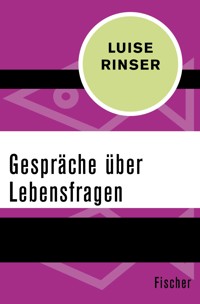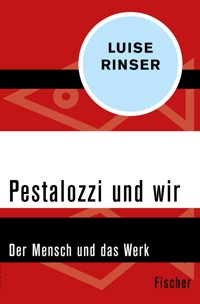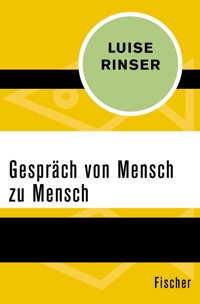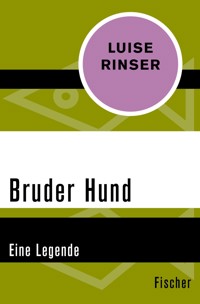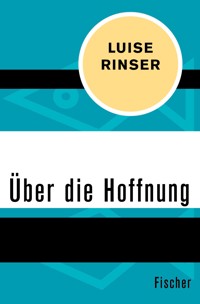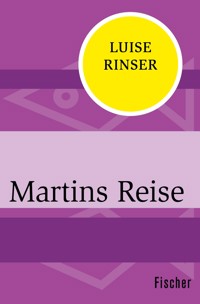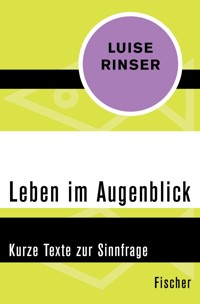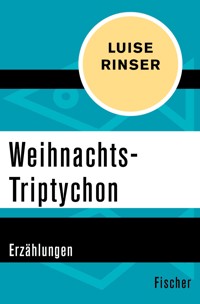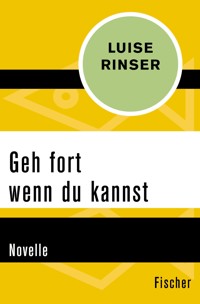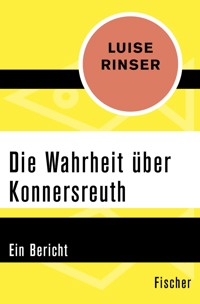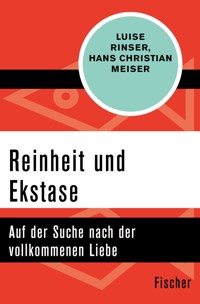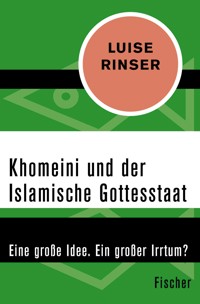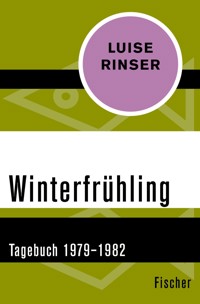
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Luise Rinsers vierter tagebuchartiger Band nach ›Baustelle‹, ›Grenzübergänge‹ und ›Kriegsspielzeug‹. Ansichten zum Tagesgeschehen und Überzeitliches. Kritische Eindrücke von Reisen durch Bolivien, nach Polen mit dem Papst, nach Japan und Nordkorea. Begegnungen, Erkenntnisse, Impressionen. Aufzeichnungen einer beharrlichen, leidenschaftlichen, manchmal verzweifelten Frau und Schriftstellerin, die durch ihre Liebe zum Leben, zum Menschen getragen wurde. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Luise Rinser
Winterfrühling
Tagebuch 1979–1982
Über dieses Buch
Luise Rinsers vierter tagebuchartiger Band nach ›Baustelle‹, ›Grenzübergänge‹ und ›Kriegsspielzeug‹. Ansichten zum Tagesgeschehen und Überzeitliches. Kritische Eindrücke von Reisen durch Bolivien, nach Polen mit dem Papst, nach Japan und Nordkorea. Begegnungen, Erkenntnisse, Impressionen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Luise Rinser, 1911 in Pitzling in Oberbayern geboren, war eine der meistgelesenen und bedeutendsten deutschen Autorinnen nicht nur der Nachkriegszeit. Ihr erstes Buch, ›Die gläsernen Ringe‹, erschien 1941 bei S. Fischer. 1946 folgte ›Gefängnistagebuch‹, 1948 die Erzählung ›Jan Lobel aus Warschau‹. Danach die beiden Nina-Romane ›Mitte des Lebens‹ und ›Abenteuer der Tugend‹. Waches und aktives Interesse an menschlichen Schicksalen wie an politischen Ereignissen prägen vor allem ihre Tagebuchaufzeichnungen. 1981 erschien der erste Band der Autobiographie, ›Den Wolf umarmen‹. Spätere Romane: ›Der schwarze Esel‹ (1974), ›Mirjam‹ (1983), ›Silberschuld‹ (1987) und ›Abaelards Liebe‹ (1991). Der zweite Band der Autobiographie, ›Saturn auf der Sonne‹, erschien 1994. Luise Rinser erhielt zahlreiche Preise. Sie ist 2002 in München gestorben.
Impressum
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Erschienen bei FISCHER Digital
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Copyright © by Christoph Rinser
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München
Covergestaltung: buxdesign, München
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-561210-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
1979. Kapitel
1980. Kapitel
1981. Kapitel
1982. Kapitel
1979
Nicht für die Ewigkeit geschrieben. Viele meiner Leser beklagen, daß ich meine Kraft vergeude beim Schreiben von Tagebüchern. Bisweilen denke ich selbst, ich sollte den Rest meines Lebens darauf verwenden, meine »eigentliche« Arbeit zu tun: Erzählungen schreiben und Romane und auch Stücke. Ich habe viele Einfälle im Kopf, einige tragende Entwürfe sogar schon auf dem Papier, von einem Roman habe ich bereits siebzig Seiten geschrieben. Warum mache ich denn die Zeit nehmende Arbeit des Tagebuchschreibens? Weil auch dies zu meiner »eigentlichen« Arbeit gehört. Weil es eine Art ist, mit Menschen zu sprechen und zu leben. Weil ich in der Tagebuchform unmittelbar mit ihnen kommunizieren kann. Weil die Leser gerade der Tagebücher mir in Tausenden von Briefen sagen, was sie denken über das, was ich denke. Weil ich aus ihren Briefen erfahre, wie man heute lebt als Student, als Strafgefangener, als Hausfrau, als Bundestagsabgeordneter, als Fließbandarbeiterin, als Bundeswehrsoldat, als Schüler, als Theologe, als DDR-Bürger, kurzum: als Mensch von heute. Kommunikation, das ist mein Leben. Was kümmerts mich, was später aus meinen Büchern wird, ob noch einer sie liest, falls noch einer lebt. Auf Ruhm und Nachruhm pfeife ich. Hier und jetzt will ich leben und gelesen werden. Hier und jetzt will ich mich verschwenden. Ich werfe mit meinen Einfällen um mich, ich verstreue sie auf dem Marktplatz. Was wert ist, gefunden zu werden, wird gefunden werden. Was keiner brauchen kann, das wird der Zeitenwind verwehen.
Bolivien. Warum eigentlich habe ich diese Einladung angenommen? Ein fremder Leser, Deutscher, ehemals Geschäftsmann in La Paz, der mich zwei Jahre lang beharrlich einlud. Jetzt sitze ich da in einem Luxus-Bungalow. Noch habe ich den Schock des plötzlichen Höhenunterschieds nicht ganz überwunden: der Flughafen liegt viertausend Meter hoch. La Paz liegt im Taltrichter, ich befinde mich schätzungsweise dreitausendfünfhundert Meter hoch, höher als die Zugspitze, der höchste Berg, auf dem ich je gestanden habe. Gestern früh war mir so elend, daß man mir die Sauerstoffmaske brachte. Und wer sie mir brachte! Ich hatte die Hausfrau in der Nacht der Ankunft nicht gesehen; der Hausherr, Herr X, hatte mich abgeholt am Flughafen. Er ist so sympathisch wie seine Briefe. Die Frau: ehemals Deutsche auch sie, Amerikanerin geworden, eine eisige Schönheit, die mich haßt, das ist sofort zu spüren. Aber warum? Ich bedanke mich für die Einladung. Sie sagt scharf: ICH habe sie nicht eingeladen.
Das ist der Empfang. Soll ich abreisen, in ein Hotel ziehen? Ich bin noch zu angegriffen, um mich zu irgend etwas entschließen zu können. Ich schaue aus den Fenstern. Vor mir der neuangelegte Garten. Ein Indio arbeitet. Auf dem Rasen stelzen rosabeinige Flamingos herum. Auf dem Nachbargrundstück baut einer der Söhne des Herrn X da ein großes Haus. Herr X hat eine Menge Kinder aus erster Ehe, aus der zweiten keines. Das schafft Probleme, scheint mir.
Hinter dem Haus eine seltsame Gebirgslandschaft. In der Nacht meiner Ankunft schien mir, als liege dort oben eine Stadt, ich sah deutlich einen gotischen Dom und hohe Türme und Mauern mit Zinnen. Es ist nichts als zerklüfteter Sandstein, von der Erosion ausgewaschen. Phantastisch.
Das Indiomädchen holt mich zum Frühstück. Herr X freut sich, daß es mir schon wieder gut geht.
Das Haus ist wunderbar, wenn man Luxus mag. Überall stehen Silbersachen, schön gearbeitete, alte Stücke. Das ist spanische Arbeit.
Herr X sagt: Bolivien war reich an Silber und Gold.
Ja, sage ich, das war einmal.
Herr X nimmt mich mit nach La Paz hinunter. Da hat er sein Geschäft, ein Warenhaus, voll von Kram. Wer kauft das Zeug? Diese kitschigen Lampenschirme, die billigen Kühlschränke, den Blech- und Glasschmuck, das schlecht gearbeitete Kochgeschirr? Die Reichen kaufen das nicht. Wer also? Die Indios. Für die Indios also die Ausschußware. Und brauchen sie derlei? Man redet es ihnen ein. Man lockte sie an mit diesem Kram. Sie kaufen. Im ›Spiegel‹ las ich einmal: »Bolivien fest in deutscher Hand«. Herr X arbeitet nicht mehr im Betrieb, das wird mir klar, er kommt aber täglich in sein Büro, liest und schreibt ein paar Privatbriefe, begrüßt seinen Sohn, der jetzt der Leiter ist und der, das muß mir auffallen, recht unfreundlich zu seinem Vater und noch unfreundlicher zu mir ist. Ungut ist das alles.
Herr X hat mir in seinen Briefen viele Male von den »Islas Verdes« erzählt: seinem Versuch, den Indios zu helfen, die sich selber nicht helfen können oder nicht mehr helfen wollen nach so langer Zeit der Unterdrückung und Ausbeutung durch Spanien, die USA, die BRD.
Wir fahren auf den Altiplano. Grenzenlose baumlose Hochebene. Wir fahren auf verwachsenen alten Wagenspuren oder einfach quer über Steppenland mit fast ausgetrockneten Flußbetten. Hie und da an den Boden geduckt Indiohütten. Kein Dorf. Wir sehen die Reste einer Inka-Tempelanlage: das Sonnentor, Tiahuanaco. Die Sonne brennt herunter, von den Anden her streicht ein kalter Wind. Die uralten Mauern aus einer reichen Zeit, in denen große Götter verehrt wurden. Und daneben ein Indiodorf, das einzige, das wir sehen auf der Ebene. Ein armes Dorf.
In der Nähe treffen wir bei einem Halt eine Frau mit ein paar Schafen. Ein ganz junges ist dabei. Ich möchte es streicheln. Um Gottes willen, nicht, sagt Herr X, das hat schon einmal eine Europäerin getan, mein Gast, und es gab eine Hexenjagd. Warum? Weil es dem Tier Unglück bringt, von einem Fremden berührt zu werden. Es hat den Indios immer Unglück gebracht, mit Europäern in Berührung zu kommen. Einmal waren die Indios reich und mächtig, da kamen die Spanier und nahmen ihnen alles weg: ihr Gold, ihr Silber, ihr Ebenholz und ihre Menschenwürde. Jetzt wissen sie kaum mehr, wer sie sind. »Identitätsverlust«.
Herr X will ihnen Gutes tun, nicht mit Almosen und auch nicht mit staatlicher »Entwicklungshilfe«, sondern konkret mit seinem eigenen Geld und mit seinem eigenen Einsatz an Liebe. Er hat seit langem den Plan, da oben auf der Hochebene, in Yanamuyo, ein Indiodorf zu gründen. Bis jetzt stehen da ein paar Häuser, ein Kirchlein und ein großer Stall für die Schweinezucht. Die Schweine sind mager. Es ist zu kalt für sie auf viertausend Meter Höhe. Und Kartoffeln und Getreide, womit sie gefüttert werden, wachsen auch schlecht da oben. Warum nützt man die Sonnenenergie nicht? Warum wendet man die Ergebnisse der Versuchsfarm nicht an, die wir sahen bei La Paz? Da hat man doch gelernt, Sorten zu pflanzen, die den schroffen Wechsel von Tageshitze und Nachtfrost ertragen. Und was man in Sibirien kann, das muß man doch auch hier können, oder? Das Problem liegt nicht da. Das Problem sind die Indios selbst. Sie wollen nicht arbeiten, nicht in der Landwirtschaft, sie gehen, wie überall auf unserer Erde, lieber in die Fabriken, in die wenigen Städte, da arbeiten sie stumpf vor sich hin und haben keine Verantwortung. Oder sie machen Heimarbeit, vergeben von ausländischen Firmen, oder sie arbeiten in den Häusern der Reichen als Dienstboten, da haben sie ein sicheres Leben. Außerdem trinken sie. Ihre Gesichter sind wie die von Schlafwandlern. Ihre Intelligenz ist eingeschlafen, und niemand weckt sie, denn es wäre gefährlich für die herrschende Klasse, wenn die Indios begriffen, daß sie Sklaven sind, ausgebeutet von Ausländern und den mit Ausländern versippten einheimischen Reichen.
Die Indios sind mißtrauisch, wenn ein Weißer ihnen etwas Gutes tun will, sie wittern es, daß man Geschäfte machen will auf ihre Kosten. Herr X will das nicht, er nicht, er hat nur Verluste bis jetzt, und er weiß, daß er nie einen Gewinn für sich herauswirtschaftet. Er hat ein großes Stück Land da oben gekauft, ein Europäer hat es ihm verkauft, ehe es der Bodenreform anheimfiel, die vor einiger Zeit unter einem vorübergehenden sozialistischen Regime stattfand. Herr X schenkte das Land den Indios, einer Kooperative, und begann mit ihr zu arbeiten. Rodung, Düngung, Umzäunung, Bau einiger Häuser, der Anfang des geplanten Runddorfes. Im Verwaltungsgebäude sehe ich den Plan, er ist sinnvoll.
Warum eigentlich macht Herr X das? Er ist doch Geschäftsmann, und so einer macht doch nichts Unrentables!? Seine Frau und die Kinder aus erster Ehe halten ihn für verrückt. Sie wollten ihn entmündigen lassen. Sie brachten ihn in eine Nervenheilanstalt. Da schrieb er an alle Wände »Islas Verdes«, Grüne Inseln, Inseln der Hoffnung. Man ließ ihn wieder heraus, aber man hält ihn weiter für einen Wahnsinnigen, der sein Geld sinnlos vergeudet an diese Indios, diese Untermenschen. Die Kämpfe mit seiner Familie haben Herrn X einen Herzinfarkt eingebracht. Und jetzt begreife ich den Haß seiner Frau mir gegenüber: sie sieht in mir eine Bundesgenossin des Wahnsinnigen. Recht hat sie: ich bin auf seiner Seite. Er ist ein Sozialist im Kapitalistenpelz. Er hat ein schlechtes Gewissen, das ein so gutes ist, daß ich ihn dafür liebe. Er und seine Sippe haben schon viel Geld herausgeholt aus diesem Land und in Europa in Sicherheit gebracht, für den Fall einer jederzeit möglichen Revolution. Jetzt aber, für den Rest seines Lebens, will Herr X das gutmachen an den Indios, soweit er kann. Warum hat er mich so beharrlich eingeladen? Jetzt verstehe ich: er will, daß ich darüber schreibe. Ich verstehe: das ist nicht nur ein Akt der Selbstbestätigung und sublimer Eitelkeit, das ist wirklich ein Zeichen, ein Aufruf an andre. Eine machtlose Stimme in der Welt des brutalen Kapitalismus. Man belächelt den Mann, aber man hat ihn gern. Ein Don Quijote, sagen die Deutschen von La Paz. Seine Frau mag man nicht, sie ist die typische nordamerikanische Reiche. »Ich bin sehr beschäftigt«, sagt sie zu mir. »Am Montag ist Bridgeclub, am Dienstag Konzert, am Mittwoch Treffen der Nordamerikanerinnen, am Donnerstag Reiten, am Freitag Einkaufen, am Samstag literarischer Zirkel …« Sie spricht für viele ihresgleichen.
Wir machen eine Fahrt über Land, auf der ganz neuen Autostraße von La Paz zur Peruanischen Grenze. Unser Ziel: der Titicacasee. Den gibt es also wirklich! Natürlich sah ich ihn auf der Landkarte gezeichnet, aber das ist ein andrer See als der, den ich seit meiner Schulzeit im Sinne habe; der liegt auf jener Landkarte, auf der magische Orte verzeichnet sind, solche, die es nur in der Phantasie gibt. Was für ein zauberisch fremder Klang: Titicacasee. In den Indianergeschichten las ich, daß es dort Schilfboote gibt, ganz ohne Holz und Nägel gemacht, wirklich nur aus Schilf geflochten, wasserdicht, sicher und schön. Und jetzt stehe ich also an diesem See und er ist so zauberisch wie in meiner Kinderphantasie. Da liegt er kobaltblau zwischen flachen grünen Schilfufern unter einem unermeßlich großen blauen Himmel. Regungslos das Wasser. Stille, die man hört. Und da sind also die Schilfboote. Es ist seltsam, wenn es einmal glückt, eine lang und still gehegte Vorstellung mit der äußern Wirklichkeit zur Deckung zu bringen. Groß ist dieser See. Daß nur ein sehr kleiner Teil zu Bolivien gehört, der größere zu Perú, das ist mir gleichgültig. Ich sehe keine Grenze. Die Ufer dehnen sich weit hinaus. Grenzenlos.
Schon längere Zeit, während ich so am Ufer sitze, fühle ich eine Unruhe in der unbewegten Luft. Plötzlich höre ich etwas, eine Art Musik, scheint mir, aber es ist, als klinge die Landschaft, als kämen Töne aus der Erde. Was ist das? Heute ist Allerseelen, sagt Herr X, das feiern die Indios auf ihre Art, Sie werden sehen. Die Musik kommt näher, jetzt unterscheide ich den dumpfen Klang einer großen Trommel, den hellern scharfen einer kleinen, und die schrillen Töne kleiner Flöten. Da kommen sie den Hügel herunter, eine ganze Prozession von Indios in Feiertagstracht, die Frauen mit ihren steifen runden schwarzen Hüten und ihren weiten bunten Röcken, die Männer in ihren Ponchos. Sie ziehen auf einen kleinen Friedhof zu, der vor einer längst verlassenen Kirche liegt. Über den Grabhügeln sind Zelte aus Zuckerrohr errichtet. An Stangen hängen Girlanden von Zwiebeln und Orangen; die kommen aus dem Südosten, aus dem Regenwaldgebiet, der tropischen Zone, dort, wo der deutsche Pater Augustin haust, der mich eingeladen hat dorthin. Aber daraus wird nichts, sagt Herr X, denn dort ist um diese Zeit immer das Fieber, es sind die Ratten, die die Krankheit übertragen, sie kommen aus dem Urwald, wenn die Indios die Speisen für die Toten auf die Gräber legen. Hier sind noch keine Ratten, nur Hunde und Kinder, die sich ihren Anteil an den Totenopfern holen. Die Indiofrauen mit ihren weiten Röcken hocken wie Gluckhennen zwischen den Gräbern. Die Musik geht weiter, aufreizend monoton, immer nur ein paar Klänge, immer der gleiche Rhythmus, man wird betäubt davon, als hätte man getrunken. Die Indios trinken ihren selbstgebrauten Zuckerrohrschnaps, es ist Fusel, sehr stark und gefährlich, und er macht aus den stumpfen Indios aggressive Wilde. Gehen wir, sagt Frau X, die Angst hat vor ihnen. Gehen wir, die schauen schon zu uns her, sagt sie. In der Tat: sie schauen her, und ich bilde mir ein, sie überlegen, wen von diesen drei Europäern, diesen unbefugten Zeugen uralter Riten, sie den Göttern opfern sollen. Gehen wir, sagt auch Herr X, wenn sie betrunken sind, werden sie wirklich gefährlich. Wir fahren also weiter. Aber die Musik verfolgt uns, sie vervielfacht sich: überallher kommen nun solche Prozessionen mit ihrer eigenen Musik, die Landschaft ist voll von diesen dumpfen und schrillen Tönen. Unendliche Wiederholung. Es ist immer eine Familie, ein Clan, der da auf seinen Friedhof pilgert. Diese kleinen Friedhöfe sieht man sonst nicht, sie sind versteckt in Erdmulden, aber jetzt erkennt man, wo sie liegen, denn dort ist plötzlich ameisenhafte Bewegung.
Diese Musik, warum greift sie einen so an? Herr X sagt, das ist eine alte Inkaweise, der Ruf der Sehnsucht nach den alten Göttern, die dem Volk einst so großes Glück gewährten, ehe die Spanier kamen mit ihren Priestern, ihrem fremden Gott, ihren fremden Waffen, da zogen die alten großen Götter fort, die Armut kam, und sie blieb. Aber eines Tages kehren die alten Götter zurück, die wahren Götter … Diese Musik ist Beschwörung und heißes Gebet.
Auf halbem Weg nach La Paz kommt uns mitten auf der Autostraße so eine Prozession entgegen, schon aufgelöst, schwer betrunken, alle taumeln und tanzen torkelnd zur wildgewordenen Musik, an der Spitze tanzt einer, der ein gebratenes Schwein an einem Stock über der Schulter trägt. Im Tanzen trinken sie weiter. Herr X fährt an den Straßenrand, er hat Angst. In diesem Zustand, sagt er, sind sie zu allem fähig. Aber sie ziehen vorbei, ohne Notiz von uns zu nehmen.
In La Paz sehen wir von der oberen Straße aus einen kleinen Friedhof, wir schauen von oben hinein. Ein Anblick wie nach der Auferstehung der Toten: leere Grüfte, zerborstene Grabsteine, zerwühlte Gräber. Dazwischen die Indios, ganze Familien, die dort auf den Gräbern ihr Essen ausbreiten für die Toten und die Lebenden. Gespenstermahl.
Plötzlich schäme ich mich, hier zu stehen, europäisch nüchterne Beobachterin, Eindringling, Angehörige jener Religion, die hier mit finsterm Fanatismus das schöne Alte zerstört hat. Diese armseligen Gestalten da unten, diese Armut, diese Erniedrigung eines einst so starken stolzen Volks, das alles haben WIR auf dem Gewissen, wir christlichen Europäer. Mein Gott, was wir alles verdrängen müssen, um überhaupt noch leben zu können.
Ich bin umgezogen zum deutschen evangelischen Pastor Dümchen, ich ertrug einfach den Luxus im Hause X nicht mehr. Herr X ist traurig, aber er versteht mich. Die Dümchens haben ein hübsches Pfarrhaus, aber es ist brechend voller Menschen: das Ehepaar und drei eigene Kinder, dazu zwei Indiokinder, die sie vorm Hungertod gerettet hatten, dazu ein Vietnamkind, dazu Teresa, eine Einheimische mit ihren beiden unehelichen Kindern, und die alte Köchin. Und nun noch ich. Aber da ist immer ein Platz übrig. Es geht sehr einfach zu, aber friedlich und heiter. Das ist ein Modell für ein Pfarrhaus, für ein christliches Haus. Und es geht gar nicht fromm zu, nur Tisch- und Abendgebet werden eingehalten, aber zwanglos. Wer nicht mitbeten und mitsingen will, muß still sein und respektieren, was die andern tun. Am Abend kommen Gäste: ein deutscher Entwicklungshelfer, der auf eigene Faust und eigene Kosten arbeitet, und die Leiterin von Amnesty International, eine Spanierin, die schon im Gefängnis war, sie erzählt mir von den tapferen Frauen der Bergarbeiter, und sie sagt auch: Sie müssen nach Miljuni fahren, zu den Zinnbergwerken.
Ein Ausflug also mit dem Ehepaar Dümchen, Herrn X und seinem Aymara-Chauffeur. Ein Ausflug … So beginnt die Fahrt: wir fahren bergauf, immerzu bergauf. Dann sind wir auf der Hochebene, viertausend Meter hoch. Die Anden sind verschneit. Der wunderbare Illimano, das Wahrzeichen Boliviens, der Berg, der wie ein sitzender großgeflügelter Adler aussieht, leuchtet. Die Anden oder Kordilleren, so klingts mir aus der Schulzeit her. Da mußten wir die Gebirge der Erde auswendig lernen.
Die Sonne steht brennend am wolkenlosen Himmel. Hier gibts keinen Städtedunst, keinen Fabrikqualm, die Luft ist klar und scharf, nichts hindert die Sonne, ihre volle Macht zu zeigen. Die Sonne und die Stille …»Numen adest«. Hier sind Götter, hier ist der Gott. Diese nackte Hochebene ist ehrfurchtgebietend. Der Atem stockt einem.
Es hat geschneit, aber der Schnee schmilzt schon wieder. Überall kleine Rinnsale, die wie Silberadern blinken. Der Schnee blendet mächtig. Alles hier oben ist ganz für sich, nicht für den Menschen. Sehr abweisend ist das. Kalt und heiß in Einem. Unerträgliches Licht.
Hinter dem ersten Hügel zwischen dem Altiplano und den Anden, den Siebentausendern, eröffnet sich eine Dantesche Höllenlandschaft: eine flache Talmulde mit einem seichten See, schwefelgelb, giftiggrün, lehmbraun, stumpf grau gefleckt. Totes Wasser. Abwasser aus dem Zinnbergwerk, hineingemischt ins hellgrün ankommende Schmelzwasser der Andengletscher. An den Ufern wächst nichts. NICHTS. So wird unsre Erde aussehen, wenn wir sie vollends umgebracht haben. Wohnen da Menschen? Können da Menschen wohnen? Das ist eine Gespensterzone.
Zwischen See und Gebirge liegt ein Hügel, er versperrt die Aussicht. Auf dem Hügel ein Heer von kleinen Kreuzen, schwarz gegen den brennend blauen Himmel: der Friedhof. Hier wird viel und früh und elend gestorben. Hier wohnen mehr Tote als Lebende. Die Kinder sterben bald nach der Geburt, die Männer mit dreißig an der Staublunge. Auf dem Friedhof kauert neben einem frischen Grab eine junge Indiofrau. Unser Aymara-Fahrer spricht sie an in ihrer Sprache. Er sagt, sie sei eine von denen, die teilgenommen haben an der großen Demonstration der Frauen in La Paz. Ja, sagt sie, das haben wir erreicht, das schon, wir bekamen unsre Männer frei, als man sie bei einer Demonstration festgenommen hatte, aber das ist auch alles, und alles blieb wie es immer war: Ausbeutung, Hungerlöhne, Krankheiten, Elendsquartiere, keine Renten, keine ausreichenden Versicherungen. Unsre Männer arbeiten im Turnus von acht Stunden in den Zinnminen, ihre Lungen füllen sich mit Staub, sie können nichts essen, während sie arbeiten, sie kauen Colablätter, das stillt Hunger und Durst, aber es ist eine Droge, wenn sie herauskommen aus den Schächten, haben sie die Backen voller zerkauter Blätter und sind wie betrunken, und mit dreißig liegen sie hier. Man sagt, daß wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen müssen. Aber wie? Revolution? Sie lacht bitter. Eine Regierung wechselt die andre ab, die eine ist faschistisch und tut Böses, die andre ist ein bißchen links und tut nichts Gutes, und so gehts weiter, ewig weiter. Warum wir nicht wegziehen? Wohin, bitte? In die Stadt, in den Fabriken arbeiten? Es gibt Arbeitslose genug dort. Für uns ist überall die Hölle. Wem gehören diese Zinnbergwerke, die einmal Silberminen enthielten? Dem Staat? Oder einer privaten Firma? Ach, das ist ganz gleich, beide beuten aus.
Das Dorf, die Siedlung, mein Gott, ich habe die Slums in Seoul gesehen und in Indonesien, in Djakarta, und in Dublin und in Rom, bei uns daheim. Aber dies hier! Um einen lehmigen Platz in Hufeisenform die Hütten aus Wellblech und Stein, eine an die andre geklebt, als gäbe das Schutz. Ein Dauer-Provisorium. Jede Hütte hat zwei Räume, unbeheizbar, obwohl Bolivien Erdgas hat in Fülle. Keine Dusche, kein laufendes Wasser im Haus, draußen ein Hydrant mit einem Trog, da waschen die Frauen ihre Wäsche, das Wasser ist eiskalt, die Frauen haben blaurote Arme, daneben hocken kleine Kinder auf dem kalten Erdboden, Rotzglocken unter den roten Nasen, blaurot im Gesicht, stumpf an irgend etwas kauend. Noch leben sie.
Es gibt ein kleines Krankenhaus mit einem Arzt und einem Pfleger. Es ist sauber. Aber die Apotheke hat außer Aspirin und billigsten Medizinen für den Notfall nichts. Der Arzt, noch jung, ist resigniert. Er klagt nicht einmal mehr, er stellt nur fest, was ist. Das IST eben so hierzulande.
In der ganzen Siedlung gibts kein Klo, auch nicht das primitivste. Die Leute müssen aufs freie Feld, auch nachts, auch bei Eiswind. Im Hause der X’s gibt es vier Bäder und vier Klos, und alles ist so schön warm durchgeheizt, und die Speisekammer ist brechend voll. Zwei Arbeiter kommen auf einem Motorrad aus La Paz, sie haben Zeitungen, sie verstecken sie vor uns. Kommunistische? Ich weiß nicht. Sie fürchten uns, das ist klar, und wirklich, was zum Teufel wollen wir hier, wo wir doch nicht helfen können.
Du sollst nicht töten, du sollst keine Revolution machen … Wer einmal in so einem Ort war, der kann nicht mehr weiterleben wie bisher. So eine Erfahrung ritzt scharfe Spuren und macht einen zum Fremden in der Bürgerwelt.
Fahrt nach Sucre, das ist die frühere, die alte Hauptstadt, sehr schön, leuchtendweiße Häuser im spanischen Kolonialstil. Häuser Reicher, hier lebt sichs besser als in La Paz. Wir sind eingeladen im Haus eines eingewanderten Italieners, reich geworden hier. Er führt uns ins Museum, da gehen Geister um, sagt er in allem Ernst, es gibt Nächte, in denen man hier Waffengeklirr hört, Wissenschaftler haben die Sache untersucht, ohne Ergebnis, die Waffen klirren weiter. Viele Zeugen gibts dafür. Wen kanns wundern, wenn hier die alten Mörder, die Eroberer, nicht zur Ruhe kommen.
Von Sucre aus fahren wir mit dem Jeep des Italieners noch höher, immer noch höher. Nichts mehr als Steinfelder und Schafweide. Ganz oben, wo mans schon nicht mehr erwartet, ein Dorf. Markttag. Was gibts zu kaufen? Indio-Handarbeiten, Ponchos, kleine Taschen, handgewebt. Frauen hocken in schwarzen Klumpen auf der Erde. Eine stillt ein Kind, ich schaue hin, sie zieht sofort das Tuch über das Kind und schaut mich finster an. Europäer haben den bösen Blick, Europäer sind immer Feinde … Ich bitte durch eine Geste um Verzeihung. Jetzt lächelt sie ein wenig. Um Frieden zu stiften, bedarf es nur der Liebe. NUR.
Hier kaufe ich für Stephan eine Charanga: eine Art Mandoline, deren Resonanzboden die Rückenschale eines Gürteltiers ist. Der Klang ist faszinierend.
Wir treffen einen deutschen Entwicklungshelfer. Er haust hier allein mit einer Indio-Haushälterin. Er versucht, den Indios rationelle Methoden der Bodenbebauung beizubringen. Viel Erfolg hat er nicht, sagt er. Aber er ist gern hier. Er hat Bücher und Schallplatten, er hat seine europäische Welt ohne deren Mängel. Ein Einsiedler.
In der Universität La Paz. Man hat mich eingeladen zu einem Gespräch mit Studenten und Lehrern. Die Uni sieht aus wie die Sorbonne [Nanterre] 1968: die Wände vollgeklebt mit selbstgemalten Plakaten, mit revolutionären Parolen, der Boden dick bedeckt mit weggeworfenem Papier, abgerissenen Plakaten. Die nachgeholte, die endlich mögliche Studenten-Unruhe. Für kurze Zeit haben sie eine linke Regierung, die das alles erlaubt. Vor der Uni stehen drei »Linke«. Auf dem Plakat des einen ist Hammer und Sichel und Lenins Bild, auf dem des anderen Trotzkis Gesicht, auf dem des dritten das Mao Tse Tungs. Unter den Marxisten gibts viele Spaltungen und Unterspaltungen: unter den Trotzkisten allein gibts drei verschiedene Gruppen. Wie soll da etwas herauskommen, etwas Konkretes zum Wohl des Landes? Gerede, Gerede. Auch das Gespräch mit den Studenten gibt wenig her. Einig sind alle in der traurigen These, daß das bolivianische Volk nicht reif sei zur Demokratie und auch nicht zur Revolution. Mir will scheinen, das sei die Ausrede dafür, daß die Intellektuellen den politischen Kampf nur halbherzig betreiben. Aber wie denn könnte man die Indios aktivieren, die zumeist noch Analphabeten sind in abgelegenen Gebirgsdörfern? Nun: haben die Demonstrationen der Frauen nicht zumindest die Freilassung der Streikenden erreicht? Wer sagt, daß nichts erreicht werden kann in diesem Land? Natürlich: es ist schwer, denn Bolivien gehört nicht den Indios. Das ist klar. Was wir brauchen, sagen viele hier, das ist ein guter Diktator, der unser Vertrauen hat und Ordnung schafft.
Der gute Diktator, der große Führer, der große Bruder, der Messias … Der alte Traum.
Einladung zu einem Filmabend mit Büfett. Einlader ist die bolivianisch-koreanische Vereinigung. Koreanisch? Südkoreanisch natürlich, was denken Sie denn? Nordkorea ist eine furchtbare marxistische Diktatur. Und Südkorea, was ist das? Nun, ein Land, mit dem wir Freundschaft haben. Freundschaft? Ja, wißt ihr denn nicht, was dort geschieht? Greuelmärchen, von Nordkorea verbreitet. Ach so … Der Film ist natürlich schön. Wie ich das alles kenne von meiner Reise her, diese herrlichen Landschaften im Frühling, im Herbst, die schönen Mädchen auf den Schaukeln in der Luft fliegend, die schönen Trachten, die schönen Tänze, die schönen Hotels mit den schönen Frauen, den teuren Edelhuren für die Devisenausländer … Und wo sind die Gefängnisse für die Studenten, die Regimegegner, wo sind die Dörfer mit den Armen, wo sind die Kinder mit den Hungerödemen, wo die Folterkammern, wo die Angst des Präsidenten Park Chang Hee vor den präsumptiven Mördern, wo die Angst des Volks vor dem Geheimdienst, wo ist Kim Chi Ha, der gefolterte und eingesperrte lungenkranke Dichter? Wo sind meine Freunde, die verhafteten Universitätsprofessoren, die Christen … Wo?
Ich gehe hinaus. Ich verzichte gern auf das reiche Büfett. Mir hats den Appetit verschlagen. Draußen treffe ich einen deutschen Jesuiten, der auch Südkorea kennt. Wir reden uns unsern Zorn von der Seele.
Hernach versuche ich mit Herrn X darüber zu reden. Er wehrt ängstlich ab. Wir wollen doch Geschäfte machen mit Südkorea, wir brauchen es. So gehts also: Geschäft, Geschäft.
Ja aber … Er läßt mich stehen und gesellt sich zu Geschäftsfreunden am Büfett.
Gang durch die Stadt La Paz. Die Altstadt liegt im Talkessel, wie die Villen der Reichen zumeist auch, denn je weiter unten, desto erträglicher das Klima. Die Armen, die wohnen in Hütten an den Berghängen, die sehen wie räudig aus von der unkontrollierten Anhäufung miserabler Baracken und Lehmhütten und Wellblechschuppen. La Paz hat nur wenige ebene Plätze. Man muß steile enge Straßen hinauf- und hinuntersteigen. Das sagt sich so einfach: es ist sehr anstrengend, denn die Luft ist sauerstoffarm, jede schnelle Bewegung macht Atemnot. Darum gehen die Indios so langsam, darum bleiben sie so oft stehen, und darum haben sie so pflaumenblaue Gesichter. Ich habe auch schon blaue Backen.
In der Altstadt gibts viele kleine Lädchen und Büdchen. Sonderbare Sachen gibts da: viele Arten getrockneter Wurzeln, die mir Alraune zu sein scheinen, und was ist denn das da? Das sind getrocknete Lama-Embryos. Was macht man mit ihnen? Niemand erklärt es mir. Natürlich gehört das alles zu magischen Praktiken. Man ist ungeheuer abergläubisch hier. Ich will etwas kaufen von diesen Sachen, von den Kräutern und dem Weihrauch. Die Frauen, die mein spanisiertes Italienisch recht gut verstehen, schütteln die Köpfe und wehren ab: mir, der Ausländerin, verkauft man nichts.
Herr X erzählt mir nachher von einem Erlebnis: Er ist über den Altiplano geritten und sah plötzlich einen Baum mit zwei dicken Ästen, zwischen denen etwas ausgespannt war: ein ausgeweideter Hund, im Innern Kinderkleider und Kräuter und Münzen. Er begriff sofort: ein Mann hat das Kind seines Feindes verhext, indem er sich der Kleider bemächtigte. Daß er seinen Hund opferte, obwohl man Hunde hier abgöttisch liebt, bedeutet, daß ihm ungemein viel lag an dieser Sache. Ein Racheakt vermutlich.
Und die Lama-Embryos? Das soll ich noch erfahren.
Mir fallen die vielen Bettler auf, die, einer neben dem andern, auf den Treppenstufen vor den Kirchen hocken. Meist daneben eine andre Person, vor allem Frauen, die aber nicht betteln.
Herr X sagt: Die Bettler sind Blinde.
Soviele Blinde? Die Folge einer Krankheit? Lepra zum Beispiel kann zur Blindheit führen, ich sah das in Südkorea in einer Lepra-Station.
Die Bettler haben verkrüppelte Hände, das stützt meine Annahme. Aber nein, sagt Herr X, das sind Opfer ihres Leichtsinns: die Bolivianer lieben Feuerwerk, aber sie sind unvorsichtig und verbrennen sich die Hände und blenden die Augen.
Warum glaube ich das nicht? Ich frage später unsern Aymara-Chauffeur, mit dem mich eine Art stiller Freundschaft verbindet. Die Unterdrückten wittern in mir sofort die Bundesgenossin. Auf diese Weise erfahre ich vieles. Jetzt erfahre ich den wahren Grund der Blindheit: das sind lauter Minenarbeiter, die bei den Sprengungen Schaden litten. So also ist das. Weiß Herr X das nicht? Er wirds nicht wissen wollen.
Und was tun die Blinden eigentlich? Sie betteln nicht wirklich. Nein, sie sind Hellseher, sagt mein Aymara-Freund. Hellseher?
Ja, aber keine guten, gute sind ganz selten. Wollen Sie einen kennenlernen?
Am nächsten Tag bringt er mich (Herr X ist auch dabei) in einen abgelegenen Winkel der Stadt. Da sitzt auf einem Mäuerchen so ein Blinder, neben ihm eine Indiofrau. Der Blinde hat ein Kreuzchen an einer Kette um den Hals, das nimmt er auf, küßt es, hebt es an die Stirn, dann murmelt er etwas. Die Frau steht auf, legt einen Geldschein neben den Blinden. Jetzt sind wir an der Reihe. Zuerst Herr X. Drei Fragen darf man stellen, sie müssen präzise sein. Herr X fragt, ob er sein Unternehmen auf dem Altiplano weiterführen soll. Der Blinde drückt das Kreuz auf den Mund und auf die Stirn, lauscht oder schaut nach innen, sagt dann entschieden JA. Aber warum, so fragt Herr X, gedeiht es nicht recht? Weil, sagt der Blinde, Unfrieden dort ist zwischen leitenden Männern. Stimmt. Und was muß ich tun, damit alles besser geht? Dieses Mal antwortet der Blinde überraschend mit einer Frage: Hast du der Patschamama geopfert? Herr X ist bestürzt: er hat es nicht getan, er wird es sofort tun. Was bedeutet das, wer ist die Patschamama? Sie ist die Erdgöttin, die Große Mutter, die Madonna auch. Wer ein Haus baut, muß ihr opfern: zum Grundstein gehört ein Lama-Embryo, dazu etwas Goldenes für die Sonne, etwas Silbernes für den Mond, und Kräuter. Warum der Embryo? Weil es etwas sein muß, das das Tageslicht noch nicht sah. Etwas aus dem Mutterschoß Geschnittenes.
Glaubt Herr X an derlei? O ja, alle Bolivianer, auch die in Europa erzogenen, sind abergläubisch. Ein Freund, Mathematiker, sagt, wenn man einem Hund, der Geister sieht, den Schlafsand aus den Augen reibt und die eigenen damit bestreicht, kann man auch Geister sehen. Und wie weiß man, wann ein Hund Geister sieht? Haben Sie noch nie bemerkt, daß Hunde oft stundenlang auf einen Punkt starren? Doch, mein Hund Vanno tat das auch: er starrte einmal einen ganzen Tag an die Zimmerdecke, bis ich ganz verrückt war. Er hat da etwas gesehen, zweifellos. Aber was?
Nun bin ich dran mit den Fragen an den Blinden. Was soll ich fragen? Ob meine Söhne ihren Lebensweg gut machen. O ja, da brauchen Sie keine Sorge zu haben. Herr X souffliert: Ob Sie noch mal heiraten? Es kommt noch ein Mann, ja, spät, und glücklich. Na schön. Mir ist wichtiger, daß er auf meine Frage, wie mein Lebensabend sein wird, antwortet: friedlich.
Aber wieso ist dieser da ein echter Hellseher, die andern nicht? Mein Aymara-Freund erklärt es mir: Der ist nicht im Bergwerk blind geworden. Sondern? Wenn bei einem Gewitter ein Mensch auf der baumlosen Hochebene geht, trifft ihn der Blitz, weil er der höchste Punkt ist. Die meisten Getroffenen sterben sofort. Wenige überleben. Aber dann sind sie blind. So ein vom Blitz Geblendeter ist dann ein echter Hellseher.
Saulus, vom göttlichen Blitz getroffen, wurde blind für drei Tage, er sah den Christus und wurde zu Paulus. Blindheit und Hellsichtigkeit: auch bei Teiresias, dem griechischen Sänger und Weissager.
Der Pastor Dümchen schenkt mir so ein Kreuzchen, wie es dieser Hellseher trug. Der Christuskörper ist kaum mehr zu erkennen, er ist abgegriffen von Indiohänden, abgeküßt in der Not.
Hier stürze ich wieder einmal in den Abgrund: der Christus, geholfen hat er den Indios nicht, er gab keine Arbeit, kein Brot, keine gute Regierung. Einmal, sagte Herr X, hatte Bolivien eine sozialistische Regierung, sie hat Land aufgeteilt an die Indios, ist das nichts? Aber die Indios, sie tun ja nichts mit dem Land.
Ja, sage ich. Der alte Schah, der Vater von Reza Pahlewi, hat auch eine Bodenreform gemacht im Iran, und das war dann alles. Maschinen hätte er dazugeben müssen, für ein gutes Bewässerungssystem hätte er sorgen müssen. Was tut ein Kleinbauer mit einem Stück armen Lands, wenn er kein Wasser und keine Maschinen hat? Er verkauft das Land an einen, der Geld hat. Das ist wieder ein Großgrundbesitzer. So kommt das Land wieder an den ersten Herrn zurück. So bleibt alles beim alten. Die Regierung kann sagen: Wir haben die Bodenreform gemacht, aber diese faulen Leute arbeiten ja nicht, wozu also Reformen, das Volk will sie ja gar nicht.
Ich, sagt Herr X, gebe meinen Indios da oben nicht nur Land, sondern Maschinen und Anweisungen. Aber es ist wirklich eine Sisyphusarbeit.
Herr X, sagen Sie mir: könnten die Bolivianer eine echte Revolution machen? Mir scheint, der Aufstand der Bergarbeiterfrauen unter der Führung dieser tapferen Noema Vizzier war eine Probe. Ich las ihr Buch ›Wenn man mir erlaubt zu reden‹ in Deutsch.
Ach, sagt Herr X, das war eine Episode.
Ich bin dessen so sicher nicht.
Wir schauen während des Gesprächs von oben auf die Stadt hinunter: La Paz. Ihr ganzer Name ist: Ciudad de Nuestra Señora de la Paz. Die Stadt unserer Frau vom Frieden.
Afghanistan. Im TV ein Schnappschuß, vermutlich unbeabsichtigt inmitten eines Berichts vom Kriegsschauplatz: die Wüste weithin, in der Bildmitte, weit weg, ganz klein, ein zerschossener verlassener Panzer, und ganz vorn am Bildrand ein Vogel, der eine Taube sein kann.
Aufstiegschancen. Ein Sonnenstrahl, der durch eine Spalte meines Fensterladens fällt, zeigt mir Tausende tanzender Staubkörnchen. Wären meine Augen hundertmal schärfer, sähe ich Millionen noch winzigerer Gebilde. Die Luft ist voll von ihnen. Ich lebe mit ihnen in immerwährender engster Gemeinschaft. Ich frage mich: bewegen sie sich nur mechanisch, weil Wärme- und Kälteströmungen sie treffen, oder bewegen sie sich aus eigener Kraft und weil es sie freut? Mir scheint, sie tanzen. Ich schaue ihnen lange zu. Sie bewegen sich rhythmisch. Sie bewegen sich vermutlich nach demselben Rhythmus, nach dem die Sterne sich bewegen. Es ist der universale Rhythmus des Lebens. Könnte ich das Universum so sehen, wie ich diesen Sonnenstrahl sehe, so sähe ich vermutlich den Sternentanz. Könnte ich ins Innere eines Atoms schauen, sähe ich den Neutronentanz.
Je länger ich zuschaue, desto stärker wird mein Gefühl, daß diese eben noch für mein Auge sichtbaren Teilchen der Materie LEBEN. Es gibt nichts Totes. Es gibt aber Übergangsformen innerhalb des Lebensstromes. Unendlich viele Übergangsstufen vom Bakterium, vom Virus, von den unvorstellbaren Winzigkeiten bis zum Einzeller, zur Pflanze, zum Tier, zum Menschen, zum Gott. Das Wort »Stufen« schrieb ich so hin, ohne zu bedenken, daß ich damit behaupte, das Leben mache Sprünge. Es gleitet nicht, es springt. Was ich vor langer Zeit zuerst bei Teilhard de Chardin las, das SEHE ich jetzt plötzlich: diese tanzenden Winzigkeiten, die ja vergleichsweise riesig sind, da ich sie sehen kann, haben die Tendenz zum Sprung in sich. Der élan vital verleiht ihnen die Spannung, die zum Sprung auf die nächst höhere Seinsstufe nötig ist. Was da also in meinem Sonnenstrahl tanzt, das ist Leben, und zwar höherdrängendes Leben. Wie lange wird es dauern, bis einige dieser Stäubchen sich zusammenschließen zu einer organisierten Zelle? Wie lange, bis daraus eine Pflanze wird? Wie lange, bis daraus ein Tier wird, ein Mensch? Wie lange, bis aus einem Menschen ein Gott wird, wie es im Evangelium steht? Ich schaue meine Staubwinzigkeiten mit Ehrfurcht an: in ihnen drängt das Leben zum Aufstieg in den göttlichen Bereich. Um mich herum also geschieht unendlich viel, unendlich Großes, es geschieht die Vorbereitung zum Quantensprung. Mich erfaßt eine grenzenlose Liebe zum Leben.
Ich denke, ob ich auch einmal als eine Winzigkeit aus Staub irgendwo in der Atmosphäre getanzt habe, und ob ich, nicht mehr als Winzigkeit an Materie, aber eine Potenz an Geist einmal in einem Lichtstrahl tanzen werde, und ob das die versprochene »ewige Seligkeit« sein könnte.
Immer stärker wird mein Gefühl für die Geistigkeit der Materie.
Zum Thema Autorität: einen Aufsatz von Friedrich Engels gelesen und ein Gespräch geführt mit dem italienischen Maurer F. Übereinstimmung beider.
Engels kritisiert jene Sozialisten, die [es war in den frühen siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts] »einen regelrechten Kreuzzug gegen das eröffnen, was sie das Autoritätsprinzip nennen. Sie brauchen nur zu sagen, dieser oder jener Akt sei autoritär