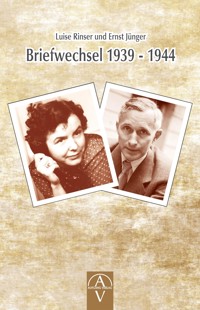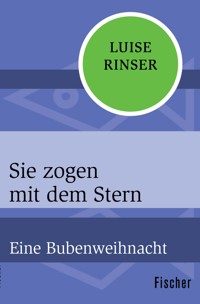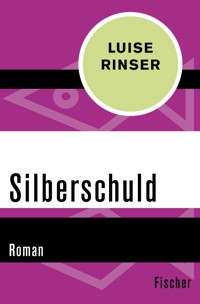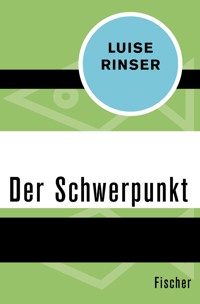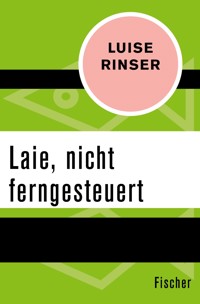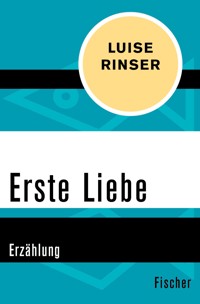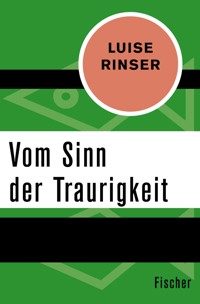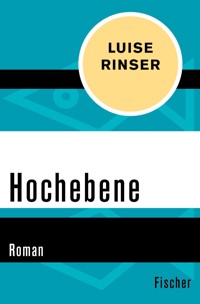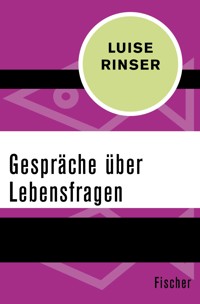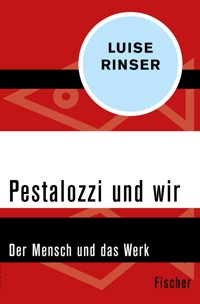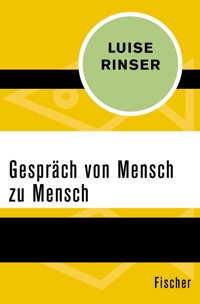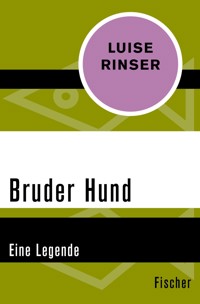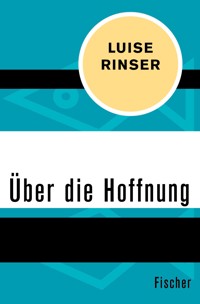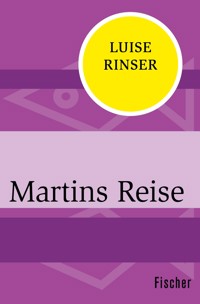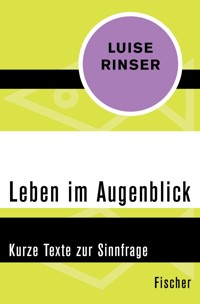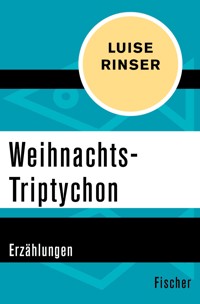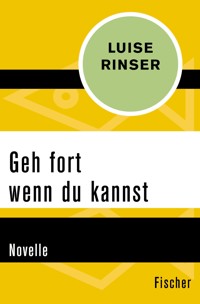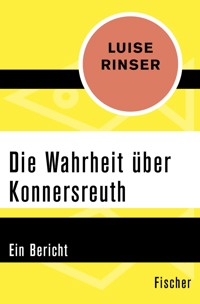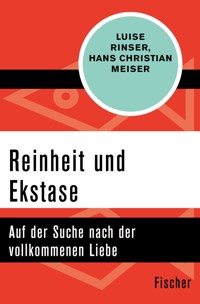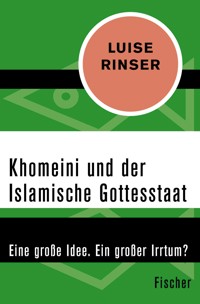7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was ist die Frau für den Priester? Stellt sie eine Gefahr dar, die es zu meiden gilt? Oder ist, unter der Berücksichtigung realer Lebensumstände, nicht vielmehr eine, wie auch immer geartete, Freundschaft möglich? Luise Rinser unternimmt hier den Versuch, zwei sich auf den ersten Blick fundamental widersprechende Auffassungen miteinander zu vereinen. Denn auch im steten Spannungsfeld zwischen geistiger und geschlechtlicher Liebe, oder vielmehr ganz besonders dort, entwickeln sich mitunter übermächtige Gefühle. Luise Rinser denkt all diese Möglichkeiten konsequent durch und geht in ihrem erstmals 1967 veröffentlichten Essay auch provokant erscheinenden Fragen nicht aus dem Weg. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 61
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Luise Rinser
Zölibat und Frau
Über dieses Buch
Was ist die Frau für den Priester? Stellt sie eine Gefahr dar, die es zu meiden gilt? Oder ist, unter der Berücksichtigung realer Lebensumstände, nicht vielmehr eine, wie auch immer geartete, Freundschaft möglich? Luise Rinser unternimmt hier den Versuch, zwei sich auf den ersten Blick fundamental widersprechende Auffassungen miteinander zu vereinen. Denn auch im steten Spannungsfeld zwischen geistiger und geschlechtlicher Liebe, oder vielmehr ganz besonders dort, entwickeln sich mitunter übermächtige Gefühle. Luise Rinser denkt all diese Möglichkeiten konsequent durch und geht in ihrem erstmals 1967 veröffentlichten Essay auch provokant erscheinenden Fragen nicht aus dem Weg.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
»Mit Recht eifersüchtig auf [...]
»Ehelosigkeit um des Himmelreiches [...]
Beim Vergleich der päpstlichen [...]
»Mit Recht eifersüchtig auf die Ganzhingabe an den Herrn bedacht, soll der Priester sich gegen die Neigungen seines Gefühls zu schützen wissen, die eine wenig erleuchtete, nicht vom Geiste geleitete Gefühlsbetonung auslösen, und er soll sich sehr davor hüten, solche Neigungen unter dem Vorwand geistlicher und seelsorglicher Betätigung zu rechtfertigen, die sich in Wirklichkeit als gefährliche Neigungen des Herzens offenbaren« (Absatz 77).
Enzyklika »Sacerdotalis Caelibatus«
Paul VI., Juni 1967
»Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen ist eine wahrhaft nicht leichte menschliche Aufgabe, die nie zu Ende ist, ein Wagnis mit Risiken, das immer neu eingegangen werden muß … Jede Altersstufe, jede neue Umwelt und seelsorgerliche Aufgabe verlangen von uns eine neue innere Einstellung und ein neues Ringen um eine gesunde, tragfähige Menschlichkeit und männliche Reifung. Eine Fülle von Aufgaben ist uns gestellt: die ausgewogene Einstellung zur Frau …, die Pflege der Freundschaft und menschlichen Begegnung auch und gerade mit der Frau …«
Rundbrief des Erzbischofs von München und Freising an die Priester im Erzbistum zur Fastenzeit 1967
Beim Vergleich der päpstlichen Enzyklika mit dem Inhalt des bischöflichen Briefes stoßen wir auf einen Widerspruch, der sich zwar mit einigen eleganten Fechthieben theoretisch beseitigen ließe, wenn man sagte, der Papst warne ja nur vor »gefährlichen Neigungen« und das meine der deutsche Bischof Kardinal Döpfner, doch auch, wenn er ausdrücklich von »Freundschaft« zwischen Priester und Frau spreche, womit doch deutlich genug gesagt sei, daß er nur jenen Beziehungen das Wort rede, die der Papst »vom Geiste geleitete« nennt. Aber allzu glatte Antworten sind uns längst verdächtig.
Ohne hier schon genauer auf den Inhalt der beiden Schreiben einzugehen, ist zu sagen, daß die Konzeption des Papstes und die des Bischofs verschieden sind. Die des Papstes ist eine rein spirituell-theologische, gegründet auf die traditionell gewordene, überaus (um nicht zu sagen übertrieben) hohe Einschätzung der »Jungfräulichkeit«; die des Bischofs ist, obgleich er sich ebenfalls zu dieser Idee bekennt, wennschon mit einem gewissen behutsamen Zögern, eine pastorale, entstammend der Erfahrung mit der Wirklichkeit von heute einerseits, andrerseits der durch das Zweite Vatikanische Konzil betonten, vom Papst selbst gewollten, aber schließlich in den wenigen Jahren seither wieder halb vergessenen und in entscheidenden Punkten verratenen »Aufwertung der Welt« gegenüber einer aszetisch-mystischen Vorausflucht in den »neuen Aion«, in dem »nicht geheiratet und nicht gezeugt«, aber, so müssen wir hoffen dürfen, doch personal geliebt werden wird.
Wie verschieden die Haltung von Papst und Bischof ist, sehen wir daran, daß Döpfner von den »echten Möglichkeiten« spricht, die einem verheirateten Priester etwa der evangelischen oder der Ostkirche helfen, seinen priesterlichen Dienst zu vertiefen, während der Papst von jenen Priestern, welche gerne Priestertum und Ehe vereinigen möchten, und, da ihnen dies verwehrt wird, notgedrungen um Dispens vom Priesteramt bitten, als von Leuten spricht, die »das Haus Gottes verlassen« und »sich in ein trauriges Abenteuer einlassen und des Mitleids der Kirche bedürfen« (Enzyklika Abs. 95). Bezeichnend ist auch, daß in der sehr langen päpstlichen Enzyklika die Frau nur zweimal erwähnt wird, und beide Male mit einem schlecht verhehlten negativen Vorzeichen, nämlich als das vom Zölibatär zu Meidende, zu Überwindende, während der Bischof sie in seinem kurzen Brief mehrmals nennt und immer positiv wertet.
Kurz zusammengefaßt ist die Meinung des Papstes die, daß die Frau für den Zölibatär eine Gefahr sei und daß er sie meiden soll; die des Bischofs, daß der Priester zu seiner männlichen und priesterlichen Reifung die Frau brauche, und daß er die Pflege der Freundschaft mit ihr geradezu als Aufgabe zu betrachten habe. Schon aus der Gegenüberstellung der beiden offiziellen Schreiben der Amtskirche, die nicht einmal beabsichtigen, eine Konfliktsituation heraufzuführen, sehen wir, wie schwierig diese Frage ist, wie unsicher die Kirche im Augenblick ist und wie jedes Berühren des Themas einem Griff ins Hornissennest gleichkommt.
Wie aber soll der einzelne Priester sich verhalten, wem folgen? Dem Papst, der ihm rät oder befiehlt, die Frau zu fliehen, wenigstens sobald er ein »Gefühl«, eine »Neigung« für sie spürt, solcherart auf Nummer Sicher zu gehen? Dem Bischof, der vom Zölibat als einem Wagnis mit Risiken spricht und dabei auch und besonders an das Wagnis der Beziehung zur Frau denkt?
Ich mache es mir zur schweren Aufgabe, darüber nachzudenken, ob von der päpstlichen Enzyklika zum bischöflichen Brief nicht doch eine tragfähige Brücke gebaut werden kann, ohne daß der einen wie dem andern ein billiges Zugeständnis gemacht wird, entweder auf Kosten des Evangeliums und der nun einmal auch vorhandenen kirchlichen Tradition, oder auf Kosten jener Wahrheit, die auch das reale menschliche Leben in sich und für sich hat.
Meine Frage lautet präzise: Wie kann der Priester, ohne seinen Zölibat aufzugeben oder ihn auch nur zeitweise zu verletzen, eine echte personale Beziehung zu einer Frau leben, ganz gleich welchen Namen man dieser Beziehung geben mag?
Man wird hier sofort einwenden: Aber eben dieser »Name« ist wichtig, und der Bischof hat mit vollem Bedacht den Namen »Freundschaft« gewählt.
Dieser Einwand fordert dazu heraus, den Begriff der Freundschaft zu definieren, und zwar an Hand eines mit dem kirchlichen Imprimatur versehenen Lexikons, des Lexikon für Theologie und Kirche. Hier steht:
»Freundschaft bezeichnet im neueren Sprachgebrauch die aus freier Zuwendung hervorgegangene, in geistiger Kommunikation bewährte Realisierung der zwischenmenschlichen Beziehung. In personaler Sympathie gründend und von der idealisierenden Kraft des Eros getragen, stiftet Freundschaft eine dauernde Zugehörigkeit, die auf gemeinsamer Anschauung und Wertung beruht.«
Damit ist (scheint) Freundschaft scharf abgesetzt gegen alles, was nicht Freundschaft ist, das heißt vor allem gegen das, was man Geschlechterliebe nennt.
Nun ist aber in die Definition ein Begriff eingeführt, der, wenigstens zunächst, stört. Es ist da nämlich die Rede von »der Kraft des Eros«.
Was ist Eros? Jedermann glaubt es zu wissen und verwechselt dabei Eros und Erotik. Im Lexikon für Theologie und Kirche ist Eros definiert als »Bezeichnung für Liebe«. Es wird da weiterhin gesagt, daß Eros (im personalen Schichten-Aufbau) die Mitte halte zwischen vitalem Sexus und spiritueller Agape.
Der Begriff Agape wird erklärt als »spezifisch christliche Liebe«, die der Mensch nur auf dem Wege der Gnade (pneuma, virtus infusa, eingegossene Tugend) erhält und besitzt. Die hierauf folgenden ziemlich schwierigen Ausführungen können auf eine kurze Formel gebracht werden: Agape ist jene Liebe, welche bewußt Gott als dritten Partner hat, ausdrücklich im Bereich geistiger und spezifisch religiöser Werte beheimatet ist, welcher das Begehren nach der körperlichen Vereinigung mit dem geliebten Geschlechtspartner nicht wesentlich ist für sich und welche auf den körperlichen Vollzug der Liebe freiwillig und radikal verzichtet um einer Idee willen, welche wiederum dem Bereich geistig-religiöser Werte angehört.