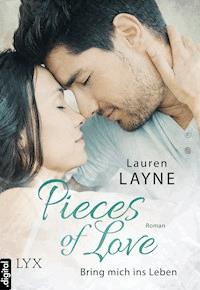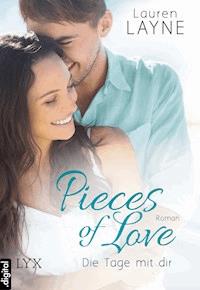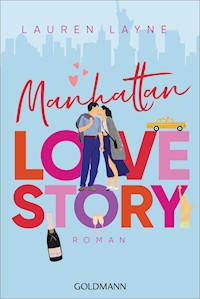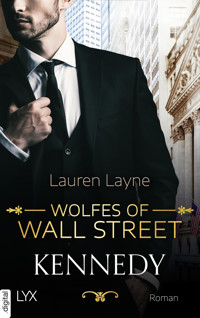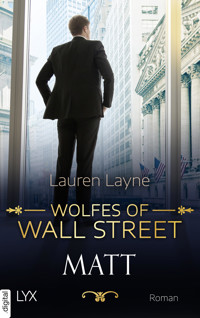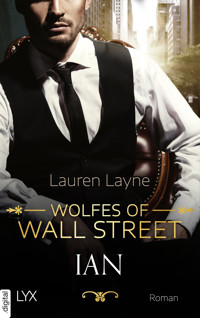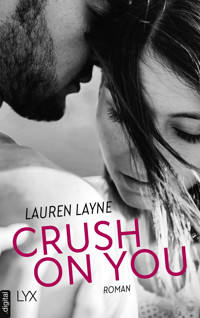6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Findet sie die große Liebe bis Weihnachten?
Als eine Wahrsagerin Kelly Byrne kurz vor Weihnachten prophezeit, dass sie ihre wahre Liebe schon längst getroffen hat, hat sie nur ein Ziel: noch vor dem Fest herauszufinden, welcher ihrer Exfreunde in der Weissagung gemeint sein könnte. Daher macht sie eine Liste mit ihren Verflossenen und datet einen nach dem anderen - nur um immer wieder enttäuscht zu werden und sich bei ihrem besten Freund auszuweinen. Was sie nicht weiß: Dieser ist schon lange in sie verliebt ...
"Lauren Layne schreibt sexy und wunderbar romantische Liebesgeschichten mit Protagonisten, die man als beste Freunde haben möchte!" VIOLET DUKE, NEW-YORK-TIMES-Bestseller-Autorin
Eine prickelnde Friends-to-Lovers-Romance von Bestseller-Autorin Lauren Layne
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Freitag, 15. Dezember, früher Nachmittag
Freitag, 15. Dezember, später Nachmittag
Samstag, 16. Dezember, Vormittag
Samstag, 16. Dezember, Abend
Sonntag, 17. Dezember, Vormittag
Sonntag, 17. Dezember, Nachmittag
Sonntag, 17. Dezember, Nachmittag
Sonntag, 17. Dezember, Abend
Montag, 18. Dezember, Vormittag
Montag, 18. Dezember, Nachmittag
Montag, 18. Dezember, Abend
Montag, 18. Dezember, Nacht
Dienstag, 19. Dezember, Vormittag
Dienstag, 19. Dezember, Nachmittag
Mittwoch, 20. Dezember, Abend
Mittwoch, 20. Dezember, Abend
Donnerstag, 21. Dezember, Morgen
Donnerstag, 21. Dezember, Nachmittag
Donnerstag, 21. Dezember, Abend
Freitag, 22. Dezember, Vormittag
Samstag, 23. Dezember, Nachmittag
Samstag, 23. Dezember, Abend
Samstag, 23. Dezember, Abend
Samstag, 23. Dezember, Abend
Sonntag, 24. Dezember, Nachmittag
24. Dezember, spät
25. Dezember, früher Morgen
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Lauren Layne bei LYX
Leseprobe
Impressum
LAUREN LAYNE
A Love for Christmas
Roman
Ins Deutsche übertragen von Richard Betzenbichler
Zu diesem Buch
Als eine Wahrsagerin Kelly Byrne kurz vor Weihnachten prophezeit, dass sie ihre wahre Liebe schon längst getroffen hat, hat sie nur ein Ziel: noch vor dem Fest herauszufinden, welcher ihrer Exfreunde in der Weissagung gemeint sein könnte. Daher macht sie eine Liste mit ihren Verflossenen und datet einen nach dem anderen – nur um immer wieder enttäuscht zu werden und sich bei ihrem besten Freund auszuweinen. Was sie nicht weiß: Dieser ist schon lange in sie verliebt …
Für Sarah und Shelby und für alle, die wissen, dass die Weihnachtsfilme auf Hallmark das Schönste auf der Welt sind. Dieses Buch ist euch gewidmet.
Freitag, 15. Dezember, früher Nachmittag
Wisst ihr noch? Als Kind gab es kein schöneres Gefühl als das am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien.
Dann wurde man älter und dachte: »Mann, was waren das für tolle Zeiten. Wenn man doch auch als Erwachsener diese Augenblicke reiner Freude erleben könnte.«
Kleiner Tipp: Werdet Grundschullehrer. Das Glücksgefühl ist nicht ganz dasselbe wie als Kind, es kommt ihm aber doch sehr nah.
Noch zehn Minuten. Nur noch zehn Minuten, und dann gibt es taaaagelang nur noch Eierpunsch und Bing Crosby.
»Auf Wiedersehen, Ms Byrne. Fröhliche Weihnachten!«
»Fröhliche Weihnachten, Alex.« Ich zerzause die blonden Locken des Drittklässlers. Oder versuche es zumindest, denn in einem Anfall von Ferienekstase ist er schon aus der Tür.
»Fröhliche Chanukka, Ms Byrne. Und Fröhliche Weihnachten. Und Fröhliche Kwanzaa. Und …«
»Vielen Dank, Danielle. Schöne Ferien, Schätzchen.«
Das dunkelhaarige Mädchen hüpft hinter Alex zur Tür hinaus, und der Rest meiner dritten Klasse folgt den beiden. Manche lassen noch ein überdrehtes »Fröhliche Weihnachten!« oder »Fröhliche Chanukka!« hören, aber mindestens die Hälfte der Kinder ist bei der Aussicht auf zwei Wochen schulfrei zu aufgeregt dafür. Das, kombiniert mit dem Zuckerüberschuss dank Olivia M’s Geburtstagstörtchen, sorgt dafür, dass die Kinder geradezu explosionsartig aus dem Klassenzimmer stürmen. Ein einziger, nicht mehr unterscheidbarer Haufen leuchtender Rucksäcke und dezent farbiger Uniformen, der den wartenden Kindermädchen oder Chauffeuren entgegeneilt.
Und jetzt denkt ihr: Moment, Moment, Moment – das ist eine von diesen Schulen?
Ja, ganz genau. Ich bin Lehrerein der dritten Klasse an der Emory Academy, einer privaten Grundschule im Stadtteil Tribeca in Manhattan. Die meisten meiner Schüler haben halb-berühmte Eltern. Die andere Hälfte entstammt ganz einfach altmodisch reichen Familien.
Aber rümpft jetzt bloß nicht die Nase und zieht keine falschen Schlüsse. Auch Kinder aus wohlhabendem Haus brauchen gute Lehrer. Und außerdem: Ich rede mir gern ein, dass ich als Frau vom Land, die in der großen Stadt lebt, sie ein bisschen erden kann.
Ein Beispiel: Als ich ihnen kürzlich erklärte, dass ich seinerzeit mit einem gelben Monster namens Schulbus von zu Hause zur Schule pendelte, haute diese Vorstellung sie regelrecht um.
»Ms Byrne?«
Das letzte noch verbliebene Kind ist Madison Meyers, ein süßes Mädchen, auch wenn sie sich manchmal etwas ziert, mit herrlich glänzendem braunen Haar, das unübersehbar dazu neigt, sich auf beeindruckende Weise zu kräuseln. Im Moment mag ihr das nicht sonderlich gefallen, aber wartet nur, bis sie auf der Highschool ist. Dann wird ihr klar werden, dass sie, im Gegensatz zu meiner Wenigkeit, das große Haarlos gezogen hat.
Ich widerstehe dem Drang, meine eigenen blonden Zotteln zu berühren. Dank dem Dauernieseln sind meine Locken völlig außer Kontrolle geraten.
»Na, Madison, was gibt’s?«
Sie greift nach hinten und streift ihren Kunst-(oder auch nicht Kunst-; an dieser Schule lässt sich das schwer beurteilen)lederrucksack ab.
Sie schiebt ihr rot glänzendes Stirnband zurück, beugt sich vor und wühlt in ihrem Rucksack, bis sie etwas findet, das an ein über und über mit Glitter bedecktes Papierknäuel erinnert.
»Das habe ich für Sie gemacht«, verkündet sie und hält es mir hin. »Na ja, eigentlich ich und Sarah.«
Sarah ist Madisons Kindermädchen. Zumindest war sie es. Kann gut sein, dass sie wegen dieses speziellen Kunstprojekts gefeuert wurde. Ich habe Madisons Mutter kennengelernt, und Mrs Meyers scheint mir nicht der Typ zu sein, der im Haus Glitter duldet.
»Danke«, sage ich und hebe das Geschenk vorsichtig hoch. Ich bewege mich langsam, um Zeit zu schinden, bis ich erkennen kann, womit ich es hier zu tun habe.
Ich schüttele das Knäuel ganz leicht, und es entfaltet sich mit einem Schauer von Silberglitter.
Ohhhhh! »Eine Schneeflocke. Die ist aber schön, Madison.«
»Nicht wahr?« Sie schiebt erneut ihr Stirnband zurecht. »Ich war mit der Schneeflocke, die ich am Mittwoch im Unterricht gemacht habe, so unzufrieden, dass ich es so lange versucht habe, bis mir endlich etwas gelungen war, auf das ich wirklich stolz sein kann.«
Umsichtig verberge ich mein Lächeln. »Tja, deine harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Das wandert auf direktem Weg auf meinen Kühlschrank.«
Sie strahlt und klatscht auf eine entschiedene Art in die Hände, die ich bei ihrer Mutter an Elternabenden gesehen habe. »Ich bin hoch erfreut. Schöne Ferien, Ms Byrne.«
»Schöne Ferien, Madison.«
Einer der Vorteile, wenn man an einer Privatschule arbeitet, ist der, dass man nicht wie auf rohen Eiern um das Thema religiöse versus weltliche Feiertage herumtanzen muss. Die Lehrer sind angehalten, ihre Schüler über alle Festtage im Dezember zu unterrichten und jedem Schüler mit dessen bevorzugter Grußformel zu antworten.
Nachdem Madison den Raum verlassen hat, steckt Jackie Reyes den Kopf zur Tür herein. »War das die Letzte?«
»Die Letzte.«
Jackie, um die vierzig, eine freundliche Koordinatorin, die dafür verantwortlich ist, dass alle Kinder mit dem richtigen Erwachsenen nach Hause fahren, überprüft etwas auf ihrem Klemmbrett, dann folgt sie Madison hinaus in den Abholbereich. Sie macht noch einmal kehrt und steckt grinsend den Kopf zur Tür herein. »Fast geschafft.«
Erneut verschwindet sie, und ich betrachte lächelnd meine Glitterschneeflocke.
Es ist nicht so, dass ich meine Arbeit nicht mag. Ich mag sie. Seit ich denken kann, wollte ich Lehrerin werden, und ein besseres Umfeld als Emory kann ich mir gar nicht vorstellen. Müsste ich mein Berufsleben auf einer Skala zwischen eins und zehn beurteilen, käme ich locker auf neun. Es könnte sogar eine Zehn sein, wenn nur die Rektorin Mercedes mein Unterrichtsbudget wenigstens geringfügig anheben würde.
Mein Privatleben hingegen?
Da komme ich über eine Drei nicht hinaus.
Zwei Wochen mich ganz auf mich konzentrieren, ist genau das, was ich brauche.
Und den Eierpunsch, versteht sich.
Und Weihnachtsbeleuchtung.
Und Michael Bublés Weihnachtsalbum.
Und vielleicht noch etwas Großes, Dunkles, Hübsches, das meine Hand hält, wenn ich darum bettele, noch einmal »Baby, it’s cold outside« hören zu können.
He, ein Mädchen wird doch noch träumen dürfen.
»Let it Snow« summend mache ich mich daran, das Klassenzimmer aufzuräumen – eine überraschend gewaltige Aufgabe, wenn man bedenkt, dass ich erst gestern Abend aufgeräumt habe und heute nur ein halber Tag Unterricht war. Auf den Bänken findet sich hellgrüner Zuckerguss von den Törtchen, auf dem Boden liegen zerbrochene Zuckerstangen und jede Menge Fetzen Tonpapier mit schönen Grüßen von der ersten Schulstunde heute früh, in der wir Weihnachtskarten gebastelt haben.
Kurz überlege ich, ob ich einen Teil der Festdekoration von den Wänden nehmen soll, da der Unterricht erst am 3. Januar wieder beginnt, aber das kann ich nicht. Weihnachtsschmuck vor den Festtagen beseitigen, wäre einfach falsch. Lieber komme ich Ende Dezember noch mal her und räume dann auf, ehe ich meine Festtagsstimmung abwürge, noch bevor sie richtig in Fahrt gekommen ist.
Stattdessen beschränke ich mich auf mein Pult, damit Rektorin Mercedes nichts zu meckern hat, falls sie hier später alles kontrolliert.
Ich verschließe die Schränke. mittlerweile bin ich in meiner Liederauswahl bei »Deck the Halls« angelangt. Da schließt sich eine tiefe Altstimme meinem fa-la-la-la an. Was an Tonhöhe fehlt, wird durch Begeisterung wett gemacht.
Ich drehe mich um und sehe, wie Jessica Trenton, Lehrerin der ersten Klasse und in der Arbeit meine beste Freundin, sich auf mein Pult schwingt.
In der Hand hält sie ein hübsches in Goldpapier eingewickeltes Geschenk, an der Tür steht ein Koffer. Jessica und ihr Verlobter stammen beide aus Chicago und fahren heute gemeinsam nach Hause.
»Siehst du? Ich habe dir ja gesagt, dass dein Flug nicht storniert wird«, begrüße ich sie.
»Ja, in deine Teeblätter setze ich enormes Vertrauen«, erwidert sie.
»Trotzdem hatten sie recht.« Ich deute auf das Fenster. »Regen, aber nicht eine Schneeflocke in Sicht.«
»Gutes Argument. Ist dir bewusst, dass du Glitter auf den Titten hast?«
Ich schaue runter auf meinen schwarzen Pulli und die graue Hose. Tatsächlich, Madisons Schneeflocke hat ihre Spuren hinterlassen.
»Drittklässler-Risiko.« Ergebnislos wische ich an dem Glitter herum.
»Wem sagst du das. Ich habe heute in meiner Handtasche eine Tube Elmer’s gefunden.«
»Du hast Klebstoff in deiner Handtasche? Sagenhaft.«
»Ich habe ihn da nicht reingetan. Keine Ahnung, wer von den kleinen Monstern das geschafft hat, aber ich würde mein Geld auf Hillary Garrett setzen.«
»Der süße kleine Rotschopf?«
»Das sagst du nur, weil ihr Vater so ein scharfer Typ ist. Sie ist ein kleines Biest.«
»Du magst doch die Problemfälle. Ich habe gedacht, ihr Daddy sei schwul.«
»Ist er auch. Trotzdem ein scharfer Typ.« Jessica zieht die Augenbrauen hoch. »Aber kommen wir zu wichtigeren Themen. Packst du dein Geschenk jetzt gleich aus? Oder spielst du weiter die Verschrobene, die sich weigert, vor Heiligabend die Geschenke auszupacken?«
»Ich bleibe bei meiner Marotte«, antworte ich, während ich ein vergessenes Jackett vom Kleiderbügel nehme. »Vorzeitig die Geschenke zu öffnen, vermindert den Weihnachtzauber.«
»Oder zögert es den passenden Zeitpunkt lediglich hinaus?« Jess führt mich in Versuchung. Sie hält das schuhschachtelgroße Geschenk hoch und schüttelt es verlockend.
Ich spitze die Lippen. Da ist durchaus was dran. Und gerade jetzt könnte ich ein Geschenk wirklich brauchen …
»Befragen wir die Magic 8«, schlage ich vor.
Sie verdreht die Augen, greift aber doch nach hinten, zieht die oberste Schublade meines Pults heraus und schnappt sich eine der Magic-8-Kugeln.
»Hilf mir auf die Sprünge«, sagt sie. »Wie viele von denen hast du noch mal?«
»Nur drei.«
»Drei zu viel, Kell. Drei zu viel.«
Es ist eine alte Diskussion, deshalb verzichte ich auf den Einwand, dass es keineswegs zu viele seien. Eine brauche ich für zu Hause, eine für die Arbeit und die kleine passt gut an meinen Schlüsselbund. Die brauche ich, wenn ich unterwegs bin. Ist doch klar, oder?
Man weiß nie, wann man den Beistand des Schicksals nötig hat.
»Na schön, Magic 8, dann lass mal hören. Sollte unser Mädchen ihr Geschenk gleich auspacken oder bis Weihnachten warten?«
»Nur Ja-/Nein-Fragen«, erinnere ich sie und lege die winzige Wolljacke neben meine, damit ich nicht vergesse, sie hernach bei der Fundstelle abzugeben.
»Stimmt. Wie konnte ich nur all diese streng wissenschaftlichen Regeln vergessen? Soll Kelly ihr Geschenk auspacken, bevor ich mich auf den Weg zum Flughafen mache, wie eine ganz normale beste Freundin?«, fragt sie die Magic 8.
Sie schüttelt die Kugel, und ich warte geduldig, weil ich das Ergebnis bereits kenne.
Jessica rümpft die Nase über die Antwort. »Auf keinen Fall.«
»Was habe ich dir gesagt?« Ich nehme ihr die Kugel aus der Hand, lege sie in die Schublade zurück und schließe ab. »Und falls du dich fragst, wo dein Geschenk bleibt: Das ist bereits bei der Post. An die Adresse deiner Eltern. Darf nicht vor dem ersten Feiertag geöffnet werden, allerfrühestens an Heiligabend, denn wenn ich etwas bin, dann flexibel.«
»Ja, und wie flexibel.« Sie hüpft von meinem Pult und reicht mir das Geschenk.
Vorsichtig lege ich Madisons Schneeflocke auf Jessicas Geschenk, dann ziehe ich meinen weißen J. Crew-Mantel über, den ich letztes Jahr im Ausverkauf ergattert habe.
»Bist du sicher, dass du nicht mit zu mir kommen willst?« Jessica fleht mich fast an, während ich das Klassenzimmer abschließe. »Erik kann dir mit seinen Bonus-Meilen ein Ticket besorgen, und meine Eltern können es gar nicht erwarten, dich mal persönlich kennenzulernen.«
Ich hake mich bei ihr unter. »Du bist süß, und ich bin dir wirklich dankbar, aber ich komme klar. Fest versprochen.«
»Du wirst Weihnachten ganz allein verbringen«, sagte Jess sanft. »Du! Wo du doch so ein Weihnachtsfreak bist.«
»Ich weiß, aber es ist ja nur dieses eine Jahr, und tatsächlich freue ich mich schon darauf. Zum ersten Mal überhaupt kann ich an Weihnachten tun und lassen, was ich will.«
Ich weiß, dass es ein tolles Weihnachten wird, weil die Magic-8-Kugel, die für zu Hause zuständig ist, mir das verraten hat. Allerdings sage ich Jess das nicht. Sie ist eigentlich ganz tolerant meiner abergläubischen Natur gegenüber, aber sie hat ihre Grenzen.
Und ich fühle mich wirklich nicht so schlecht, weil ich Weihnachten allein verbringe. Ich bin kein Waisenkind, und meine Eltern gehören auch nicht irgendeiner Sekte an.
Es ist so: Meine Eltern, übrigens ziemlich perfekte Eltern, haben am 22. Dezember vor dreißig Jahren geheiratet. Normalerweise machen sie um ihren Hochzeitstag nicht viel Aufsehen, um die Festlichkeiten nicht zu verkomplizieren. Aber dieses Jahr feiern sie ein Jubiläum, und dafür habe ich eine Menge meines mageren Lehrergehalts gespart, um ihnen einen lange gehegten Wunsch zu erfüllen: über Weihnachten eine zweiwöchige Kreuzfahrt nach Alaska.
Und ich habe so gebucht, dass keine Stornierung möglich war, sodass sie sie nicht aus schlechtem Gewissen heraus absagen konnten.
Also, rein formal gesehen verbringe ich Weihnachten ganz allein, es ist aber keine dieser traurigen Charles-Dickens-Geschichten.
»Wann fliegt ihr los?«, frage ich Jess auf dem Abstecher zur Fundstelle, um die Jacke abzugeben, ehe wir in den verregneten Nachmittag hinaustreten. Die Kinder sind längst fort und hoffentlich dabei, Lebkuchenhäuschen zu bauen oder noch Dinge für den perfekten Christbaum zu kaufen, und das Schulgelände wirkt unnatürlich still.
Jess spannt ihren roten Regenschirm auf, steckt die Handtasche auf ihren Rollkoffer und sucht ihr Handy. »Ich bestelle mir ein Uber hierher, hole dann Erik im Büro ab, und von dort fahren wir gleich zum Flughafen. Und du bist absolut sicher, dass du nicht mitkommen willst?«
»Definitiv. Abgesehen davon sagt mir mein Horoskop für heute voraus, dass ich vom Unglück gestreift werde. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, das hat sich inzwischen erledigt, weil mir am Morgen die Wimperntusche ins Klo gefallen ist, ich wäre aber trotzdem verrückt, mich nach einer solchen Vorhersage in ein Flugzeug zu setzen.«
Jess schaut mich ausdruckslos an, während sie auf die Uber-App tippt und sich einen Wagen bestellt. »Moment. Unsere Geburtstage sind nur vier Tage auseinander. Liegst du mir nicht immer damit in den Ohren, dass wir deshalb beste Freundinnen sind, weil wir beide … äh … was noch mal sind?«
»Zwillinge. Gutes Argument. Vielleicht solltest du auch lieber in New York bleiben.« Grinsend ziehe ich mir die Kapuze über den Kopf.
»Du hältst mich bestimmt für altmodisch, aber Weihnachten bedeutet für mich: ein großer krummer Baum im Wohnzimmer meiner Eltern und der Strumpf, den ich mit acht Jahren gestrickt habe, am Kaminsims. In mein Apartment passt noch nicht einmal ein Farn, geschweige denn ein Kamin.«
»Dann wünsche ich dir genau so ein Weihnachten.« Ich breite die Arme aus, um mich von ihr zu verabschieden
»Komm, komm. Mach schnell. Dein Auto ist da.«
»Noch dazu in Rekordzeit. Immerhin regnet es.«
Sie hebt den Regenschirm höher, und ich tauche darunter und umarme sie. »Fröhliche Weihnachten, Liebste.«
Sie drückt mich. »Wie viel Überwindung hat es dich gekostet, das Lied nicht zu singen?«
Als Antwort summe ich die ersten Takte von Karen Carpenters »Merry Christmas, Darling«.
»Hab ich’s mir doch gedacht. Na gut, der ist für mich«, sagt sie und nickt in Richtung eines schwarzen Honda. »Fröhliche Weihnachten, Sturkopf. Und tu mir einen Gefallen: Lass dich von jemandem flachlegen, ja?«
Den letzten Teil ignoriere ich. »Fröhliche Weihnachten. Und schick mir eine Nachricht, wenn ihr dort seid, damit ich weiß, dass dein Flugzeug nicht abgestürzt ist«, rufe ich ihr noch zu.
Ich winke dem abfahrenden Auto nach, und obwohl meine beste Freundin für die nächsten zwei Wochen abschwirrt, verspüre ich nicht einen Hauch von Traurigkeit.
Es ist Weihnachten, und vielleicht liegt es ja daran, dass ich meine Tage mit Acht- und Neunjährigen verbringe, aber ich fühle mich den Festtagen angemessen fröhlich beschwingt.
Und es schadet auch nicht, dass ich die kommenden zwei Wochen frei habe.
Wie ich schon sagte: Emory Academy befindet sich in Tribeca, einem trendigen, überteuerten Teil von Manhattan. Meine Teilzeit-Wohnung liegt im nahe gelegenen Finanzdistrikt, die Schule ist also leicht zu Fuß erreichbar.
Meine Wochenend-Wohnung aber, meine Ferienwohnung …
Die liegt oben im Norden des Bundesstaats.
Auf zum Bahnhof.
Im Gehen checke ich die Wetter-App meines Handys. Ich bin begeistert. Heute soll es zwar den ganzen Tag regnen, für morgen ist Schneefall allerdings nicht ausgeschlossen. Und nichts bringt mich so in Weihnachtsstimmung wie Schnee.
Der Zug fährt mir vor der Nase davon. Aber am Bahnsteig ist ganz in der Nähe leise »White Christmas« zu hören, und das Gedränge hält sich in Grenzen. Warten ist also nicht so schlimm, wie es hätte sein können.
Aus dem Augenwinkel entdecke ich eine Frau mittleren Alters, die unter der Treppe ihr Zelt aufgeschlagen hat. Das ist nicht so ungewöhnlich. Unter New Yorks Straßen findet man alle möglichen Leute, allerdings ist diese besser gekleidet als die meisten von ihnen. Sie trägt eine rote Hemdbluse, Jeans und Stiefeletten und hockt im Schneidersitz auf einer karierten Decke. In ihrem Haar stecken Zweige von etwas, das wie künstliche Rosen aussieht.
Nichts davon ist merkwürdig.
Merkwürdig ist allerdings, dass sie mich die ganze Zeit anstarrt. Intensiv.
Zögernd schauen wir uns in die Augen, und ich deute ein Lächeln an, ehe ich mich wieder auf mein Handy konzentriere.
Aber noch immer spüre ich ihre Blicke.
Keineswegs unfreundlich oder auf eine Art, dass ich überlegen müsste, ob ich auf dem Weg hier runter einen Polizisten gesehen habe, der mich hören könnte, wenn ich schreien würde. Sie macht auch nicht den Eindruck, als wolle sie mich gleich auf die Gleise schubsen. Und nachdem dies die geheime Angst jedes New Yorkers ist, kann sie einen Pluspunkt verbuchen.
Trotzdem beunruhigt mich ihr Starren. Ich schaue wieder hoch, und sie sucht sofort wieder Blickkontakt. Ihre dunklen Augen sind klar und konzentriert. Ich kann mich nicht entscheiden, ob das besser oder schlechter ist, als wenn ihr Blick irgendwie getrübt wäre.
Plötzlich lächelt sie mich an. »Kelly.«
Schlagartig bekomme ich eine Gänsehaut, die nichts mit dem kalten Wetter zu tun hat. Sie weiß, wie ich heiße.
»Komm her.« Sie winkt mich zu sich. »Komm her. Ich sehe.«
Jetzt denkt ihr bestimmt: Um Gottes willen, hau ab.
Und ich sollte dasselbe denken. Ein Teil von mir tut das auch, aber …
Um mich herum stehen ein paar Dutzend Leute. Keiner achtet auf mich, aber es ist nicht so, als würde ich mich allein in einer dunklen Gasse befinden.
Und schaut, wir haben ja bereits festgestellt, dass ich an den Wink des Schicksals mittels einer Magic-8-Kugel und an Horoskope glaube. Noch nicht erwähnt habe ich, dass ich zudem schwarze Katzen meide, die Nummer dreizehn scheue und niemals unter Leitern durchgehe.
Ich glaube auch, dass es so etwas wie die Sicht gibt. Ich weiß es sogar, denn meine Großmutter hatte diese Fähigkeit.
Grandma Shirley war eine dieser herrlich verrückten alten Damen, die die meisten Menschen als verschroben abtun, aber niemand kann abstreiten, dass sie gewisse Dinge wusste. Sie wusste, wann ich beim Fußballspielen gewinnen würde und mit wie vielen Toren. Sie wusste auf die Minute genau, wann ihre Katze werfen würde. Einmal sagte sie sogar ein Erdbeben voraus, obwohl die in New York wirklich selten sind.
Sie ist gestorben, als ich in der elften Klasse war (auch das hat sie bis ins Detail vorhergesagt), und obwohl ich ihre Gaben nicht geerbt habe, habe ich immer daran geglaubt, dass manche Menschen Dinge sehen und wissen, die ihnen eigentlich verborgen sein sollten. Ich nenne das die Sicht.
Ich gehe näher heran. Die Frau grinst und winkt mich weiter zu sich hin.
Ein paar Meter vor ihr bleibe ich sicherheitshalber stehen. Ich bin abergläubisch, aber nicht verrückt.
Die Frau beugt sich vor. »Du suchst nach Liebe.«
Huch. Ich bin nicht sonderlich beeindruckt. Suchen nicht die meisten Menschen nach Liebe? Stimmt schon, ich bin seit Kurzem Single, und das bin ich nicht gerade gern. Und manchmal übertreibe ich vielleicht ein bisschen die Suche nach dem Mann fürs Leben.
Aber ich höre von dieser Dame nichts weiter als ein paar Allgemeinplätze.
»Klar«, sage ich und bin schon am Weitergehen.
Sie hebt eine Hand. »Den einen, den du suchst? Den Mann für die Ewigkeit, die Liebe deines Lebens …«
Ich erstarre. Ihre Formulierungen gleichen meinen fast bis aufs Haar. Ein Zufall? Möglich. Trotzdem bleibe ich stehen, um zu hören, was sie mir mitzuteilen hat.
Sie lächelt. »Du hast ihn schon kennengelernt.«
Ich muss blinzeln. »Was? Ich glaube, du musst deine Kristallkugel reparieren lassen. Ich bin Single.«
Ihr Lächeln wird breiter. »Ich habe nicht gesagt, dass du kein Single bist. Ich habe gesagt, du kennst ihn schon. Du hast ihn aber gehen lassen. Er wird noch vor Weihnachten zu dir zurückkommen.«
Halt! Moment mal! Das ist …
Häh?
»Du willst mir erzählen, dass der Mann meines Lebens einer meiner Ex’ ist?«
Sie hebt beide Hände, als wolle sie sagen, jetzt hast du’s kapiert.
Ich unterdrücke einen Anflug von Enttäuschung. Ganz offensichtlich kennt sie meine Ex’ nicht. Ein paar ganz anständige waren ja dabei, die meisten aber waren ziemliche Blindgänger, und keiner von denen lässt mein Herz schneller schlagen. Außer vielleicht …
Nein. Nie. Fang gar nicht erst an.
Dankenswerterweise spüre ich das Dröhnen eines herannahenden Zugs. Ein Blick über die Schulter verrät mir, dass es meiner ist.
»Vielen Dank«, quetsche ich mit gezwungenem Lächeln heraus. »Fröhliche Weihnachten.«
»Schöne Ferien«, entgegnet sie mit einem Kopfnicken. Dann steht sie auf und packt ihre Decke zusammen. Offenbar hat sie einen Fingerzeig von Madison Meyers erhalten und hält sich strikt an die korrekten Formalien. Auch recht.
Ich winke ihr noch einmal und gehe auf den Zug zu, aber ihre nächsten Worte überziehen mich erneut mit einer Gänsehaut.
»Richte deinen Eltern alles Gute zum Hochzeitstag aus. Das dreißigste Jahr wird für sie was ganz Besonderes.«
Mein Kopf schnellt herum. »Woher weißt du …«
Die Frau ist fort.
Wie vom Erdboden verschluckt.
Und ich stehe da und frage mich …
Wenn eine mir völlig unbekannte Frau recht hatte mit dem Hochzeitstag meiner Eltern, hat sie dann auch mit dem anderen recht?
Bin ich meiner wahren Liebe schon begegnet?
Freitag, 15. Dezember, später Nachmittag
»Have yourself a merry little Christmas, have yourself a merry little Christmas, have yourself a merry little Christmas …«
Ich liebe dieses Lied – das ganze Lied – aber nur diese eine Zeile rauscht mir immer wieder durch den Kopf, deshalb ist es auch die einzige Zeile, die aus meinem Mund kommt.
Ein Autofahrer hupt freundlich, und ich winke, obwohl der Wagen schon vorbei ist, noch ehe ich einen Blick auf den Fahrer werfen kann. So ist das im Städtchen Haven, das ich die Hälfte der Woche mein Zuhause nenne. Es ist nicht so klein, dass tatsächlich jeder jeden kennt, aber klein genug, dass man so tun kann als ob.
Und jetzt fragt ihr: Moment, die halbe Woche? Was soll das denn jetzt heißen?
Es ist so … Geboren und aufgewachsen bin ich in Haven, aber wie so oft, wenn man die zwanzig überschritten hat und nur wenige Stunden von New York entfernt wohnt, bietet die Stadt, falls man einen Job sucht, mehr Möglichkeiten. Erst recht trifft das für Grundschullehrer in einem Ort mit einer einzigen staatlichen Schule zu – null Jobangebote.
Und ich jammere hier keineswegs rum, von wegen, dass ich in meiner Heimatstadt meinen Traumberuf nicht ausüben kann. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich bin nahezu begeistert, welchen Lauf mein Leben genommen hat. Ich liebe meine Arbeit in Manhattan.
Genauso liebe ich es aber auch, jedes Wochenende nach Haven zurückzukommen.
Denn: New York City ist ein geradezu unverschämt teures Pflaster, vor allem, wenn man mit einem Lehrergehalt auskommen muss. Die meisten meiner Kollegen wohnen außerhalb der Stadt, doch mit mir hat es das Schicksal in dieser Hinsicht gut gemeint. Ich teile mir ein Einzimmerapartment mit einer bildhübschen Rothaarigen namens Waverley. Sie ist Beraterin und von Montag bis Donnerstag auf Reisen (im Moment in London, aber auch schon in Dubai, Los Angeles und Amsterdam – und das bloß in diesem Jahr). Wir haben das große Schlafzimmer in zwei kleinere unterteilt und nutzen das Apartment nun abwechselnd. Ich wohne dort unter der Woche und sie am Wochenende, wenn ich nach Haven fahre.
So genieße ich alle Vorteile des Alleinseins und kann trotzdem die Kosten teilen. Brillant, oder? Und stimmt schon, ich muss am Freitagnachmittag und Montagmorgen lang pendeln, dafür kann ich meine Eltern jeden Sonntag sehen, die Abende an den Wochenenden bei Wein mit meinen Jugendfreundinnen verbringen und mich um das Haus kümmern, das meine Großmutter mir hinterlassen hat.
Und dann ist da noch mein Hund Rigby, der …
Na ja, Rigby lebt nicht die ganze Zeit bei mir. Man könnte sogar sagen, ich habe geteiltes Sorgerecht, eigentlich nur Besuchsrecht.
Und das kam so: Jedes Jahr helfe ich während der Sommerferien bei einem hiesigen Tierheim aus. Jedes Jahr sage ich mir, ich nehme keins der Tiere mit nach Hause, weil mein Apartment in Manhattan nicht haustierfreundlich ist. Und in meinem Haus in Haven kann ich keinen Hund lassen, wenn ich vier Nächte pro Woche weg bin. Ergo: kein Hund.
Doch dann brachte während meiner Schicht eine völlig entnervt wirkende Frau Rigby ins Tierheim. Rigby hatte deren Großmutter gehört, die überraschend verstorben war. Da der Rest der Familie entweder auf Katzen stand oder gar auf Hunde allergisch reagierte, hatte der Ärmste plötzlich kein Zuhause mehr.
Ich meine, keins der Tiere im Heim hat ein Zuhause, aber … falls ihr jemals ein Haustier gehabt habt, dann wisst ihr, dass manchmal ein Tier das gewisse Etwas hat.
Und außerdem: Als Kind hatte ich mir immer einen Hund gewünscht, und meine Eltern haben mich stets auf irgendwann vertröstet. Und bevor ich noch kapierte, dass »irgendwann« in Elternsprache »niemals« bedeutet, hatte ich für meinen Irgendwann-Hund schon einen Namen gewählt: Rigby. Und ich wollte immer einen Cocker Spaniel.
Schnellvorlauf zu jenem Tag im Tierheim: Hier war ein Cocker Spaniel namens Rigby, der ein Zuhause brauchte. Ein Zeichen.
Wie wir ja schon festgestellt haben, messe ich Zeichen eine große Bedeutung zu.
Also legte ich mir einen Plan zurecht. Ich nahm Rigby mit zu mir nach Hause, wo er den Rest der Sommerferien auch blieb, abgesehen von zahlreichen Besuchen bei Mark – meinem besten Freund –, dessen Garten hinten an meinen grenzt.
Mark Blakely ist so ein typischer Hundemensch. Er trägt strapazierfähige Jeans, hat ein Haus und einen großen Garten und verliert nicht gleich die Nerven, wenn er auf seinem Bett Hundehaare entdeckt.
Dann, am ersten Septembermorgen, an dem ich wieder zur Arbeit musste, tauchte ich an Marks Tür auf, mit zwei Paar Hundeaugen: meine und Rigbys.
Er nahm sich des Hunds an. Er hatte sogar, schon bevor ich auf der Matte stand, Schüsseln und ein Körbchen besorgt und eine Hundetür eingebaut, weil er so etwas bereits geahnt hatte. Bester Freund eben.
Ich hüpfe die Stufen zu Marks Haustür hoch und wechsle von meinem geflüsterten Weihnachtsliedchen über zu »Jingle Bells«.
Marks Haus steht praktisch in meinem Garten. Rein formal gesehen sind unsere Gärten von einer unsichtbaren Grundstücksgrenze getrennt, aber da weder er noch ich je einen Zaun, eine Hecke oder Ähnliches errichtet haben, ist es im Grund genommen eine einzige gemeinsam genutzte Rasenfläche. Ich glaube, wir reden uns ein, das komme vor allem dem Hund zugute, es hat aber auch noch andere Vorteile – sich eine Tasse Zucker (lies: Wein) leihen und anderes. Und es ist immer jemand zum Reden da, wenn uns danach ist. Üblicherweise bin das allerdings ich. Mark ist nicht unbedingt der große Plauderer.
Von außen sieht Marks Haus wie meines aus – klein, ein bisschen altmodisch. Innen allerdings ist seins unglaublich. Erst kürzlich hat er das komplette Erdgeschoss renoviert, und ich mag ein klein wenig neidisch sein. Er hat die alte schmale Veranda, die ums ganze Haus führte, weggerissen und sie durch eine doppelt so große ersetzt. Dort stehen jetzt ein breiter Holzschaukelstuhl und zwei bequeme Gartensessel. Außerdem hat er einen schnieken Mechanismus eingebaut: Man lässt eine Vorrichtung herunter und kann dann auch draußen sitzen, wenn es schneit, und man bleibt trotzdem trocken.
Wenn ich ihn jetzt noch überreden könnte, ein paar Tausend Christbaumkerzen aufzuhängen …
Ich öffne Marks Hintertür und gehe ohne anzuklopfen hinein (wir sind hier in Haven, da hat man es nicht so mit Schlössern). Es ist Freitag, vier Uhr, was bedeutet, er ist unten in seinem Restaurant und bereitet alles für ein geschäftiges Wochenende vor. Dort gibt es das beste Essen in der ganzen Stadt. Bei dem Urteil könnte ich befangen sein, aber das glaube ich nicht. Cedar and Salt hat vor eineinhalb Jahren aufgemacht, und es ist seit Beginn praktisch unmöglich, dort ohne Reservierung einen Tisch zu bekommen.
Leise summe ich »Let it Snow« und rufe Rigby. Normalerweise begrüßt mich mein Hund schon an der Haustür, und angesichts des aktuellen Mangels an schlabberigen Hundeküssen runzele ich die Stirn.
Kurz darauf marschiere ich in eine ganz andere Art von Kuss.
»Großer Gott!« Ich bedecke die Augen mit der Hand und mache auf der Stelle kehrt, um den beiden ihre Privatsphäre zu lassen. »Oh mein Gott, es tut mir so leid, und ich bin auch schon weg …«
Ich höre gemurmeltes Fluchen (Mark) und ein verlegenes Kichern (Sheila).
»Ist schon gut, Kelly, ich war gerade am Gehen.«
»Warst du nicht«, widerspreche ich Marks Freundin, ohne mich umzudrehen, die Hand immer noch vor Augen. »Ich weiß, was ich gesehen habe, und das hatte mit Gehen nichts zu tun.«
»Ich habe mich nur verabschiedet. Ehrlich«, erwidert Sheila.
»Wirklich?«, frage ich neugierig und nehme die Hand von den Augen weg, um die Wand anzuglotzen. »Weil, ausgesehen hat es wie …«
Ich höre Mark knurren und halte klugerweise sofort den Mund. Etwas trifft mich in die Kniekehlen, sodass ich leicht nach vorn stolpere. Grinsend beuge ich mich runter und begrüße Rigby.
»Da ist er ja, braver Junge.«
Der schwarze schwanzwedelnde Cocker Spaniel springt aufgeregt um meine Füße herum und macht begeisterte Geräusche, soweit es der enorme Knochen in seinem Maul zulässt. Ein Riesenknochen.
»Na, kein Wunder, dass du mich nicht begrüßt hast.« Ich kraule seine seidenweichen Ohren. »Sieht aus, als wäre der Weihnachtsmann zu dir schon früher gekommen, was?«
Er rollt sich auf den Rücken, damit ich ihn am Bauch tätscheln kann. Alles, ohne den Knochen loszulassen.
»Bis dann, Kelly.«
Ich schaue hoch und sehe, wie Marks Freundin sich in ihre Daunenjacke zwängt.
»Nein, bleib nur, ich gehe.«
»Ja, genau«, meldet sich Mark von hinten.
Wir Frauen ignorieren ihn. Rigby trottet zu Sheila und rammt ihr zum Abschied den Knochen gegen das Knie.
Sie tätschelt ihn vorsichtig am Kopf. Sheila hat es nicht so mit Hunden, Aber Mark zuliebe gibt sie sich Mühe, das muss ich ihr lassen. »Nein, ich wollte wirklich aufbrechen«, sagt sie. »Ich muss ohnehin zum Flughafen.«
»Ach, stimmt ja. Mark hat mir erzählt, dass du in den Ferien deine Verwandtschaft väterlicherseits besuchst. In Atlanta?«
»Ja, gutes Gedächtnis.« Sanft schiebt sie Rigbys Pfote von ihrer Jacke.
»Ist doch schön. Soll ich dich zum Flughafen fahren?«, frage ich.
Ja, ja, schon gut. Ich übertreibe maßlos, vor allem, weil Sheila und ich uns gar nicht so gut kennen. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass die Welt des Datings voller Fallstricke ist, wenn der beste Freund dem anderen Geschlecht angehört. Deshalb gebe ich mir alle Mühe, Marks Freundinnen nicht das Gefühl zu vermitteln, ich würde eine Bedrohung darstellen.
Und ich mag Sheila. Ich meine, ich habe da so meine Zweifel, ob Mark und sie es über eine längere Distanz schaffen, aber nur weil sie ein Skorpion und somit nicht die ideale Partnerin ist für Mark, Sternzeichen Jungfrau. Es ist auch nicht die schlechtestmögliche Paarung – das wäre ein Zwilling wie ich etwa. Es ist nur … na ja egal, das müssen die beiden selbst herausfinden. Hat mir jedenfalls Mark gesagt.
»Nein danke, ich bin versorgt«, antwortet sie und lächelt amüsiert. »Schöne Feiertage.«
»Dir auch!«, sage ich. Sheila geht nochmals zu Mark, wahrscheinlich um ihm einen langen Abschiedskuss zu geben, und ich beuge mich wieder nach unten, teils, um mich wieder Rigby zu widmen, teils, um den beiden ein bisschen Privatsphäre zu verschaffen.
Eine Minute später höre ich Marks Haustür zufallen. Ich richte mich auf und mache mich auf Marks Ärger gefasst, den ich voll verdiene.
Er holt ein Bier aus dem Kühlschrank und hält die Flasche über die breite Schulter nach hinten, als stilles Angebot an mich.
»Nein danke.« Ich lass mich auf einen Barhocker an seiner Kücheninsel plumpsen.
Er macht den Kronkorken ab und wirft ihn in den Müll. Dann dreht er sich zu mir um.
Ich lächele ihn verlegen an. »Ich hätte klopfen sollen.«
Mark zuckt mit den Schultern und trinkt einen Schluck Bier. »Vermutlich.«
»Zu meiner Verteidigung: Es ist Freitagnachmittag, ich habe gedacht, du wärst im Restaurant.«
»Zu meiner Verteidigung … mein Haus.«
Ich schürze die Lippen. »Gutes Argument.«
»Allerdings.« Er setzt die Bierflasche wieder an. »Was machst du so früh schon hier?«
Normalerweise komme ich freitags erst spätabends nach Haven, und Mark und ich haben die Routine entwickelt, uns gegen Mitternacht auf einen Käsetoast zu treffen, wenn er das Zusperren seines Lokals seinen Angestellten überlässt und nach Hause fährt, um selbst etwas zu essen, nachdem er zuvor die halbe Stadt verköstigt hat.
»Letzter Schultag vor den Ferien. Die Kinder sind mittags nach Hause.«
»Ach ja, stimmt. Kein Wunder, dass du so gute Laune hast.«
Ich habe tatsächlich gute Laune, und seine Bemerkung hat mich wieder an den Grund dafür erinnert.
»Rat mal, was mir am Bahnhof passiert ist!« Aufgekratzt beuge ich mich vor.
»Hm?«, fragt er, deutlich weniger aufgekratzt.
»Okay, versprich mir, dass, wenn ich es dir sage, du nicht die Augen verdrehst und mich für eine Irre hältst.«
»Nein.«
So etwas habe ich erwartet.
Ich will es mal plastisch formulieren: Mark Blakely, knapp eins neunzig groß, dunkles Haar, dunkle Augen, durchtrainiert, trägt Levi’s und Baumwollhemden, ist sarkastisch und nüchtern, Sternbild Jungfrau, zufällig ein richtig guter Koch. Glaubt nicht an Schicksal, Zufall oder Glück.
Ich: Kelly Byrne, Alter: 27, gut eins sechzig, fülliger als mir lieb ist, vor allem um die Taille herum. Dichtes, blondes halblanges Haar. Später Zwilling mit starkem Interesse an Tarotkarten, Magic-8-Kugeln, Astrologie …
Von außen betrachtet ist es ein Wahnsinn, dass wir seit der Oberstufe der Highschool beste Freunde sind. Seine Eltern sind im Sommer vor der letzten Klasse von Vermont hierher gezogen. Als Klassensprecherin war es an mir, den Neuen herumzuführen und ihm die Schule zu zeigen. Er war ruhig und ein bisschen ätzend. Ich war quirlig und hartnäckig.
Das ist der äußere Rahmen, von dem jeder weiß und der auch vollkommen wahr ist.
Es gehört aber noch ein wenig mehr dazu.
Physik war das einzige Fach, das Mark und ich im letzten Schuljahr gemeinsam hatten, und wir saßen nebeneinander. Allein waren wir beide eher Durchschnitt, gemeinsam schafften wir es in den Bereich zwei plus, eins minus. Normalerweise büffelten wir bei mir zu Hause, aber eines Sonntags, Mitte November, beschlossen meine Eltern, vor Erntedank die alten Parkettböden renovieren zu lassen. Ein, zwei Tage mussten wir aus dem Haus raus. Mark und ich hatten die Klassenarbeit, die am Montag darauf fällig war, ein wenig schleifen lassen, die Bibliothek war geschlossen, also … sein Haus.
Er hatte immer darauf geachtet, dass ich seinem Zuhause nicht zu nahe kam, aber das wurmte mich nicht. Mein Instinkt sagte mir, er wollte eher mich vor seinem Zuhause schützen als sein Zuhause vor mir.
Mein Instinkt hatte recht. Mark sprach nie über seine Schwester, deshalb nahm ich immer an, sie sei entweder sehr viel älter oder sehr viel jünger als er und sie stünden sich einfach nicht so nahe.
An jenem verregneten Sonntag erfuhr ich, dass sie sich sehr wohl nahestanden. Emily war zwei jünger als wir und … krank. Meine Tante Ida hatte ihren Brustkrebs überlebt, deshalb dachte ich, ich verstünde etwas von der Krankheit. Aber da hatte ich mich fürchterlich getäuscht.
Zuzusehen, wie der Krebs eine Sechzehnjährige dahinrafft, war eine ganz andere Sache.
Ich verbrachte nicht viel Zeit mit Emily. Sie wurde daheim unterrichtet, seit sie ihre Chemotherapie bekam, was regelmäßigen Schulbesuch unmöglich machte. Sterben müssen und das allein – der Gedanke war für mich nahezu unerträglich.
Mark meinte zwar, so schlimm sei es nicht. Sie würde sterben, das schon, sie sei aber nicht allein. Offenbar war Emily schon vor der Diagnose eher eine ruhige Einzelgängerin. Sie ist an diesem ersten Tag oder an den wenigen Tagen danach nicht unfreundlich zu mir gewesen, nur … distanziert. Als sei es ihr völlig egal, ob Marks Freundin im Haus war oder nicht. Ihr schien es nicht einmal wichtig, ob Mark in der Nähe war.
Ihn belastete das. Er sagte nie etwas und versuchte, es immer zu verbergen. Als sie ihm für das Armband, das er (na ja, wir