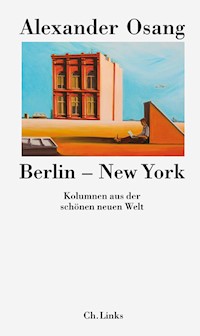9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Literarische Publizistik
- Sprache: Deutsch
Alexander Osang hat seit 1989 den Weg der Ostdeutschen mit besonderer Aufmerksamkeit publizistisch begleitet. In seinem neuen Buch geht es darum, auf welch unterschiedliche Weise die Menschen nach den Jahren des Umbruchs und der Fremdheit allmählich in der Bundesrepublik Deutschland ankommen. In der ihm eigenen Weise zeichnet er mit präziser Beobachtungsgabe, intelligentem Sarkasmus und gleichzeitiger Herzenswärme die Porträts von Akteuren aus ganz unterschiedlichen Milieus. Es gibt Gewinner, Anpasser und Verlierer, aber auch das aufrichtige Bemühen um eine neue Positionsbestimmung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Alexander Osang
Ankunft in der neuen Mitte
Reportagen und Porträts
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
1. Auflage als E-Book, Mai 2018
entspricht der 3. Druckauflage vom Oktober 2000
© Christoph Links Verlag GmbH
Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0
www.christoph-links-verlag.de; [email protected]
Cover: KahaneDesign, Berlin
unter Verwendung eines Fotos von Maurice Weiss/Ostkreuz
eISBN 978-3-86284-419-7
Inhaltsverzeichnis
Freitag nacht im Reich der neuen Mitte
Vorwort
Die Poesie des Kommerzes
Ein einsamer Tango, ein verhinderter Puff, ein rastloser Russe, ein lila Flur. Die Friedrichstraße ist länger als das Lafayette. Und anders.
Die verlorenen Revolutionäre
Eine Herbstreise
Guten Morgen, Berlin!
Der härteste Radiomarkt Europas und seine fröhlichen Frühstücksprogramme
Rom fühlt sich nicht zuständig
Seit acht Jahren versuchten sich zwei Kirchenchöre aus Berlin zu vereinigen. Jetzt haben sie sich getrennt.
Im Osten geht die Sonne auf
Samsung möchte auch seine Berliner Werktätigen in die »große Familie« aufnehmen.
Pralinen welken nicht
Im Berliner Arbeitsamt VI verwalten etwa 500 Mitarbeiter einen »Bestand« von 23 907 Arbeitslosen.
Ansonsten, wo soll man hin?
30 000 Autos fahren täglich durch die schmale Brückenstraße in Berlin-Mitte. Es gibt Dreck, Gift, Krach. Und ein paar Anwohner.
Mißverständnisse in Rathenow
Gehört man zum »toleranten Brandenburg«, oder ist man »national befreite Zone«?
Deutscher Ketchup ist gut
Eine Winterreise über die Oder
Die Freude am Schachspiel
Angela Merkel ist die einzige ostdeutsche Politikerin, die sich durchgesetzt hat.
Schabowskis Schuld
Eine Reise in die Vergangenheit, ein Prozeß und die Schwierigkeit, gerecht zu sein
Ein brauchbarer Held
Mit dem ehemaligen Radrennfahrer Täve Schur möchte die PDS ein Symbol in den Bundestag delegieren. Die Frage ist, was es bedeuten soll.
Der kritische Punkt
Der beste Skispringer der Welt, Jens Weißflog, kehrt in seine Heimatstadt Oberwiesenthal zurück.
Das einfache Lottchen
Charlotte von Mahlsdorf hat ihr Leben aus vielen Geschichten zusammengesetzt. Keiner weiß, ob sie stimmen. Aber sie klingen gut.
Wodkatrinker unter Wodkatrinkern
Die Volksbühne gastierte mit »Ernst Jünger« und »Pension Schöller: die Schlacht« in Belgrad.
Wie groß ist Europa?
Ein Pfarrer, die rotarische Idee und globale Gedanken in Havelberg
Filzhüte in der Wüste
Es stinkt. Es ist teuer. Und trotzdem ist es voll. Was suchen die Menschen auf der Grünen Woche?
Sankes erobern die Welt
Ein Ehepaar aus Prenzlauer Berg flog zu seinem 40. Hochzeitstag für drei Tage nach New York.
Die Heimat hat sich schön gemacht
Ein kleiner, aber öffentlicher Streit darüber, wie wichtig die Fernsehzeitschrift F.F. dabei für die ostdeutsche Seele war.
Quellennachweis
Fotonachweis
Über den Autor
Freitag nacht im Reich der neuen Mitte
Vorwort
Als ich aus dem U-Bahnhof Friedrichstraße ins Freie stieg, war alles wie immer. Es war ein Freitag abend im Januar. Gut, es war der letzte Januar dieses Jahrtausends, und dies war die Mitte Berlins. Aber daran habe ich wirklich nicht gedacht. Noch nicht.
Die Würfelhäuser fügten sich, die Straße wurde fertig. Im Kulturkaufhaus Dussmann bewegten sich die Abendkunden langsam zwischen den bunten Bücherregalen, die Straße glänzte feucht, die Autos dampften in der Enge. Hinter der S-Bahn-Brücke, an der früher die rote Leuchtreklame des Neuen Deutschlands befestigt gewesen war, leuchtete jetzt das Focus-Logo. Auf den Stufen zum Tränenpalast, gleich neben der Wand, auf der ein hübscher nackter Frauenkörper einen Hechtkopf tragen muß, stand ein junger Polizist einem alten Trinker gegenüber. Der Trinker brüllte den Polizisten an, der Polizist wackelte unsicher. Der Tränenpalast sah aus, als habe er geschlossen. Das Glas der Türen schimmerte matt und schwarz, aber sie waren offen. Meine Schritte hallten über den leeren, dunklen Gang. Hinter der Garderobe stand ein junger Mann, der mich mitleidig musterte, als ich eine Karte verlangte. Neben ihm lag ein Stapel weißer Blätter, die alle mit der gleichen Nachricht bedruckt waren.
»Leider findet heute Abend das ROCKHAUS-Konzert nicht statt; Grund: ROCKHAUS hat sich wegen innerer Querelen vorzeitig verabschiedet und hat das Konzert abgesagt!!! Ihr tRÄNENpALAST-Team«
Mein Tränenpalast-Team. Auch das noch. Ich war von Teams umzingelt. Kindergärtnerinnenteams. Kantinenteams. Zugbegleiterteams. Im letzten Sommer stand eine Frau vom »Jugendgesundheitsteam Mitte« vor unserer Wohnungstür. Sie hatte »Informationen rund ums Baby« dabei. Team klang beunruhigend. Es klang wie: Wir stehen hier, und du stehst da, und so wie es aussieht, bist du allein. Kollektiv hörte sich wenigstens so an, als sei es nicht ernst gemeint. Ach Scheiße, ich hatte Rockhaus sehr gemocht. Vorzeitig verabschiedet! Wahrscheinlich hielt das Tränenpalast-Team das für witzig.
Aber die Zettel für das Rockhaus-Konzert bezogen sich auf morgen. Bereits gestern war ein Konzert ausgefallen, das von André Herzberg. Heute abend sollte er aber auftreten. André Herzberg war der Sänger der Rockband Pankow. Vielleicht die beste Band, die die DDR hervorgebracht hatte. Pankow hatte sich vor ein paar Wochen aufgelöst. Vorzeitig verabschiedet. Herzberg war der letzte der Mohikaner. Ich zahlte 25 Mark für die Karte und ließ vorsichtshalber die Jacke an.
Vor der Bühne standen ein paar silberfarbene Stühle und Metalltischchen, auf denen Getränkekarten lagen. Die meisten Tische waren unbesetzt. Aus den Lautsprechern lief das Hauff-Märchen »Zwerg Nase« von einer knisternden Litera-Schallplatte. Es waren 26 Gäste da. Herzbergs blonde Managerin zählte nicht und ich eigentlich auch nicht. Blieben 24. Ich holte mir ein Bier und setzte mich hinter ein älteres Paar, das aussah, als sei es vom Weg in den Friedrichstadtpalast abgekommen. Vor der Frau stand ein buntes Mixgetränk, aus dem ein glitzernder Strohhalm ragte, der Mann trug eine exakte schlohweiße Frisur, ein kleinkariertes Jackett und hatte die Beine übereinander geschlagen. Vielleicht war ich ja auch falsch. Vielleicht würden dort vorn gleich ein paar Nackttänzerinnen erscheinen.
Wahrscheinlich ahnte ich jetzt, daß es doch der letzte Januar des Jahrtausends war. Die letzten Tage.
»Strange Days« hieß der Film, den James Cameron vor »Titanic« gemacht hatte. Fremde, verückte, irre, unwirkliche Tage. Die letzten Tage des Jahrtausends in Los Angeles. »Silvester 1999. Ein schlechter Tag zum Sterben«, hatte auf den Filmplakaten gestanden. Ich hatte nie verstanden, was das bedeuten sollte. War nicht jeder Tag ein schlechter Tag zum Sterben? Womöglich war Silvester 1999 besonders schlecht zum Sterben, weil man in der ganzen Aufregung nicht vermißt würde. Man starb unbemerkt.
Im Oktober hatte mich Herzberg gefragt, wie man seinen Tod in die Zeitung kriegen könnte. Er wollte für die Öffentlichkeit sterben, ein paar Wochen untertauchen und im Januar wieder auferstehen. Wahrscheinlich hatte er an Kurt Cobain gedacht, an Gerhard Gundermann. Oder wenigstens an Kunzelmann, den verschollenen Kommunarden. Und er hatte wohl auch daran gedacht, daß dies eine letzte Chance sein könnte. Es war in den vergangenen Jahren nicht so besonders für ihn gelaufen. Wir hatten in seiner Küche gesessen, Herzberg hatte die Details seines Todes diskutiert, seine Augen hatten geleuchtet, und ich hatte nicht den Mut gehabt, ihm das auszureden. Es ist ein Traum, anderen dabei zuzusehen, wie sie um dich trauern. Wie Huck Finn es konnte. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, daß sie nicht trauern würden.
Vielleicht hat Herzberg diese Möglichkeit dann doch in Betracht gezogen. Er war jedenfalls nicht gestorben. Er stand jetzt hinter der Bühne und wußte wohl, daß es wieder nicht voll geworden war. Es war der dritte von vier Abenden, an denen er sein neues Programm vorstellte. Die Premiere war noch gut besucht gewesen. Gestern hatte er den Auftritt ausfallen lassen, weil nur 25 Leute da waren. Einer mehr als heute. Herzberg fragte sich vielleicht, woran das lag. Warum, zum Teufel, verstanden sie ihn nicht? Dann zog er den Bauch ein, vergaß das alles und ging raus.
Ich sah, wie sich Herzbergs Managerin zu einem Seitenausgang schlich. Ich wäre ihr gern gefolgt. Ich hatte das Gefühl, zurückgelassen zu werden. Zurückzubleiben. Das ist kein gutes Gefühl, vor allem nicht, wenn man sich gerade in der Mitte Berlins befindet.
»Ich will dabeisein«, sang Herzberg eine gute halbe Stunde später. »Dabeisein, dabeisein.« Er hatte eine bunte Federboa um den Hals, in seinen Augen flimmerte der Irrsinn, und er hatte verdammt recht. Auch wenn es nur 25 Leute hörten.
Ein Freund von mir bewahrt einen Artikel einer unbedeutenden Zeitschrift auf, in dem er als geistiger Kopf der neuen Mitte geführt wird. Als einer der geistigen Köpfe, um genau zu sein. Einer von vielen geistigen Köpfen. Vätern. Gründern. Gründervätern. Eine Liste von Menschen, die in Berlin arbeiten, sie könnte aus Katalogen, Telefonbüchern und Impressen zusammengeschrieben worden sein, eine zufällige Visitenkartensammlung, die der Autor nach einer zweiwöchigen Haupstadtfeuilletonrecherche in seinen Jackettaschen fand, die Gästebücher eines literarischen Salons und einer Volksbühnenpremiere oder was weiß ich. Und mittendrin taucht plötzlich mein guter alter Kumpel auf. Er hat die Stelle mit Leuchtstift markiert. Der Zeitungsausriß ist schon etwas abgegriffen. Er liegt seit Monaten scheinbar achtlos auf seinem Schreibtisch herum. Immer ist ein Zipfel zu sehen, bei Bedarf zieht er ihn hervor. Eine Trumpfkarte.
Nicht, daß mein Freund wüßte, wo sie liegt, diese neue Mitte. Keiner weiß das. Aber es ist gut dabeizusein. Neue Mitte klingt nämlich so, als sei dort nur begrenzt Platz. Eine Art erster Klasse. Eine Insel. Ein Hochstand, von dem man ohne Hast und Angst auf die alte Mitte herabsehen kann und auf die Außenränder, die am Horizont verschwimmen. Die S-Klasse im Land. Der Rolls Royce unter den Mitten. Jeder will dabeisein, wenn sich die neue Mitte findet.
Ein Sog geht von ihr aus. Oder ein Druck. Je nachdem. Die neue Mitte ist Zeit und Raum und Chance. Sie ist hier, ganz in der Nähe, und sie ist jetzt.
Das Jahrtausend geht zu Ende, in Berlin wächst ein neues Zentrum heran. Europas Zentrum, wenn nicht das der Welt. All diese Bilder einer explodierenden, glänzenden Metropole, die man aus dem Stern klappen konnte. Die Infobox am Leipziger Platz, groß, aber schon als Provisorium gebaut, wie der ganze Potsdamer Platz nur ein Übergangsphänomen zu sein scheint. Aufgebaut als Kulisse für irgendeinen Hollywoodfilm, in dem Kometenhagel, Wirbelstürme oder die Faserraketen der Außerirdischen die Innenstädte zerplatzen lassen. Schröder ist der richtige Mann, um am Independence Day in den Düsenjäger zu steigen. Lächelnd zum letzten Gefecht. All die Poster und doppelseitigen Illustriertenbilder der letzten Monate lassen darauf schließen. Die Arme V-förmig gespreizt, Zeige- und Mittelfinger bilden zwei weitere Sieges-V, dahinter die rote, aufgehende Sonne, eher japanisch als sozialdemokratisch, und schließlich das Gewinnergrinsen. Man muß da mit, oder man wird überrollt. Im vorigen Sommer machte ich die Zentrumsschiffsfahrt mit der Weißen Flotte. Als wir mit dem kleinen Dampfer an der Regierungsbaustelle vorbeidümpelten, kam ich mir vor wie Sam Neill bei seiner ersten Fahrt durch den Jurassic Park. Was ich sah, schien so beängstigend, so unbeherrschbar. Und gleichzeitig so großartig, so gewaltig. Wenn ich an der Baustelle des Außenministeriums vorbeifahre, denke ich an Joschka Fischer. Wie fühlt man sich, wenn man diese riesigen Kasten sieht, die für einen gebaut werden? Ich könnte kein Auge mehr zumachen. Vor Aufregung und vor Angst.
Mein Blick hetzt durch Artikel, die die Hoffnungs- und Führungskräfte der neuen Mitte auflisten, die die Generation Berlin benennen. Ich würde zwar keine Funktion übernehmen wollen, ich wäre lieber Hoffnungs- als Führungskraft, aber ich wäre gern dabei. Ich hätte gern einen Platz, ein Ticket. Irgendeine Stange, an die ich mich klammern kann, wenn es richtig losgeht. Bis jetzt hat es noch nicht geklappt, aber ich will nicht undankbar sein. Radio Eins hat kürzlich angefragt, ob ich ihnen die beste Single, den besten Sänger und die beste LP aller Zeiten für eine Art Prominentenhitparade nennen könnte. Ich konnte mich nicht entscheiden, aber ich wurde gefragt. Es ist gut, gefragt zu werden. Ich fürchte nur, daß man irgendwann mal eine Antwort braucht. Eine mir unbekannte Hamburger Zeitschrift wollte von mir einen Text mit dem Titel »Die Rückkehr der Edelfedern« haben, den ich nicht schreiben konnte, weil ich gar nicht bemerkt hatte, daß sie weg waren, die Edelfedern. Aber sie hielten mich in Hamburg für kompetent, die Bewegungen der Edelfedern zu beurteilen. Und ich bin einer von den 99 Köpfen dieses Jahres, die das Berliner Stadtmagazin Zitty auswählte. Meret Becker ist auch dabei. Aber auch Kunzelmann, der scheintote Provokateur, was mich etwas beunruhigt.
Mein Verleger Christoph Links ist Mitglied der »Generation Berlin«, die der Tagesspiegel zusammengestellt hat. Das ist natürlich besser. Erst recht, wenn man weiß, daß der Tagesspiegel die Serie »Generation Berlin« nach nur zehn Teilen eingestellt hat. Christoph Links ist einer von zehn. Das ist fast so was wie ein ewiger Weltrekordhalter. Ein Uwe Hohn der deutschen Hauptstadt. Die glorreichen Zehn. Sie reiten wieder. Aber Links zuckt nur mit den Schultern, wenn man ihn daraufhin anspricht. Ich fürchte, er weiß es nicht zu würdigen.
Vor einem knappen Jahr war eine Frau von der Zeit in der Stadt, um ihre »Generation-Berlin«-Mannschaft zusammenzustellen. Sie hat sogar die Restaurants genannt, in denen die »Generation Berlin« zusammenhockt. Mich würde interessieren, welche Shampoos sie benutzt, welches Olivenöl und welche Schneider. Die Recherchen der Hamburger Kollegin ergaben, daß sich die »Generation Berlin« in Touristenkneipen trifft. Sie ist demnach neu in der Stadt. Aber wie lange bleibt sie?
Scheidet man aus, wenn man die Stadt verläßt? Ruht die Mitgliedschaft, wenn man zwar in der Stadt wohnt, aber bei einem auswärtigen Arbeitgeber beschäftigt ist? Oder ist es vor allem eine Frage des Alters? Wann entwächst man der »Generation Berlin«? Trifft für sie zu, was mein ehemaliger Chefredakteur Michael Maier über erfolgreiche Journalisten gesagt hat? »Unter Vierzig sollten sie schon sein«?
Ich hätte Roß fragen können.
Der Sachbuchredakteur und -autor Jan Roß gehörte damals zum »Generation«-Team. Er schrieb für die Berliner Zeitung, ist inzwischen aber zur Zeit gewechselt, die in Hamburg erscheint. Ich weiß nicht, ob sein Platz am »Generation-Berlin«-Tisch dadurch freigeworden ist.
Ich traf Jan Roß vor kurzem auf dem CDU-Parteitag in Bonn. Er schwebte die Treppe zum Großen Saal des Konrad Adenauer Hauses empor. Roß gehört zu den Menschen, die beim Laufen nur die Beine bewegen, während der Oberkörper aufrecht bleibt, als rolle er auf Rädern durch die Gegend. Er wirkt dadurch sehr unabhängig, sehr entschlossen. Er bremste kurz vor mir und erzählte etwas, das aus seinem letzten Leitartikel hätte stammen können, während er die abgewählten CDU-Politiker belustigt musterte. Ich schwieg, nickte und versuchte, so zu gucken, als würde ich begreifen, worum es ging. Wir sprechen irgendwie nicht dieselbe Sprache. Roß dachte wahrscheinlich über die Funktion einer christlichen Volkspartei im nächsten Jahrtausend nach, ich bedauerte den ehemaligen Minister Rüttgers, der ganz allein in der Ecke stand. Das machte den Unterschied. Deswegen befand ich mich unter den 99 Zitty-Köpfen und er in der Zeit-Mannschaft. Später sah ich ihn auf eine junge, hübsche Frau einreden. Ich habe mich nicht erkundigt, wie er in die »Generation Berlin« geraten ist und ob er sich da wohlfühlt. Vielleicht hat man ihn gar nicht gefragt, ob er mitmachen will. Er ist ausgesucht worden wie Christoph Links oder Tom Tykwer. Aber wenn ich alles richtig verstanden habe, paßt Roß, ob er nun will oder nicht, rein äußerlich ganz gut dazu. Er trägt kleinkarierte Jacketts, eine altmodische Brille und eine Frisur wie Dieter-Thomas Heck. Ich habe nie einen Mittdreißiger erlebt, der mehr wie ein Endvierziger aussieht. Der Witz ist, Roß würde das wahrscheinlich als Kompliment auffassen.
Ich glaube, daß die »Generation Berlin« gern älter aussehen möchte, als sie ist. Sie kann komplizierte Fragen schnell beantworten. Sie lächelt weise. Vielleicht ist das sogar ihr wesentlichster Zug. Dieses nachsichtige, weise Lächeln. Sie ist ohne Zweifel.
Wenn ich ein »Neue-Mitte«-Team nominieren müßte, wäre Mathias Döpfner auf jeden Fall dabei. Döpfner ist ein Jahr jünger als ich, war aber schon Chefredakteur bei drei Zeitungen. Zuerst leitete er die Wochenpost, dann die Hamburger Morgenpost, gerade ist er bei der Welt. Ich kenne ihn von Partys einer Freundin, ein jungenhafter, schlaksiger Mensch, der lustig sein kann. Aber beim letzten Mal, es war ein Sommerfest in Brandenburg, begann er schon so zu reden, als sei er in die Zeitmaschine geraten. So offiziell. So würdig. So pfeifenrauchermäßig. Ich glaube, er lief sogar ein bißchen steifer. Kurz danach übernahm er die Welt. Seitdem habe ich ihn schon zweimal im »ARD-Presseklub« gesehen. Beim ersten Mal saß er neben Johannes Gross, einem konservativen Publizisten. Einem sehr konservativen Publizisten. Gross verfaßt Aphorismen, was auch nicht für ihn spricht. Er ist klein und alt. Etwa doppelt so alt wie Döpfner und nur halb so groß. Aber im »Presseklub« sah es so aus, als seien sie zusammen zur Schule gegangen. Sie hockten auf der Parkbank wie zwei alte Männer, die jeden Nachmittag die Welt neu aufteilen. Beim zweiten Mal erschien Döpfner ohne Gross. Es ging um die Berliner Republik. Döpfner zitierte Gross, seinen Kumpel aus dem Altersheim, redete Zeugs und lächelte ein weises, nachsichtiges Lächeln, das überhaupt nicht jungenhaft war.
Es hätte auch um den Golfkrieg gehen können, die doppelte Staatsbürgerschaft, den Nasdaq-Index und die Konflikte zwischen 220er Daimler und 5er BMW, Martin Walser und Ignaz Bubis oder zwischen Bubis und BMW sowie Walser und Mercedes. Oder auch um den Konflikt zwischen der 68er und der 89er Generation, in den sich Döpfner vor ein paar Jahren noch als Wochenpost-Chef eingeschaltet hatte. Wenn er sich den Konflikt nicht sogar selbst ausgedacht hat. Die neue Mitte ist nicht so riesig, aber für jemanden, der innerhalb von fünf Jahren eine linke ostdeutsche Wochenzeitung und eine rechte westdeutsche Tageszeitung leiten kann, reicht der Platz immer. Was heißt schon links und rechts. Sie würden sich schon vertragen. Die neue Mitte ist wie geschaffen für Gerhard Schröder, Matthias Döpfner und Joschka Fischer. Wo immer sie ist, sie ist ein Platz für Streber.
Ein Platz für Männer, die staatsmännische Gesten ausprobieren und italienische Anzüge. Männer, die älter, würdiger und weiser sein wollen, als sie sind. Männer, die vergessen können, was sie gestern gesagt und gewünscht haben.
Als das Haus, in dem ich lebe, geplant wurde, stand es am Rand. Heute steht es in der Mitte. Demnach wohne ich in einer neuen Mitte.
Vor vier Jahren konnte ich aus meinem Küchenfenster noch das Brandenburger Tor sehen. Es waren oft Fotografen bei uns zu Gast. Als die European MTV Awards vergeben wurden, hatten wir fremde Kameraleute zu Besuch. Sie filmten vom Balkon vor unserer Küche das Zelt, das über das Tor gebaut wurde. Marusha aus Berlin war nominiert, aber Mariah Carey kriegte den Frauenpreis, obwohl sie aus Amerika kommt. Wenig später verhüllte Christo den Reichstag, was ebenfalls gut aus unserem Küchenfenster zu beobachten war. Es kamen noch mehr Fotografen, Hubschrauber schrabbten im Morgengrauen über unser Schlafzimmer, wir wohnten für ein paar Wochen im Herzen der Welt. Danach begannen sie, das Hotel Adlon zu bauen. Jetzt sehe ich, wenn ich mich auf die Zehenspitzen stelle, noch ein Stück von der Kuppel des Reichstages. Es ist in Ordnung so. Ich mag das Grün der Dächer. Ich mag Straßen und Häuserschluchten. Ich finde Freiflächen häßlich. Ich empfinde keine Nachteile. Ich sehe die Charité aus meinem Küchenfenster, die Komische Oper, die Europafahne auf dem Adlon-Dach, die deutsche auf dem Bildungsministerium und die des Zaren auf dem Dach der russischen Botschaft.
Ich habe Schallschutzfenster, und ich wohne oben. Im zweiten Stock haben sie die Behinderten untergebracht.
Meine Wohnung wurde im Sozialismus geplant und im Kapitalismus gebaut. Zwischen den Gesellschaftsordnungen haben sie notdürftig den Grundriß verändert. Meine Wohnung hat jetzt weniger, aber größere Räume, und sie hat eine große Küche mit Fenster. Ich habe den Hausmeister gefragt, wer hier ursprünglich wohnen sollte. »Diplomaten und Künstler«, hat er gesagt. Keine Ahnung, ob das stimmt. Er hat mir damals auch gesagt, daß hier bald der Ku’damm des Ostens entstehen wird. Und er vergißt nie, mich an seine Dienstzeiten zu erinnern, wenn ich ihn brauche. Er ist ein Berliner Hausmeister.
Ich weiß nicht, ob die Behindertenwohnungen auch schon im Sozialismus geplant worden sind. Sie liegen im zweiten Stock, was mir logisch erschien, weil es nicht so weit war bis nach unten. Ich habe mit der Zeit begriffen, daß es dem Rollstuhlfahrer egal ist, ob er im siebten oder im zweiten Stock wohnt, wenn der Fahrstuhl nicht funktioniert. Außerdem ist es auch mit Fahrstuhl schwer genug. Einer der Mieter aus dem zweiten Stock lag manchmal unten vor den Briefkästen auf einer kompliziert aussehenden Trage. Zwei Krankenhelfer diskutierten darüber, wie sie ihn am besten in den Aufzug bekämen. Der Mann, ein großer Herr mit dunklem Bart und Brille, lag still daneben. Sie redeten, als hätten sie ein sperriges Möbelstück zu verstauen. Und es war auch so. Manchmal warteten sie mit ihrem Patienten darauf, daß der Hausmeister ihnen die Tür öffnete, die den Fahrstuhl vergrößerte. Ich war immer ein wenig verstimmt, wenn ich ihnen im Flur begegnete, weil es bedeutete, daß ich laufen mußte. Sie hielten mich auf. Das war noch nicht alles. Wenn sich die Fahrstuhltür im zweiten Stock öffnete, schwappte immer auch Gestank in die Kabine. Es gab zwei Wohnungen und einen Müllschlucker in der zweiten Etage. Den einzigen Müllschlucker des Hauses.
In einer der Wohnungen lebte der große dunkle Mann, in der anderen eine verkrüppelte junge Frau mit zwei kleinen, fies aussehenden Hunden. Es stank, es gab Hunde, ich war nicht besonders gerne hier. Ich kippte meinen Müll aus und machte, daß ich wegkam.
Eines Tages warf mein Sohn seinen Schuh aus dem Fenster. Einen winzigen Kinderturnschuh. Er landete auf dem Sonnenschutz über den Fenstern des Restaurants im Erdgeschoß. Auf der Behindertenebene. Von der Wohnung des sperrigen Mannes aus konnte man an ihn herankommen. Ich ging runter und klingelte. Eine müde aussehende Frau öffnete mir. Ich hatte sie nie mit dem Mann zusammen gesehen, auch das Mädchen nicht, das jetzt in ihrem Rücken auftauchte. Ich erzählte ihr von dem Schuh, sie führte mich in ein Wohnzimmer, in dessen Mitte der dunkle Mann wie aufgebahrt lag. Es war ein heller, sonniger Tag. Aber viel Licht schaffte es nicht bis in das Zimmer. Ich kletterte hinter die Gardine, öffnete das Fenster und angelte mir den Kinderschuh. Der Verkehr donnerte unter mir vorbei, es war sehr warm, drüben hoben sie die Grube für das Adlon aus, vom Restaurant stieg der Geruch gerillten Fleisches auf. Leben. Ich hatte den Schuh, ich wollte gehen.
»Die Lampe da habe ich noch selber angebaut«, sagte der Mann auf der Trage und zeigte schwach auf einen Leuchter an der Wohnzimmerdecke.
»Ach«, sagte ich. Das konnte höchstens vier Jahre her sein. Vor vier Jahren war der Mann, der jetzt wie eine heruntergeklappte Schranke in seinem Wohnzimmer lag, noch auf Leitern gestiegen.
Er habe Multiple Sklerose, sagte der Mann. Er erzählte noch ein bißchen von Bulgarien, wo er lange Jahre auf Montagebaustellen gearbeitet habe. Er habe die Krankheit schon damals gehabt, ohne es zu wissen. Vielleicht hätte man noch was machen können. Er erzählte von wissenschaftlichen Forschungen, von ersten kleinen Erfolgen, und ich sah die vielen medizinischen Fachzeitschriften und Bücher im Raum. Ich hätte gern etwas Aufmunterndes gesagt, aber alles, was mir einfiel, war »Lorenzo’s Oil«, ein Film mit Susan Sarandon und Nick Nolte, den ich mal gesehen hatte. Weil ich aber nicht mehr wußte, wie der Film ausging, knetete ich den Schuh meines Sohnes und beschränkte mich auf Lächeln. Der Mann erzählte von medizinischen Details, seine Frau stand still in der Ecke. Irgendwie dachte ich, daß sie es genoß, auch mal »Besuch« zu haben und nahm mir vor, öfter vorbeizukommen.
Ich war nie mehr da.
Ich begegnete dem Mann und auch seiner Frau gelegentlich im Flur, aber sie behandelten mich immer wie einen Fremden. Und das war ich auch.
Vor etwa einem Jahr las ich im Anschlagkasten unseres Hauses, daß die verkrüppelte Frau mit den Hunden gestorben war. Sie war so alt wie ich gewesen, wir waren Nachbarn, ich ging zu ihrer Beerdigung. Vielleicht war ich auch nur neugierig. Es waren 20 Leute da. Die einzige, die ich kannte, war die Gemüsefrau aus unserer Kaufhalle. Vier der Trauergäste schienen eine ähnliche Krankheit zu haben wie meine Nachbarin. Es gab keine Rede, wir saßen stumm in einer kleinen Kapelle auf einem hübschen Friedhof in der Ackerstraße, dann drückte ein Mann in einem schwarzen Anzug »auf Wunsch der Verstorbenen«, wie er sagte, die Taste eines Kasettenrekorders. Es erklang »Candle In The Wind« in der Lady-Diana-Fassung.
Auf dem Nachhauseweg dachte ich an den Überlebenden der zweiten Etage. Der Verkehr unter seinen Fenstern war jetzt vierspurig. Inzwischen war das Adlon längst fertig. Sie hoben die Grube für die britische Botschaft aus. Es war bald wieder Sommer, und es gab immer noch keine Möglichkeit, die Multiple Sklerose zu heilen. Draußen raste und lärmte die Zeit durch die neue Mitte. Er war ihr näher als alle anderen, dort unten. Ich habe mir oft vorgestellt, wie es sein muß, den Aufbruch in eine neue Zeit aus dem Rollstuhl beobachten zu müssen. Wahrscheinlich spürt man in der neuen Mitte viel mehr, daß man sich nicht bewegen kann.
Vor ein paar Tagen stand im Anschlagkasten, daß der große dunkle Mann im Alter von 46 Jahren gestorben ist.
Es war, als sei er uns aus dem Weg gegangen.
Es ist ein halbes Jahr her, da rief mich der Schriftsteller Thomas Brasch an, um mir ein Projekt vorzuschlagen. Es rauschte und quietschte im Hintergrund, als stünde Brasch auf einer Kreuzung. Aber das war nicht der Fall, denn Brasch sagte, daß er jetzt erst mal die Fenster schließen müsse.
Es wurde leiser. Brasch kehrte zurück und erzählte, daß er die Zeit einfangen wolle. Er wolle einen Berliner Platz von verschiedenen Seiten beschreiben. Das klang gut. Aber noch nicht richtig schlüssig. Vor allem, weil Brasch offensichtlich immer wieder von neuen Gedankenblitzen getroffen wurde.
»Wir müssen was mit Nina und Meret machen, verstehst du«, brüllte er plötzlich.
Vielleicht war er auch betrunken. Ich weiß nicht. Er redete zunehmend wirres Zeug, aber manchmal hatte ich das Gefühl, ihn zu verstehen. Emotional zu verstehen. Er schien an der gleichen Sache interessiert zu sein wie ich. Die Stadt in dieser Zeit zu beschreiben, die wirkliche Welt. Und er schien wie ich immer weniger zu wissen, wo man anfangen muß. Wer die wichtigen Leute sind und warum. Alles war so beliebig. Es blieb beliebig. Wir kamen nicht weiter. Wir sprachen nicht dieselbe Sprache. Brasch redete, gelegentlich sprach er sogar die Interpunktion mit, ich war dennoch nicht in der Lage, mich an dem Gespräch zu beteiligen. Nach einer halben Stunde hatte wohl auch Brasch das Gefühl, auf eine andere Ebene wechseln zu müssen.
»Hör dir jetzt mal dit an«, sagte er, hantierte an einer Musikanlage und legte das Telefon dann offensichtlich neben eine Box. Es war Saxophonmusik. Gute Saxophonmusik. Ich hätte das gerne bestätigt. Aber Brasch kam nicht mehr ans Telefon zurück. Wir haben im Büro diese kleinen Displays an den Telefongeräten, die uns zeigen, wie lange so ein Anruf dauert. Ich saß eine gute halbe Stunde an meinem Telefon und hörte Musik. Im Hintergrund rauschte immer noch Verkehr. Ab und zu rief ich was ins Telefon. Ich konnte nicht auflegen. Ich war völlig hilflos. Irgendwann polterte es, Brasch kehrte ans Telefon zurück.
»Tut mir leid«, sagte er. »War eingeschlafen.«
Dann legte er auf. Es war klar, daß man etwas tun muß, sich bewegen muß. Vielleicht fing Brasch gerade damit an. Da draußen im Dunklen.
Nach dem Herzberg-Konzert ging ich hinter den Vorhang. Die Musiker standen in einem kleinen Kabuff und redeten irgendwas, um die Stille zu vertreiben. Die Bar war zu, die Gäste waren verschwunden. Ein Typ mit einem Pferdeschwanz rumpelte auf der Bühne rum. Der Pianist erzählte, daß bei der Premiere des Programms jemand mitten im Saal einen epileptischen Anfall bekommen hatte. Sie hätten Angst, daß einmal nur zwei Leute erschienen und einer von den beiden einen epileptischen Anfall bekäme.
»Der andere müßte Arzt sein«, sagte ich.
Sie kicherten. Schlimmer konnte es wohl nicht kommen.
In einem Coca-Cola-Kühlschrank mit einer durchsichtigen Tür standen vier kleine Becks, die wir austranken. Nach fünf Minuten bat der Typ mit dem Pferdeschwanz, fertig zu werden. Er gehörte offenbar zum Tränenpalast-Team. Als wir gingen, sagte er nebenbei: »Ach, Sonntag braucht ihr dann nicht mehr zu kommen.« Der Rauswurf. Das Ende kam zwischendurch. Die Tür stand offen. Irgendwo bedruckte wahrscheinlich schon jemand weiße Zettel mit der Nachricht: »Das Herzberg-Konzert heute Abend fällt aus!!!« Eine S-Bahn donnerte vorbei. Herzberg drehte sich langsam zu dem Typen mit dem Pferdeschwanz um. Dann sagte er: »Klar.«
Klar.
Bei Dussmann brannte jetzt die Nachtbeleuchtung. Herzberg erzählte, daß er noch nie mitbekommen habe, wie tot die Gegend hier wirklich sei. Eine Entschuldigung, wofür auch immer. Was sollte man dazu sagen? Mir fiel ein, daß ich vor über zehn Jahren als Zeitungspraktikant einen Lokalbericht darüber geschrieben hatte, wie mitten in der Nacht die gußeisernen Sonnen auf die Weidendammer Brücke montiert wurden. »Mitten in der Nacht ging über der Spree die Sonne auf«, war die Überschrift. Ich war damals sehr stolz darauf. Und dann fiel mir noch ein, wie schick ich das zweistöckige Gebäude mit der Kaufhalle vor dem Handelszentrum einst fand. Und wie billig es heute wirkte, obwohl es sich nicht verändert hatte. Aber das paßte alles nicht.
Wir fuhren mit der Straßenbahn in die Oranienburger Straße und gingen in eine Kneipe in der Tucholskystraße, die Keyser Sozi hieß. Ich kannte sie nicht, und sie konnte wohl auch noch nicht so alt sein, denn Keyser Sozi war eine Figur aus einem guten amerikanischen Kriminalfilm, der erst vor drei Jahren in die Kinos gekommen war. »Die üblichen Verdächtigen«. Die Kneipe war voller schöner Menschen.
Wir stellten uns an einen Tisch neben der Tür zu zwei Mädchen und einem Jungen, die sich auf französisch unterhielten. Seit ein paar Tagen galt der Euro. Der Countdown lief. Die Zeit drückte und die Stadt. Herzberg erzählte, wo er das Programm noch verbessern müsse. Ich sah ihn an. Er war der beste Rocksänger des Ostens. Ein Star. Ich kannte die Texte auswendig. Er war aus Gold, als er in der überquellenden, schwitzenden Leipziger Moritzbastei zu uns runterrief: »Wir wollen anders sein!« Ein Held. Ich habe Pankow-Platten bei geöffnetem Fenster in voller Lautstärke gehört, in der irrwitzigen Hoffnung, daß ein Bandmitglied unten auf der Straße entlangläuft und lächelt. Ich wollte zu ihnen gehören. Ich wollte ihnen mitteilen, daß ich anders sein wollte. Genau wie ich Karl Marx gern ausgerichtet hätte, daß sich Produktivkräfte und Produktionsmittel im gewünschten Verhältnis befinden und es bei uns eine Allee gibt, die nach ihm benannt ist. Damals dachte ich allerdings auch noch, daß ihn das gefreut hätte.
es wird winter/es wird hart/zeit zu gehen/wer jetzt bleibt, der muß wissen/es wird hart, sang Herzberg vor vier Jahren.
Er blieb.
Die Bands waren gestorben, die Werte schwankten. Honecker war ja schon lange tot, aber jetzt war auch noch Kohl im Ruhestand. Es gab Schröder. Alles rutschte auf die Mitte zu. Die Grünen, die Sozialdemokraten, die Ostler. Zehn Jahre Wende, ach ja. Die alten, immergleichen Geschichten. Unser Spiel war vorbei, unser Vorschuß war weg. Es sah aus, als würde es langweilig werden. Die emotionalsten Augenblicke hatte ich im Kino oder wenn ich mir alte Springsteen-Platten anhörte. Das Jahrtausend wechselte, die Regierung kam, aber die Spannung war weg. Ständig las ich etwas von Aufbruch, aber die Leute, die ihn beschrieben, meine Leute, waren alle längst angekommen. In ihren Leben ging es nur noch um Wohnungen, um Aktien, Landhäuser, Urlaubsorte, Schuhe, Autos, Eheverträge, Mäntel, Jahresgehälter, Abfindungen, Scheidungen und Korrespondentenplätze. Aber nie direkt, immer verbrämt. Anders sein auf hohem Niveau. Andere Schuhe. Andere Autos. Neulich war ich auf einer Party eines Westkollegen, der sich sicher für unangepaßt hält. Er raucht filterlose Zigaretten, trägt derbe Schuhe und läßt, im privaten Rahmen, das Hemd aus der Hose baumeln. Er lebt in einer riesigen, wunderschönen Wohnung in Friedrichshain. Er habe sich in all den Jahren im Westen nie so richtig zu Hause gefühlt, sagte er mir, während wir die hohen Räume abschritten. Erst hier im Osten fühle er sich unter seinesgleichen. Ich nickte ernsthaft. Er wollte nett sein und auf der richtigen Seite. Wie ich. Wir standen auf abgezogenen Dielen im Niemandsland. Dies war weder Osten noch Westen, wie auch wir weder Ostler noch Westler waren. Wir bezogen beide Jahresgehälter, über die wir nicht mehr öffentlich redeten. Und machten Konversation.
Es gab keine richtige Seite. Oder ich sah sie nicht mehr, weil ich die Seiten zu oft gewechselt hatte. Vielleicht war alles zu schnell gegangen in den letzten Jahren. Vor zehn Jahren war Markus Wolf noch ein Hoffnungsträger. Heute war er vogelfrei. Vor drei Tagen titelte der Spiegel: »Wolfs letztes Geheimnis«. Ich hörte irgend etwas einrasten. Es klang wie eine Weiche.
Ich sah Herzberg an. Er redete von Buch- und Theaterprojekten. Es schien nicht so, als würde er sich unterkriegen lassen. Es sah auch nicht danach aus, als würde er sich von Zeit und Stadt unter Druck setzen lassen. Er kannte die neue Mitte und die »Generation Berlin« nicht. Er kannte die Listenmacher nicht. Er kannte ihre Bestsellerlisten nicht. Er hatte sich nie auf ihr Spiel eingelassen. Das schützte ihn, und es schadete ihm. Mein Mitleid versickerte. Wir sollten hier verschwinden. Aber so funktionierte das nicht. So funktionierte das nie. Wir waren einfach zu verschieden.
Herzberg blieb noch, ich lief los. Er wollte noch ein Bier trinken. Ich wollte die letzte Bahn nicht verpassen.
Die Poesie des Kommerzes
Ein einsamer Tango, ein verhinderter Puff, ein ratloser Russe, ein lila Flur. Die Friedrichstraße ist länger als das Lafayette. Und anders.
Eberhard Diepgen steht in kaltem, weißem Licht. Er steht auf einer Bühne, und über ihm türmen sich in einem gläsernen Kegel fünf Ringe Menschen. Notdürftig toupierte kahle Stellen am Hinterkopf, herausgewachsenes Blond, zurückgegelte Locken. Dreitagebärte, Jacketkronen, solariumgegerbte Dekolletés, zugeschminkte Falten. Die Berliner Wirtschaftsschickeria und ein paar versprengte Prominente vom Kaliber des Porträtzeichners Oskar, der früher immer bei »Dalli-Dalli« auftrat. Rolf Eden, der Playboy, ist auch da, und natürlich sind Kommunalpolitiker zugegen. Die Menschen in den gläsernen Ringen laufen nach oben hin spitz zu und produzieren ein summendes Geräusch aus klirrenden Champagnergläsern, Tuscheln und gedämpftem Lachen.
Licht mischt sich mit Leben. Das war die Idee des Glaskegels. Das war die Idee des französischen Architekten, der wenig später, nachdem er verkündet hat, daß ihn »die Poesie des Kommerzes« beeindrucke, ins nahegelegene Borchard fliehen wird, um mit Wim Wenders zu essen.
»Es ist ein wichtiger Tag«, sagt Eberhard Diepgen in den summenden Glaskegel. »Und es ist ein schöner Tag.«
Ein paar Meter entfernt sitzt Otto Metzler-Hadrich an einem Tisch, der mit billigem Furnier beklebt ist, auf einem Stuhl, der mit fadenscheinigem Tuch bespannt ist, raucht eine HB und sieht die Sache etwas anders als sein Regierender Bürgermeister. Vielleicht ist das ein wichtiger Tag. Aber auch ein schöner?
In seinem Rücken tanzt ein einsames Paar einen langsamen Walzer. Otto Metzler-Hadrich ist Tanzlehrer und 71 Jahre alt, seine Tanzschule zog 1957 hier in der Friedrichstraße ein. Sie ist eines der ältesten Geschäfte der Straße, aber zur Lafayette-Eröffnung haben sie Otto Metzler-Hadrich nicht eingeladen. »Die kleinen Geschäftsleute sind ihnen wohl zu piefig«, grummelt er.
Otto Metzler-Hadrich
Nicht, daß er gegen den Fortschritt wäre, um Himmels willen, nein, aber er findet es schon komisch, daß drüben auf der anderen Straßenseite die großen Glaspaläste aus der Erde wachsen und er hier nicht mal eine ordentliche Heizung hat. Otto Metzler-Hadrich drückt die Reste seiner HB zu den anderen Kippen, stemmt sich hoch und läuft übers knarrende alte Tanzparkett, um die Risse in den Wänden zu zeigen, die schiefen Fenster und die uralten Elektroleitungen. »Kupfer auf Aluminium gibt Wakkelkontakte«, sagt er.
In der Ecke des Tanzsaales steht ein großer gelber Kachelofen. Für den muß er Kohlen schleppen, aber er funktioniert wenigstens. Ein Drittel seiner Wohnung ist überhaupt nicht beheizbar. »Dabei hatte das Haus früher sogar Zentralheizung«, sagt Otto Metzler-Hadrich. Die Leitungen sind noch da, nur eben keine Heizkörper. Es gibt auch einen Fahrstuhlschacht ohne Fahrstuhl. »Die haben hier nur ein paar Potemkinsche Rekonstruktionen an der Fassade gemacht, wie ich das nenne«, erklärt der alte Tanzlehrer. Das Paar tanzt einen Paso doble.
An den Wänden hängen Spiegel, Kunstblumengebinde und Urkunden seiner erfolgreichsten Tanzpaare. Herr und Frau Lehmann gewannen am 12. Mai 1968 das Berliner Amateurtanzturnier in der B-Klasse. Im September ’69 waren sie sogar bei einem Schautanzen im Bolschoitheater. »Es kann ja nicht sein, daß die sich da drüben feiern, und ich habe hier Zustände wie 1945«, sagt Otto Metzler-Hadrich. »Schlechter als ’45.« Das einsame Paar tanzt Tango.
Vor dem Lafayette stehen Menschen in Abendgarderobe auf roten Teppichen und rauchen. Die Polizei bewacht sie. Sie hat alle Straßen rund ums Warenhaus abgeriegelt, weil es Drohungen aus der autonomen Szene gab.
»Wo haben Sie denn Ihre entzückende Gattin gelassen?« fragt ein großer dicker Mann einen kleinen dicken Mann.
»In Florida«, sagt der Kleine. »Da ist sie aber zu beneiden«, sagt der Große und nickt mit dem Kopf leicht gequält zu dem Glashaus in seinem Rücken.
Licht mischt sich mit Leben. Das war die Idee. Was aber ist das Leben?
Das Lafayette ist offen. Ein Kaufhaus. Nur ein Kaufhaus.
Nur?
Irgendwie scheint es, als sei mit ihm eine ganze Straße zum Leben erwacht. Zumindest aber der Abschnitt zwischen Leipziger Straße und Unter den Linden. Die Menschen laufen mit gereckten Hälsen an den glänzenden neuen Häusern vorbei, die da scheinbar über Nacht aus dem Boden gewachsen sind. Sie reiben sich erstaunt die Augen. War hier nicht gestern noch ein großes Loch? Und jetzt das. Schrecklich. Wunderschön. Kalt. Ästhetisch. Protzig. Großstädtisch. Der Ku’damm stirbt. Der Ku’damm lebt. Eine komische Straße.
»Schreiben Sie, wir versprechen uns viel vom Lafayette-Kaufhaus«, erklärt Katrin Schenke, die Chefin des berlin-cosmetik-Ladens in der Friedrichstraße. »Belebung der Straße und das alles. Sie wissen schon. Eine Konkurrenz für uns ist das eigentlich nicht, weil die ja nur französische Produkte in ihrer Parfümerie anbieten. Wir haben hier Berliner Produkte, die sind natürlich preiswerter. Und eben aus Berlin. Wir sind in diesem historischen Gebäude schon gut aufgehoben. Ostprodukte werden ja oft so ein bißchen stiefmütterlich behandelt, da ist es wichtig, daß wir an so repräsentativer Stelle liegen. Schreiben Sie die Hausnummer auf? Wäre schön. Weil wir Werbung gebrauchen können. Als B 1 mal einen Bericht über uns gebracht hat, da haben wir ein ganzes Jahr von gelebt. Silke, bestellst du mal was zu essen? Also hier in der Straße kriegt man ja nichts, und die Buletten vom Imbiß nebenan, die hängen mir wirklich schon zum Hals raus. Wir haben da einen Chinesen in der Linienstraße, der auch liefert, also das ist in Ordnung. Wichtig ist, daß Sie schreiben, daß man bei uns eine Farbberatung für 60 Mark kriegt. Das sind zwei Stunden Arbeit. Da verlangen die Handwerker ja heutzutage mehr. Natürlich kostet der Farbpaß extra. Aber dafür machen wir in zwei Stunden einen Handwerker zum Manager. Oder sagen wir mal, einen Beamten zum Finanzierungsfachmann. Im Finanzierungsbereich darf man nämlich nicht aussehen wie ein Kanarienvogel. Im Finanzierungsbereich trägt man Grau oder Blau, auf keinen Fall aber Braun. Braun ist negativ vorbelastet. Historisch, Sie verstehen schon. Sind das schon die Chaoten da draußen, Silke?«
Katrin Schenke gönnt uns eine kurze Verschnaufpause, in der sie durch die Scheiben ihres Geschäftes auf die Friedrichstraße schaut. Aber es sind keine Steinewerfer zu entdecken. Nur Journalisten, Kameraleute, Polizisten und Bauarbeiter.
Wo waren wir stehengeblieben?
»Wichtig ist, und so beginne ich jede meiner Beratungen, daß es für den ersten Eindruck keine zweite Chance gibt«, sagt Katrin Schenke. »Und für den ersten Eindruck hat man nicht mehr als sieben Sekunden Zeit.«