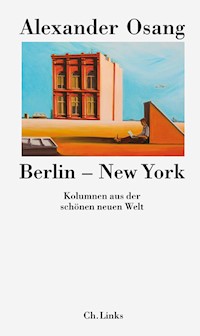14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie schreibt man über Menschen, um ihnen als Reporter gerecht zu werden?
Am Beginn steht die Finanzkrise, am Ende die Corona-Pandemie, dazwischen Afghanistan, Fukushima, Terrorismus, die Flüchtlingskrise 2015 und der Aufstieg rechtspopulistischer Parteien. Alexander Osang erzählt von Menschen und Orten, in deren Geschichten die großen Zeitläufe eingeschrieben sind. Ob Politiker, Sportler, Menschen aus der Finanz- und Medienbranche, Unbekannte, die plötzlich im Licht der Öffentlichkeit stehen – seine Texte treffen immer ins Schwarze, und doch vermeiden sie das Fertige, Unumstößliche, um Objektivität Bemühte. Auf diese Weise gelingt ihm beides: berührende menschliche Porträts und eine Erzählung gesellschaftlicher Umbrüche, die uns in Zukunft beschäftigen werden.
Alexander Osangs Reportagen der Jahre 2010 bis 2020 sind Befragung undSelbstbefragung – und entwerfen wie nebenbei das Porträt eines ganzen Jahrzehnts.
»Alexander Osang ist der beste Reporter, den wir in Deutschland haben.« Jana Hensel, Die Zeit.
»Osang hat es einfach drauf!« Anja Maier, taz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Alexander Osang
Das letzte Einhorn
Alexander Osang
Das letzte Einhorn
Menschen eines Jahrzehnts
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Ch. Links Verlag ist eine Marke der
Aufbau Verlage GmbH & Co. KG
© Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 2022
entspricht der 1. Druckauflage von 2022
www.christoph-links-verlag.de
Prinzenstraße 85, 10969 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
ISBN 978-3-96289-144-2
eISBN 978-3-86284-516-3
Inhalt
Freunde bleiben
Ein Vorwort
Wir hatten oft das letzte Wort
Wie soll man reagieren, wenn ein Freund und Kollege 20 Jahre nach dem Fall der Mauer als IM der Staatssicherheit enttarnt wird?
Die deutsche Queen
Das Volk diskutiert darüber, ob seine Kanzlerin Angela Merkel eher Protestantin oder Physikerin oder Frau oder Ostdeutsche ist. Dabei lebt die einstige Quereinsteigerin seit Jahren wie in einem Schloss, aus dem sie auf ihr Land und die Welt schaut.
Auf der Flucht
Frauke Petry ist in kurzer Zeit zur Spitzenpolitikerin einer rechtskonservativen Partei aufgestiegen. Ist das eine Erfolgsgeschichte oder eine Tragödie?
The Preuss of Germany
Torsten Preuß war: Dissident, Punk, Reporter, Surfer, Buchautor. Er hatte immer Sehnsucht und Wut. Jetzt scheint er bei Pegida eine Heimat gefunden zu haben.
Der Systemsprenger
Holger Friedrich wuchs in einem Ostberliner Plattenbau auf, heute besitzt er eine Villa am Wannsee, eine Jacht und eine Zeitung. Er gehört aber immer noch nicht dazu.
Da is nüscht
Filmemacher Leander Haußmann gerät mit seiner »Stasikomödie« in eine Schaffenskrise. Die Coronapandemie, die die Kinos bedroht, ist dabei noch sein geringstes Problem.
Tod in Berlin
Ein amerikanisches Paar stoppt auf seiner Weltreise im Berghain, einem berühmten Technoclub, in dem die Zeit des Übergangs, der unbegrenzten Möglichkeiten, der Freiheit gefeiert wird. Hier endet ihr Trip.
Der Friseur von Fukushima
Tomo Kagawa ist auf seiner Flucht vor Tsunami, Erdbeben und Kernkraft in Berlin-Marzahn gelandet, wo man das japanische Unglück noch nicht vergessen hat.
Mayers Krieg
Ein deutscher Kommandeur bereitet sein Bataillon auf einen Einsatz in Afghanistan vor, dessen Sinn kaum noch jemand versteht. Wie soll er sich und seine Männer motivieren?
Der Sonderbotschafter
Jürgen Todenhöfer läuft seit Jahren durch die Schützengräben dieser Welt. Er redet mit Kriegern, Diktatoren und Oppositionellen. Gerade war er wieder im Mittleren Osten, auf der Suche nach ein bisschen Frieden.
Totentanz
Nach einem Terroranschlag auf das Hotel Imperial Marhaba brach der Tourismus in Tunesien zusammen. Das Imperial aber sollte geöffnet bleiben, als Symbol gegen Terrorismus.
Der Minister darf auf den Gleisen überholt werden
Heiko Maas sagt, er sei wegen Auschwitz in die Politik gegangen. Was meint er eigentlich damit?
Was will der Eichmann von uns?
Vor 60 Jahren wurde der Holocaust-Organisator Adolf Eichmann in Israel vor Gericht gestellt. Gabriel Bach war damals Ankläger. Eichmann wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet, aber für Bach hat der Prozess nie aufgehört.
Der vielseitige Mister Chang
Der einzige Nordkoreaner, der in der freien Welt auftritt, sitzt im IOC. Er bewegt sich geschmeidig und vorsichtig zwischen Scheichs, Königen, ehemaligen Hürdenläufern, Stabhochspringern, Prinzessinnen und Thomas Bach.
Das gefesselte Kapital
Der Anlageberater James Amburn versprach deutschen Rentnern das große Geld in Florida. Dann brach die Finanzkrise aus, er konnte seine Versprechen nicht mehr halten, wurde von den alten Leuten in eine Kiste gesperrt und an den Chiemsee entführt.
Der Stehgeiger
Daniel Dassel flüchtete als Teenager aus dem Osten, studierte den Kapitalismus bei den besten Lehrern und war auf dem Weg in die Spitze der deutschen Finanzwelt, als er über die Sexparty einer Versicherung stolperte. Seine Karriere ist vorbei, aber er will sein Leben zurück.
Das letzte Einhorn
Michael Ballack hat seine Karriere sorgsam geplant, sie führte ihn von Chemnitz über München nach London, machte ihn reich, weltberühmt und zum Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Aber wie sieht das perfekte Ende einer perfekten Karriere aus?
Beim nächsten Mal Sahara
Der Chef des Jobcenters Brandenburg rüstet ältere Langzeitarbeitslose mit Schrittzählern aus und schickt sie auf eine virtuelle Reise zum Mount Everest.
Die Auflösung
Angela Merkel hat sich nie um ihr Vermächtnis, eine große Vision oder ein Ölporträt fürs Kanzleramt gesorgt. Sie hat es trotzdem geschafft.
Das Versprechen
Ein Chefredakteur der »Berliner Zeitung« versucht in einer Oktobernacht 1989, mit einem einzigen Wort ein ganzes Land vor dem Untergang zu bewahren.
Freunde sein
Ein Nachwort von Christoph Links
Quellenverzeichnis
Zum Autor
Freunde bleiben
Ein Vorwort
Als der Sommer zu Ende ging, meldete sich ein Mann aus einem Berliner Vorort beim »Spiegel« und hinterließ eine Telefonnummer für mich. Sein Vater sei in der Nacht gestorben. Der Tote heiße Dieter Resch und habe mich seinerzeit zum »Spiegel« vermittelt. Er wolle mich zur Beerdigung einladen. Ich wartete drei Wochen, bis ich in der Lage war, die Nummer zurückzurufen. Ich hatte keine Ahnung, wie ich dem Mann hätte begegnen sollen.
Dieter Resch hatte mich keineswegs zum »Spiegel« vermittelt, aber wie sollte ich das seinem trauernden Sohn sagen?
Resch war Chef der Wirtschaftsredaktion der »Berliner Zeitung«, als ich dort im Herbst 1987 anfing. Er rauchte, trank und trug einen Schnurrbart. Ein ehemaliger Bergmann. Seine Freunde nannten ihn Dietus. Er war mein erster Chef im sozialistischen Journalismus und mein letzter war er auch. Er machte mich zum Jugendredakteur der Zeitung, er schickte mich auf die »Messe der Meister von Morgen« nach Leipzig, an die Erdgastrasse in den Ural, zu den Weltfestspielen nach Nordkorea und auch zum letzten Fackelzug der Freien Deutschen Jugend Unter die Linden, im Oktober 1989. Anschließend, immer noch im Herbst, wahrscheinlich sogar noch im selben Monat, schickte er mich auf die Fährte von korrupten Funktionären des untergehenden Staates.
Kurz nach dem Mauerfall wurde er stellvertretender Chefredakteur der Zeitung, mit großer Mehrheit in einer Abstimmung der Redakteure bestätigt, die spürten, dass er die Energie hatte für eine abrupte Wende.
Im November 1989 erschien ein Reporter vom Hamburger »manager magazin« in unserer Redaktion und fragte, ob er einen Schreibtisch bekommen dürfe, von dem aus er die wirtschaftlichen Veränderungen im Osten Deutschlands beobachten könne. In der Redaktion der »Berliner Zeitung« sorgte das für eine der letzten großen Auseinandersetzungen im Kampf der Systeme. Einer der alten Chefredakteure, Fritz, befürchtete, dass wir uns mit dem Kollegen des »manager magazin« die CIA in den Pelz setzen würden. Das waren seine Worte. Die CIA im Pelz.
Dieter Resch hatte diese Ängste nicht mehr, er erklärte dem Westkollegen, dass die »Berliner Zeitung« im Austausch gern jemanden nach Hamburg schicken würde. Mich.
So verbrachte ich die ersten drei Monate des Jahres 1990 in Hamburg. Ich bekam ein Zimmer bei einer Redakteurin, die im Grindelviertel wohnte, ein Praktikantengehalt in D-Mark und besuchte Bilanzpressekonferenzen von British Petroleum und Jacobs Suchard, die mich nicht interessierten. Jeden Morgen brachte mir ein Bürobote die »FAZ« und die »Financial Times«, die ich nicht verstand. Ich knitterte sie so lange durch, bis sie zerlesen aussahen. Als ich den Vorstandsvorsitzenden der Beiersdorf AG interviewte, gab mir ein Kollege vom »manager magazin« ein Jackett und eine Krawatte. Ein »Spiegel«-Redakteur, der mit meiner Gastgeberin befreundet war, führte mich über die Reeperbahn und erklärte, wo man »ehrlichen Sex« kaufen könne, auch eine Sache, die ich nicht verstand. Als ich im April nach Berlin zurückkehrte, hatte ich genug Westerfahrung, um die größte Abteilung der »Berliner Zeitung« zu übernehmen, die Lokalredaktion. Ich war 27 Jahre alt.
Dieter Resch bestellte mich an einem Aprilsonntag 1990 zu sich nach Hause, um mir zu erklären, worauf es ankam, als Lokalchef. Er leerte dabei eine Flasche Weinbrand, vielleicht aus Schmerz, weil der Mann, den ich ablöste, einst sein bester Freund bei der Zeitung gewesen war. In der letzten Stunde waren seine Ausführungen nicht mehr zu verstehen, zum Schluss stand er schwankend und wild gestikulierend auf dem unbefestigten Weg vor seinem Einfamilienhaus in Hohen Neuendorf, während ich in dem Polski Fiat, den mir mein Schwager im letzten Sommer dagelassen hatte, bevor er über Ungarn in den Westen flüchtete, zurück nach Berlin aufbrach.
Ich leitete die Lokalabteilung ein halbes Jahr. Es war eine lehrreiche Zeit, aber ich war froh, als es vorbei war. Meine letzte Aufgabe als Lokalchef war es, einen Bericht über die Einheitsfeierlichkeiten am 3. Oktober 1990 abzuliefern. Es war ein schmerzhafter Abend für mich, ein Abschied von meinem alten Leben, auch von den Träumen eines kleineren, besseren Deutschlands. Im letzten Jahr war die Zeitung, für die ich arbeitete, an den Westen verkauft worden, genau wie, zumindest war das mein Eindruck, das Land. Eine Zeit lang, als der Sozialismus verschwunden war und der Kapitalismus noch nicht da, hatte es gewirkt, als würde die Zeitung uns gehören. Ich lief zwischen den Buden, die sie Unter den Linden aufgebaut hatten, zum Reichstag. Überall Besoffene, Büchsenbier und Bratwürste, auf der Tribüne die Eroberer, ganz vorn der Kanzler und seine Frau. Es war ein Kreuzweg und so las sich auch der Text, den ich für die Sonderausgabe der »Berliner Zeitung« schrieb. Der Rhythmus orientierte sich am Strudel eines leerlaufenden Waschbeckens. Der letzte Satz bestand aus einem Wort: Aus.
Dieter Resch war der Chefredakteur vom Dienst. Er wollte, dass ich den Text umschreibe, aufhelle.
»Das ist ein Tag der Freude, Alexander«, sagte er.
Resch stand am Anfang und am Ende dieses berauschenden Jahres der Freiheit.
Am nächsten Tag wurde ich Reporter.
Kurz vor Weihnachten begleitete ich in dieser Funktion einen Sattelschlepper voller Arzneimittel, die mit Spendengeldern von Lesern der »Berliner Zeitung« gekauft worden waren, zu einem Moskauer Kinderkrankenhaus. Es war eine abenteuerliche Fahrt durch eine zerfallende Welt. Die Truckfahrer stammten aus Westberlin und verfuhren sich ständig, in Minsk verloren wir uns für eine Nacht aus den Augen. Ich saß im Lada vom Chef der Ostberliner Industrie- und Handelskammer, der die Reise begleitete, und sah zu, wie der Truck, in dem sich die Leserspenden und auch der Fotograf Wulf Olm befanden, in der weißrussischen Dunkelheit verschwand. Am nächsten Morgen trafen wir uns zufällig auf der Autobahn wieder. Als wir schließlich in Moskau ankamen, empfing uns der Direktor der Kinderklinik zu einem kleinen Umtrunk. Während seiner Dankesrede klauten sie auf dem Hof des Krankenhauses die Hälfte der Spenden von unserem Laster. Den Heiligen Abend verbrachten Wulf und ich in einem billigen Moskauer Hotelzimmer, am ersten Weihnachtsfeiertag kämpften wir uns durch Ziegenherden auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo zu unserem Gate.
Mein Text für die Zeitung beschrieb den Irrsinn der Reise und der Zeit. Eine Art »Lohn der Angst« im Osten 1990. Wieder wollte Dieter Resch, dass ich ihn umschreibe, schöner mache. Für die Leser, die gespendet hatten.
Es war ein unwirklicher Tag zwischen den Jahren. An Reschs Bürowand hing eine billige Uhr, ein Werbegeschenk irgendeiner norwegischen Kreuzfahrtgesellschaft, neben seinem Schreibtisch stand ein Pappkarton mit Wegwerffeuerzeugen, auf denen »Diner for two« stand, der Slogan einer Gastronomenaktion, die in der Zeitung beworben wurde. Dieter Resch wirkte in diesem Moment wie der Manager eines Kleinkünstlers. Ein paar Wochen später würde der Chef der Industrie- und Handelskammer im Foyer des Berliner Verlages stehen und mir mit gesenkter Stimme erklären, dass Resch bei der weihnachtlichen Spendenaktion der Zeitung fast genauso viel verdient habe wie die Moskauer Kinderklinik. Es ging um irgendwelche Weihnachtsbäume, die Resch günstiger aus Norwegen bezogen haben sollte als angegeben. Ich habe nie überprüft, ob das stimmte, aber es hätte mich nicht überrascht.
Ich schrieb ein bisschen Hoffnung in den Text über die Moskaureise, dann fuhr ich mit meiner Freundin in einem Bus von Holiday Reisen nach Istanbul, um dort Silvester zu feiern. Mit der Frau lebe ich bis heute zusammen, mit Dieter Resch hatte ich nie wieder zu tun.
Er verließ die »Berliner Zeitung« bald, weil Erich Böhme, der neue Herausgeber, ihn nicht ertrug. Die Sprache, die Werbegeschenke, die Vergangenheit. Es war eine Begegnung der Systeme, und natürlich auch der Männer. Ostmann traf auf Westmann. Böhme wollte alle Stasiakten in die Spree kippen und ein stillgelegtes Bahnwärterhäuschen in Südfrankreich beziehen. Resch kam aus der Wismut und hatte eine Akte.
Dieter Resch gründete eine PR-Agentur und verdiente dort draußen deutlich mehr Geld als hier drinnen, bei uns. Manchmal erzählte mir jemand, dass er der Bergmann geblieben sei, der er war, der Schnurrbartträger. Dietus.
Erich Böhme, ein Hesse, hatte eine Art Resozialisierungsmaßnahme nach Berlin geführt. Er war jahrelang »Spiegel«-Chefredakteur gewesen, ging anschließend in den Ruhestand, ins Périgord, als seine Frau plötzlich starb. Der Chef des Hamburger Verlages Gruner und Jahr, der unsere Zeitung gekauft hatte, wollte seinen alten Kumpel Erich aus dem seelischen Tief holen, hieß es. Natürlich wollte er auch die seltsame Ostzeitung, mit der sie, wie mir der Vorstandsvorsitzende später einmal gestand, »ein bisschen spielen wollten«, kontrollieren lassen. Böhme fuhr mit einem Verlags-Wartburg durch Ostberlin und hielt seine Hand über einen sächsischen Chefredakteur, der früher mal Redenschreiber beim Zentralrat der FDJ gewesen war. Ein sozialistischer Christ aus Dresden, ebenfalls ein Schnurrbartträger, der die Hamburger Besitzer nur »die Säcke« nannte.
Als Erich Böhme vier Jahre später sein Ostberliner Experiment beendete, fiel auch der Chefredakteur. Es kam ein jüngerer Österreicher namens Maier, der in Konferenzen von Liebe redete und nachts in der St.-Hedwigs-Kathedrale Orgel spielte. Michael Maier holte erstklassige Feuilletonisten von der »FAZ«, einen Sportchef von der »Süddeutschen«, einen Lokalchef von der »Bild-Zeitung« und eine Reporterin von der »Welt«, die Frau, mit der ich im Dezember 1990 im Holiday-Reisen-Bus nach Istanbul gefahren war.
Während die »Berliner Zeitung« unter Böhme die »Washington Post« Deutschlands werden sollte, sollte sie sich nun eher in Richtung »New York Times« bewegen. Maier ließ einen amerikanischen Designer einfliegen, der eine Woche lang durch Berlin lief, um die Stadt zu riechen, wie er sich ausdrückte. Dann entwarf er ein neues Layout. Es war eine wunderbare Zeit. An ihrem Ende holten die »Säcke« Maier nach Hamburg, wo er für sie kurz den »Stern« leitete und dann entlassen wurde. Unsere Zeitung übernahm ein Politikjournalist, der lange in Bonn gearbeitet hatte und Berlin nicht mehr verstand. Er kam vom »Kölner Stadt-Anzeiger«.
Von der »New York Times« war nun nicht mehr die Rede. Ich unterschrieb einen Vertrag beim »Spiegel« und zog mit meiner Familie lieber selbst nach New York, wo ich die »Times« jeden Morgen vor der Tür fand.
Die Abschiedsfeier fand in einem Kellerrestaurant in der Krausnickstraße statt. Meine alten Kollegen waren da, einige meiner neuen, viele Freunde und ein paar Ostberliner Rockmusiker. Es gab Reden, Bier und Kartoffelsalat. Als meine Frau und ich nachts durch die Berliner Mitte zu unserer Wohnung zurückliefen, in der lauter Umzugskisten für New York standen, fühlte ich mich, als würden wir auswandern.
Unsere Zeitung blieb in der Provinz zurück, der westdeutschen.
Der Bonner Politikjournalist, der ursprünglich aus Bayern stammte, ging nach zwei Jahren wieder, er wurde durch einen studierten Volkswirt aus Bochum ersetzt, der von der »Stuttgarter Zeitung« kam. Die großartigen Feuilletonisten gingen zurück zu ihren Feuilletonistenblättern. Gruner und Jahr verlor die Lust am Spiel mit der »Berliner Zeitung«. Die »Säcke« aus Hamburg verkauften die Zeitung an einen britischen Medieninvestor namens Montgomery, Chefredakteur wurde ein Münsterländer Corvette-Fahrer, der nebenbei noch ein Kreuzfahrtmagazin betrieb und gern Geschichten aus seiner Zeit als westfälischer Lokalredakteur erzählte. Einmal frühstückte ich mit ihm und dem Briten in einem Berliner Hotel. Es war nicht ganz klar, ob Montgomery genau wusste, in welcher Stadt er sich da gerade befand. Er kam aus London und musste gleich weiter nach Amsterdam, soweit ich mich erinnere, er klopfte auf der aktuellen Ausgabe der »Berliner Zeitung« herum, die er sehr mochte, wie er sagte, obwohl er ihre Sprache nicht verstand.
Er verkaufte sie dann an den Kölner Verleger Alfred Neven DuMont, der den Münsterländer Corvette-Fahrer entließ und den eifrigen Bochumer Volkswirt zurückholte. Der legte die »Berliner Zeitung« mit der »Frankfurter Rundschau« zusammen, die DuMont, der eine Art Zeitungspate von Köln war, im Kaufrausch auch noch angeschafft hatte. Der Volkswirt fiel beim Alten in Ungnade, nachdem in der »Berliner Zeitung« ein Artikel veröffentlicht worden war, beim dem der Adel nicht gut wegkam. Neven DuMont war mit einer blaublütigen Österreicherin verheiratet. Das waren 20 Jahre nach dem Mauerfall die ideologischen Schlachten, die in der Redaktion ausgefochten wurden. Westbesitzer und Westchefredakteure stritten in dem schmalen Hochhaus, das sozialistische Architekten in den siebziger Jahren am Alexanderplatz aufgebaut hatten, über die Rolle des Adels.
Ich war nach sieben Jahren in New York zurück nach Berlin gezogen, blieb aber Reporter beim »Spiegel« und beobachtete meine alte Heimat aus der Ferne, bis ich einen Anruf von Alfred Neven DuMont erhielt. Er bestellte mich nach Köln und bot mir die Leitung der »Berliner Zeitung« an.
»Sie haben doch einen Chefredakteur«, sagte ich DuMont bei unserem ersten Treffen.
»Ja, aber der kann’s ja nicht«, sagte er, lächelnd, und ich ahnte, was einmal mit mir passieren würde, sollte ich zusagen.
Ich flog trotzdem ein paarmal zwischen Berlin und Köln hin und her. Am Flughafen holte mich immer ein Fahrer ab, im Fond seines riesigen Mercedes lagen, auf honigfarbenem Leder, die Zeitungen des Verlages aus wie in einer Hotellobby. In Neven DuMonts Büro hing Weltkunst, einmal traf ich dort zwei Kuratoren aus dem Museum of Modern Art, es gab eine Galerie, auf die sich der Verleger zu Kurzschläfen zurückzog. An einem späten Vormittag hatte er mitten in einem Telefongespräch mit mir einen Blutsturz, wie mir seine Sekretärin mitteilte, nachdem zehn Minuten Ruhe in der Leitung geherrscht hatte. Wir tranken Tee mit seiner Frau, ich lernte auch den Rest der Familie kennen und das Gerücht, dass kein Bürgermeister von Köln ohne den Segen des Alten gewählt werden würde. Alfred Neven DuMont versprach immer wieder, mich zu küssen, wenn ich den Chefredakteursvertrag unterschriebe. Außerdem kündigte er an, mein Jahresgehalt beim »Spiegel« sofort zu verdoppeln. Während eines Abendessens mit einem seiner Vorstände in Berlin erhöhte er das Angebot per Telefonanruf beiläufig um 30 000 Euro, vor dem Dessert. Außerdem, so sagte mir der Vorstand – ein ehemaliger Kollege und westdeutscher Ex-Kommunist, der ursprünglich aus Ostfriesland stammte –, gäbe es einen Dienstwagen meiner Wahl, ohne Kilometerbegrenzung. Der Dienstwagen und auch die freien Kilometer tauchten in den vier Monaten, die ich über das Angebot nachdachte, immer wieder auf. Ich fand es erstaunlich, wie wenig mir ein Auto inzwischen bedeutete. Bei meinem ersten Westeinsatz, in Hamburg, hatte ich den Chefredakteur des »manager magazin« noch gefragt, was für ein Auto man für 1200 Mark bekommen würde. Das war das Geld, das ich damals zur Verfügung hatte, im Januar 1990.
Die Vorstellung aber, als ostdeutscher Chefredakteur in die Redaktion zurückzukehren, war verlockend. Ich redete mit vielen Leuten, Kollegen, Freunden, manche rieten mir ab, manche zu. Neven DuMont stellte mich den anderen Vorständen und Chefredakteuren seines Verlages vor. Sie erschienen mir unterwürfig oder gebrochen, oft beides. Ein Hofstaat. Zum Schluss saß ich mit der Tochter des Tycoons in einem sehr großen und leeren Büro in der gläsernen Firmenzentrale in Köln. Sie redete von dem Pferdemagazin, das sie betrieben hatte, und irgendeinem Abenteuerspielplatz, an der Wand hing eine Kinderzeichnung. Ich fuhr ein letztes Mal mit dem großen Mercedes zum Flughafen Köln/Bonn, verabschiedete mich von meinem Fahrer, flog nach Berlin zurück, sagte ab und brach zu einer Recherche nach Afghanistan auf. Ich blieb ungeküsst.
Während ich in einem Militärlager in der Provinz Baghlan war, bewarb sich eine Redakteurin, mit der ich mich in den letzten Wochen beraten hatte, um den Chefposten bei der »Berliner Zeitung«. Sie stammte aus Stuttgart und hatte mir abgeraten. Sie bekam den Job. Nach ein paar Jahren wurde auch sie entlassen und durch einen Mann ersetzt, der von der »Süddeutschen Zeitung« kam, seine Karriere aber bei der »Berliner Zeitung« begonnen hatte. Er stammte aus einer Kleinstadt im Bergischen Land, kaufte sich ein Haus in Westberlin und parkte dort seinen Porsche.
Jochen Arntz aber kam gewissermaßen nach Hause, mehr als ich inzwischen hätte nach Hause kommen können. Er war mit der rheinländischen und der Ostberliner Mentalität vertraut. Er kannte die Zeitung und den Kölschen Klüngel. Wir beide kannten uns ebenfalls gut.
Jochen war Gast auf meiner Hochzeit gewesen, wie auch Erich Böhme.
Böhme war inzwischen tot, und irgendwann starb auch Alfred Neven DuMont. Zuletzt starb Schulte-Hillen, der Hamburger Verleger, der einst mit der »Berliner Zeitung« spielen wollte wie eine Katze mit einer Maus. Auch die Männer und Frauen, die am 3. Oktober vorm Reichstag standen, zumindest die, die ganz vorn standen, starben. Ich war auf einigen Beerdigungen, sogar auf der von Helmut Kohl und natürlich auf der von Erich Böhme, meinem väterlichen Förderer. Dessen Trauergottesdienst fand in Westberlin statt, obwohl Böhme am Ende seines Lebens mit einer ehemaligen Sprecherin der DDR-Nachrichtensendung »Aktuelle Kamera« auf einem Landgut im östlichen Brandenburg gelebt hatte. Sie trugen seinen Sarg über den Weihnachtsmarkt zur Gedächtniskirche. Die Kirche war voller »Spiegel«-Redakteure, die Witwe saß in der ersten Bank wie der Ostbesuch. Die Rede hielt Joschka Fischer, ein Außenminister, der wie Böhme aus Hessen stammte.
Die »Berliner Zeitung« musste das elegante Hochhaus am Alexanderplatz verlassen und zog in einen Neubau nach Kreuzberg.
Es gab keine Blutspur mehr. Es gab nur noch den Westen.
Irgendwann, ich lebte inzwischen in Tel Aviv, rief Jochen Arntz bei mir an und sagte, der Verlag sei von einem Ostberliner Unternehmer gekauft worden, der jetzt gern von mir interviewt werden wolle. Es war, soweit ich mich erinnere, das erste Mal in meinem journalistischen Leben, dass mir jemand mitteilen ließ, er würde gerne von mir interviewt werden.
Natürlich hätte mich das misstrauisch machen müssen, aber es machte mich vor allem neugierig.
Ich war zufällig in Berlin und mein Arbeitgeber, der »Spiegel«, wollte ebenfalls, dass ich den Verleger interviewte, der aus dem Nichts aufgetaucht war. Der erste ostdeutsche Zeitungsverleger. Ich schaute mir ein Foto an, das die neuen Besitzer bei ihrem ersten Auftritt vor der Belegschaft zeigte. Silke und Holger Friedrich. Sie sahen auf dem Bild aus wie ein Ethnopop-Duo. Ich traf sie am nächsten Tag in einem Glasbüro im neuen Berliner Verlagsgebäude. Hinter der Scheibe sah man Jochen, den Chefredakteur, zu uns hereinschauen wie in ein Terrarium. Manchmal klopfte er und fragte, ob wir noch Kaffee wollten. Ich spürte seine Ungewissheit, und für einen Moment hatte ich das Gefühl, dass wir Ostler zum ersten Mal seit 30 Jahren die Dinge unter uns ausmachten. Wir redeten über unsere Kinder und unsere Mütter, über New York, London und Prenzlauer Berg, über den Fußballverein Union, die Band Pankow, die Rote Armee, das Landleben in Sachsen-Anhalt, internationale Schulen, den Westberliner Filz und über das Geld, das das Ehepaar in die Zeitung stecken wollte.
Ich musste seit langer Zeit einmal nicht erklären, wer ich bin. Die anderen waren da draußen, hinter der Scheibe.
Als ich das Tonband abschrieb, verschwand etwas von der Klarheit, die ich im Gespräch mit den Friedrichs gespürt hatte. Manche Dinge, die Holger Friedrich mir da erzählte, waren einfach nicht zu begreifen, selbst wenn man sie sich vier-, fünfmal anhörte. Ich fühlte aber immer noch eine angenehme Ungeschütztheit und die Sehnsucht nach einem Neuanfang. In der Nacht schrieb ich das Interview, ließ es von den Friedrichs autorisieren und schickte es dem »Spiegel«. Im Prozess spürte ich etwas von der Fremdheit auf allen Seiten. Ich fühlte mich wie ein Vermittler, ein Unterhändler. Ein paar Wochen später, ich war längst wieder in Tel Aviv, verkündete die »Welt«, dass der neue Verleger Holger Friedrich IM der Staatssicherheit gewesen war. Kurz darauf kam auch noch heraus, dass die Zeitung den Börsengang einer Firma angepriesen hatte, an der Friedrich Anteile besaß. Der neue Besitzer schien den alten Klischees des Ostlers zu entsprechen. Verstrickt, korrupt, vergangenheitsbelastet.
Aber er konnte nicht rausgeschmissen werden. Das war neu.
Nach der Stasienthüllung rief ich Holger Friedrich aus Tel Aviv an, es war ein Sonntagabend, dunkel in Jaffa. Er klang angeschlagen.
»Alles okay?«, fragte ich.
»Allet jut«, sagte er. »Ick komme grade aus der Sauna, da bin ick imma tiefenentspannt.«
Ich beschloss, ein Porträt über ihn zu schreiben. Wir telefonierten gelegentlich, und wenn ich in Berlin war, gingen wir essen, meist im Grill Royal, dem Restaurant der Berliner Neureichen, in dem Friedrich immer den besten Tisch bekam. Einmal fragte er, ob ich als Aufsichtsratsvorsitzender für den Verlag arbeiten würde. Ich wusste gar nicht, was ein Aufsichtsratsvorsitzender macht, und sagte Nein.
Friedrich zeigte mir seine Villa am Wannsee und die Internationale Schule in Mitte, die seine Frau betreibt, ich begleitete Silke Friedrich in ihr Heimatdorf in Sachsen-Anhalt und überlegte kurz, Holger Friedrich auf seiner griechischen Insel zu besuchen. Allerdings hätte er dazu einen Helikopter schicken müssen. Ich hörte zum ersten Mal das Wort »Compliance« aus dem Munde eines Ostberliners und wurde, ebenfalls zum allerersten Mal, in der Teeküche einer Wannseevilla aufgefordert, mein Handy abzugeben, um nicht, von wem auch immer, abgehört zu werden. Am Ende des Sommers, als ich wieder in Berlin wohnte, brachte mir Friedrich seine Stasiakten in einem Ferrari. Wir besuchten das Plattenbaugebiet an der Mauer, in dem er großgeworden war, ich sprach mit Schulkameraden, Nachbarn, mit seiner Mutter und mit Kollegen, die seinen Aufstieg begleitet hatten.
Ich lernte einen Mann kennen, den seine Jugend im Osten genauso geprägt zu haben schien wie seine Erfolge im Westen. Im Oktober, zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit, schrieb ich ein Porträt über Friedrich. Es sollte einen Mann zeigen, der aus seinem Leben im Sozialismus und bei McKinsey die Lehre gezogen hatte, dass Systeme zerschlagen werden müssen, um etwas Neues zu beginnen. Dass jeder ersetzbar ist. Einen Mann voller Paranoia, aber ohne Angst, selbstzufrieden und unsicher, einen Mann, der schnell begeistert und schnell misstrauisch werden konnte, der niemandem vertraute wie sich selbst, der immer mehr Geld anhäufte, ohne dass es ihm irgendetwas zu bedeuten schien. Vor allem aber endlich einen Ostdeutschen, der sich zutraute, in die deutsche Medienlandschaft einzugreifen.
Ich habe immer wieder Texte über die »Berliner Zeitung« geschrieben, obwohl ich inzwischen doppelt so lange beim »Spiegel« arbeite. Ich habe mir bei der »Berliner Zeitung« die Maßstäbe für die Arbeit als Reporter geholt. Wie weit muss man sich den Erwartungen seines Redakteurs entziehen, wie stark korrumpiert Macht, wie verführerisch ist es, der Mehrheit zu folgen, wie schnell wird man zum Opportunisten, wie viel des Bodens, den man beschreibt, darf man dabei verbrennen? Wie allein kann man sein, ohne unglücklich zu werden?
Ich habe mit der Redaktion eine Gesellschaftsordnung gewechselt. Sie war erst Parteiorgan, dann Verkaufsobjekt. Anfangs musste die Zeitung eine Welt beschreiben, wie sie sich die Sozialistische Einheitspartei vorstellte, eine Welt, in der der Sozialismus siegte. Von einem Tag auf den anderen sollte eine Welt beschrieben werden, die es gab. Von denselben Leuten. Einige sind daran zerbrochen, ich fühlte mich befreit.
Wenn ich jemals ein berufliches Zuhause hatte, dann dort, bei dieser Zeitung. Ich war auf Beerdigungen von Redakteuren, die von vielen Kollegen beweint wurden, und auf Beerdigungen von Redakteuren, die einsam starben. Ich habe die Totenrede für Wulf Olm gehalten, den Fotografen, mit dem ich fast zehn Jahre lang zusammengearbeitet hatte. Ich habe mit meinen Kollegen einmal in der Woche zusammen Fußball gespielt, wir hatten Trikots, auf denen der Name unserer Zeitung stand. Die Mannschaft gibt es immer noch, wir treffen uns jeden Montagabend. Keiner meiner Mitspieler arbeitet heute noch bei der »Berliner Zeitung«.
Als die Kapitalisten aus Köln Holger Friedrich die Zeitung überließen, war nichts mehr mit ihr zu verdienen. Das glaubte er natürlich nicht, er war daran gewöhnt, Erfolg zu haben. Er hat keine Ahnung vom Zeitungmachen, aber das muss kein Nachteil sein. Er hat, soweit ich das einschätzen kann, Ahnung von Zahlen. Von Algorithmen. Der Verleger hat eine Schulung für Volontäre in Leipzig belegt. Er lernte, wie man einen Kommentar schreibt, während beliebte Kommentatoren die Redaktion verließen. Es könnte sein, dass ausgerechnet ein Ostdeutscher meine gute alte Zeitung gegen die Wand fährt. Es würde in die Erzählung passen.
Es war jetzt genau 30 Jahre her, dass Dieter Resch aus meinem Leben verschwunden war und der Westen begonnen hatte, mit uns zu spielen.
Aber es war noch nicht vorbei.
Als der Text über Holger Friedrich erschien, twitterte Uwe Müller von der »Welt« nochmal die Karteikarte, mit der die Stasibeamten Friedrich einst registriert hatten. Müller, der aus Wiesbaden stammt, verdient seit vielen Jahren sein Geld damit, DDR-Unrecht aufzuarbeiten. Die Karteikarte sagte nichts über meinen Text, sie widersprach ihm nicht, sie ergänzte ihn nicht, aber sie schien alles zu sein, was Müller brauchte. Er hielt sie hoch, als wolle er mich damit vom Platz stellen. In der großen montäglichen Blattkonferenz des »Spiegel« behauptete eine Kollegin, ich hätte einen Beratervertrag bei Friedrich unterschrieben. Das war natürlich völliger Unsinn, aber wahrscheinlich konnten einige Redakteure in der Konferenz sich das gut vorstellen.
Mein ehemaliger »Spiegel«-Kollege Hasnain Kazim twitterte wenig später: »Das Porträt über Holger Friedrich im aktuellen Spiegel sagt in etwa genauso viel über den Verfasser Alexander Osang aus wie über Friedrich.«
Kazim stammt aus Oldenburg. Ich habe ihn nie getroffen, soweit ich mich erinnere. Ich habe nie ein Wort mit ihm gewechselt. Er kennt mich nicht. Er hat es einfach so hingeschrieben, um einen Punkt zu machen, welchen auch immer. Ein Tweet, der schlauer und hintergründiger klingt, als er ist.
Natürlich sagt das Friedrich-Porträt so viel über mich aus wie über ihn.
Es gibt einen Text in diesem Buch, den ich vor über zehn Jahren geschrieben habe, aber nie veröffentlichen konnte. Auch er spielt vorwiegend in der »Berliner Zeitung«. Er handelt von einem Freund.
Kollegen sagen, man darf nicht über Freunde schreiben. Ich verstehe, warum sie das sagen, bin aber anderer Meinung. Ich habe nie geglaubt, dass Reporter unbestechlich sind, unbeirrbar, objektiv, über den Dingen stehend. Alles, was ich liefern kann, ist meine Sicht auf die Person, die ich beschreibe.
Manchmal entstehen die Texte in durchwachten Nächten, in einem Kampf, in dem Leben zu Material wird. Dort draußen, bei der Recherche, bin ich Teil der Welt; wenn ich schreibe, ziehe ich mich aus ihr zurück, um eine Perspektive zu bekommen. Wenn man über jemanden schreibt, den man gut kennt, fällt das noch schwerer.
Immer trennt ein Porträt mich von dem Menschen, dessen Nähe ich gesucht habe, um ihn zu beschreiben. Der fremde Blick ist verstörend für den Porträtierten, oft ist er enttäuschend. Und natürlich weiß ich das. Als Guido Westerwelle sterbenskrank wurde, hatte ich das Gefühl, ihm mein Porträt erklären zu müssen. Bei Torsten Preuß habe ich es versucht, es hat nicht funktioniert. Oberstleutnant Mayer hat nie wieder mit mir geredet, obwohl ich ihm immer mal schrieb. Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer fühlte sich nach meinem Text über die Tote im Berghain von mir ausgetrickst. Ich hatte das wirklich nicht vor, habe in den Tagen nach Erscheinen der Reportage aber schlagartig begriffen, dass es darauf nicht ankommt. Ein paar Tage nachdem der Text im »Spiegel« stand, luden mich die Betreiber des weltberühmten, verschwiegenen Berliner Clubs ein und erklärten mir, was in der Nacht passiert war. In einem Hintergrundgespräch, um das ich mich monatelang vergeblich bemüht hatte. Ich flog von Tel Aviv nach Berlin, fuhr ins Berghain und flog dann gleich wieder zurück, beruhigt und schlauer. Ich hätte einen anderen Text geschrieben, eine Woche später. Aber in dem Moment, als er erschien, war er genau das, was ich sagen konnte und wollte. Ich begleite Holger Friedrich bis heute, vielleicht komme ich ihm irgendwann näher.
Meine Reportagen sind Momentaufnahmen. Sie stimmen für mich in dem Augenblick, in dem ich sie beende. Aber das Leben geht weiter. Es verändert die Momentaufnahme, verwischt sie, übermalt sie. Normalerweise.
Als mein Freund und Kollege Thomas, knapp 20 Jahre nach dem Mauerfall, öffentlich als Stasi-IM enttarnt wurde, besuchte ich ihn, als Reporter. Er war jahrelang mein Redakteur, und ich fragte mich, was diese späte Nachricht jetzt mit ihm machte, aber auch mit uns und vielleicht auch mit meinen Texten, die er betreut hatte, angeregt, redigiert. Wir trafen uns in seiner Wohnung und redeten tagelang. Dann zog ich mich in meine Wohnung zurück, die sich im Nebenhaus befand, und schrieb. Ich brauchte ewig, bis ich einen Ton fand. Ich versuchte mich den Erwartungen des »Spiegel«, aber auch denen meines Freundes zu entziehen. Ich rang mir den Text ab. Als er fertig war, schickte ich ihn meinem Redakteur nach Hamburg und meinem Freund ins Nachbarhaus, was eine Ausnahme ist, eben weil er mein Freund war.
Der Hamburger Redakteur sagte, er würde den Artikel nicht drucken, weil er den Eindruck habe, dass sich die Hauptfigur nicht entwickle. Mein Freund wollte nicht, dass der Text erscheint, weil er ihm »nüscht nutzt«, wie er sich ausdrückte.
Ich legte das Manuskript weg und flog erst mal nach Hongkong, um den Weg der Olympischen Fackel nach China zu beobachten. Eine Woche später, zu seinem Geburtstag, rief ich meinen Freund aus der Provinz Hainan an, um zu gratulieren. Es war Nacht in China, die Leitung nach Berlin war schlecht, aber ich verstand gleich, dass nichts mehr war wie früher. Thomas bedankte sich zurückhaltend für meine Glückwünsche, im Hintergrund murmelte die Feier. Wir trafen uns nun seltener. Manchmal redeten wir über den Text. Meist fing Thomas an. Er sagte, ich hätte ihn doch auch öffentlich verteidigen können, wie andere Kollegen es gemacht hatten.
»Aber ich bin Reporter, ich war als Reporter bei dir«, sagte ich.
Er sah mich verständnislos an. Ich dachte, niemand würde mich in dieser Rolle besser verstehen als er, mein Redakteur. Aber vermutlich war das zu viel verlangt.
Vor ein paar Jahren war ich Gastprofessor am Literaturinstitut in Leipzig und besprach den Text mit meinen Studenten, davon abgesehen habe ich ihn nie jemandem gezeigt. Als ich nochmal ein Jahr in New York arbeitete, zog Thomas in meine verlassene kleine Berliner Wohnung in seinem Nebenhaus, um über seine Ehe nachzudenken, sagte er mir. Wir telefonierten ab und zu. Er zog bei mir aus und wieder ein und wieder aus. Er trennte sich von seiner Frau. Ein paar Jahre später, in einer der letzten Nächte bevor ich als Reporter nach Tel Aviv zog, trafen wir uns nochmal in einem winzigen Friedrichshainer Wohnzimmerkino, um einen Film über die Berliner Volksbühne zu sehen. Es war dunkel, verraucht, man musste durchs Fenster einsteigen. Es erinnerte mich an die Berliner Nachwendewinter. Thomas fing wieder an, über den Text zu reden, der inzwischen acht oder neun Jahre alt war. Ich war mit meinen Gedanken schon auf dem Weg nach Israel.
Nochmal anderthalb Jahre später, nach einer Lesung in einem Berliner Theater, für die ich aus Tel Aviv angereist war, erklärte er plötzlich: »Es war ein Fehler, dass ich den Text verhindert habe.« Es war nachts um drei, wir saßen im »Chagall« an der Schönhauser Allee und waren beide ziemlich betrunken, aber ich wurde wieder wach. Der Text war nie erschienen, lebte aber offensichtlich.
Vor ein paar Wochen schickte ich Thomas das Manuskript nochmal und fragte, ob ich es in dieses Buch aufnehmen könne. Wenig später sagte er: »Klar. Guter Text.«
Der »Spiegel«-Redakteur von damals, der den Eindruck hatte, der Held meines Textes entwickle sich nicht richtig, ist inzwischen im Ruhestand. Das Manuskript ist zwölf Jahre alt. Ich habe fast nichts geändert. Es endet mit den Worten: Wir können Freunde bleiben. Es hat ein bisschen gedauert, aber im Moment sieht es so aus, als könnte es funktionieren.
Freunde bleiben. Viel mehr geht nicht, für einen Reporter.
Dieser Reportageband heißt »Das letzte Einhorn«. Es ist der Titel eines Texts über den Fußballer Michael Ballack, der entstand, als seine Karriere zu Ende ging. Ballack war ein Weltfußballer, vergaß aber nie, wie ihn ein Lokalredakteur aus Karl-Marx-Stadt am Beginn seiner Karriere für seinen sehnsuchtsvollen Blick in den Westen kritisiert hatte. Es hätte auch der Titel des Porträts von Torsten Preuß sein können, der als Jugendlicher aus seiner Heimatstadt Dresden ausgewiesen wurde, der Punk war, Kulissenschieber an der Westberliner Schaubühne, später Reporter bei der »taz«, beim Fernsehen und bei der »Berliner Zeitung«, der nach Australien ausreiste, um dort den großen Wenderoman zu schreiben, und irgendwann in ein Deutschland zurückkehrte, das nicht mehr seine Heimat war, weswegen er sich Pegida anschloss. »Das letzte Einhorn« hätte auch über den Porträts von Frauke Petry, Holger Friedrich, Leander Haußmann, des japanischen Friseurs Kagawa, des koreanischen Sportfunktionärs Wang, des Weltdiplomaten Jürgen Todenhöfer, des Bundeswehrsoldaten Mayer, des Eichmann-Anklägers Gabriel Bach, des Parteijournalisten Fritz Wengler und vielleicht sogar über dem von Angela Merkel stehen können, die alle in diesem Buch versammelt sind. Es würde auch gut zum Nachwort von Christoph Links passen, der 30 Jahre lang mein Verleger war und nun in den Ruhestand geht. Alle haben verschiedene Leben, verschiedene Temperamente, verschiedene Erfolge, aber sie schienen mir allein in der Welt zu sein, die Letzten ihrer Art.
Menschen eines Jahrzehnts, in dem einiges zu Ende zu gehen schien.
Am ersten Herbsttag betrat ich die Kapelle des kleinen Friedhofes im Norden von Berlin. Ich war ein bisschen spät, die Trauerfeier hatte bereits begonnen. Es lief »Schwanenkönig« von Karat.
»Wenn ein Schwan singt, schweigen die Tiere
Wenn ein Schwan singt, lauschen die Tiere
Und sie raunen sich leise zu, raunen sich leise zu
Es ist ein Schwanenkönig, der in Liebe stirbt.«
Es erschien mir unwahrscheinlich, dass Dieter Resch sich das Lied ausgesucht hatte. Ich konnte mir nicht mal vorstellen, dass er sich mit dem eigenen Tod beschäftigt hat.
Ein bestellter Trauerredner schilderte Resch als Arbeiter, als Erfolgsmenschen, als Freizeitsportler, als liebenden Vater. Irgendwann, im anthroposophischen Teil seiner Trauerrede, las er ein schwedisches Waldmärchen vor, in dem sich verschiedene Tiere fragen, was das Leben ist. Schmetterling, Biene, Elster, Ameise.
»Was also ist das Leben?«, fragte der Trauerredner.
Dietus hätte eine Antwort, dachte ich, während der Mann am Altar über die Morgenröte redete.
An einem Herbsttag 1988 besuchten Resch, ich und der Wirtschaftsredakteur Rainer Schmidt die Eröffnung einer sogenannten Bestarbeiterkonferenz in Berlin-Lichtenberg, um darüber für die nächste Ausgabe zu berichten. Ich verschlief und kam etwa eine Stunde zu spät. Resch sagte mir, während wir dem SED-Bezirkssekretär Schabowski hinterherliefen, dass mich das eine Flasche Schnaps kosten würde. Als wir am späten Nachmittag wieder in der Redaktion ankamen, erinnerte er mich daran. Ich ging in die Kantine und kaufte ihm eine Flasche seines Lieblingsweinbrandes »Privat«. Resch leerte sie, während er den Text über die Konferenz in seine Schreibmaschine hackte. Rainer Schmidt und ich mussten sein Manuskript redigieren, das im Laufe des Abends immer unleserlicher wurde. Als wir den Text in die Setzerei schickten, war Resch verschwunden. Am nächsten Morgen hörte ich ihn schon wieder in seine Schreibmaschine hacken. Zwei Stunden später wurde ich zum stellvertretenden Chefredakteur bestellt. Auf dessen Schreibtisch lag eine maschinengeschriebene Stellungnahme von Dieter Resch, in der er erklärte, wie er gestern Nacht mit seinem Lada volltrunken in ein Gartentor im Norden Berlins gekracht war. Ich hätte ihn, so stand es in der Stellungnahme, zum Trinken verführt. Der Chefredakteur brüllte mich ein bisschen zusammen.
Resch hatte mich ans Messer geliefert, um seinen Hals zu retten. Er hatte mich nicht mal gewarnt. Als ich ihm das später vorwarf, sagte er nur: »Das Leben ist immer konkret, Alexander.«
Ich konnte mir Dieter Resch beim besten Willen nicht in diesem schwedischen Wald vorstellen. Zwischen den Bienen und Schmetterlingen. Für die Leute in der Kapelle aber schien er da hinzupassen. In der ersten Reihe weinte sein Enkelsohn, eine seiner beiden Töchter aus erster Ehe hielt eine kurze, sehr berührende Rede, in der sie beschrieb, wie Resch versuchte, Kontakt zu ihnen zu halten, als sie Mädchen waren, was für ein guter Vater er war, wie erfolgreich und voller Energie. Später, draußen auf dem Friedhof, erzählte mir Stephan, der damals im Wendejahr am Schreibtisch neben mir gesessen hatte, dass Resch ihn ein Jahr lang jeden Freitagabend zu einem Bahnhof im Norden gefahren hatte, wo seine Frau mit dem Zug von ihrem Fernstudienort eintraf. Resch hatte ein Auto, er nicht. Unter einem Baum stand ein älterer Trompeter und spielte für ihn das Lied vom kleinen Trompeter. Am Grab war ein Bild von Resch aufgestellt, auf dem er uns grinsend mit einem Glas zuprostete.
Reschs Sohn, ein großer, schwerer Mann in einem schwarzen Anzug, der aussah, als trage er ihn nicht oft, schüttelte mir die Hand. Er bedankte sich dafür, dass ich gekommen war, um seinem Vater die letzte Ehre zu erweisen. Sie hätten noch kurz vor seinem Tod darüber geredet, wie er mich damals zum »Spiegel« vermittelt hatte.
Ich nickte. Irgendwie stimmte es ja.
Wir hatten oft das letzte Wort
Wie soll man reagieren, wenn ein Freund und Kollege 20 Jahre nach dem Fall der Mauer als IM der Staatssicherheit enttarnt wird?
Ich lief gerade durch das Kafka-Museum in Prag, als ich eine SMS bekam, die mir mitteilte, dass mein Freund Thomas Leinkauf IM der Staatssicherheit war. Ich weiß nicht genau, ob es einen perfekten Platz gibt, um Nachrichten dieser Art entgegenzunehmen, aber das Kafka-Museum in Prag passt gut. Kein Lichtstrahl fällt in das Haus am Ufer der Moldau, die Wände sind schwarz gestrichen und mit Zitaten bedeckt, man läuft über abschüssige Gänge und durch ein schneckenförmiges Labyrinth, mitunter plätschert am Wegesrand ein Bach, in dem alte Familienfotos und Briefe unter Glas liegen, in denen sich Kafka bei seinem Vater beklagt, aus unsichtbaren Lautsprechern wispern Stimmen. Das ist alles ziemlich bedrückend, nach einer halben Stunde glaubt man, in Kafkas Kopf herumzulaufen.
Die SMS ging so: »Wollte euch nur informieren, dass meine Stasiakte in den Medien ist. Weiteres später. Gruß und schöne Tage. T.«
Ich verließ das Museum und rief Thomas in Berlin an, um ihm ein bisschen Mut zuzusprechen. Er klang nicht sonderlich niedergeschlagen. Er war überrascht, welche Aufmerksamkeit sein Fall in den Medien erregte.
»Ick war sogar in der Abendschau, bewegte Bilder«, sagte er.
»Und jetzt?«, fragte ich.
»Weiß auch nicht, erst mal sehen, was in der Akte steht«, sagte er. Er erzählte, dass er im Moment auch nur wusste, was in den Zeitungen stand. Demnach sei er von 1974 bis 1976 IM mit dem Decknamen »Gregor« gewesen. Es gäbe eine Verpflichtungserklärung, an die er sich nicht erinnern könne. Er habe wirklich nicht gewusst, dass er als IM geführt wurde, sagte er. Ich dachte, wie verwaschen das inzwischen klang, sagte es aber nicht.
Im Frühjahr 1990 hatte ich mit zwei Kollegen aus der Lokalabteilung eine kleine Liste mit Namen von Redakteuren der »Berliner Zeitung« zusammengestellt, von denen wir uns vorstellen konnten, dass sie mit der Stasi zusammengearbeitet haben. Thomas’ Name war auf unserer Liste. Wir gaben sie jemandem vom Bürgerkomitee zur Auflösung der Staatssicherheit. Er fand nichts zu unseren Verdächtigen. Es war eine spielerische Aktion, wir wussten gar nicht, was wir gemacht hätten, wenn der Mann vom Bürgerkomitee jemanden gefunden hätte. Das war 18 Jahre her, und ich wusste immer noch nicht, was ich mit der Neuigkeit anfangen sollte.
Die Sonne schien, Menschen mit Wochenendgesichtern spazierten am Moldauufer entlang. Ich las die SMS meines Freundes nochmal. Er hatte nicht geschrieben: Ich war IM. Er hatte geschrieben: Meine Akte ist in den Medien. Vielleicht wollte er noch einen kleinen Abstand zwischen sich und seine nun öffentliche Rolle bringen, vielleicht hieß es aber auch: Ich habe es doch die ganze Zeit gewusst. Und du auch.
Ich habe Thomas Leinkauf bei der »Berliner Zeitung« kennengelernt, wo ich im September 1987 als Wirtschaftsredakteur begann. Bis zur Wende hatten wir nicht viel miteinander zu tun, wir spielten Fußball in einer Art Betriebsmannschaft, und einmal interviewten wir gemeinsam einen Gartenbauingenieur in Pankow. Einmal pokerten wir bis tief in die Nacht im Großraum der Zeitung, so lange, bis ich kein Geld mehr hatte, um ein Taxi nach Hause zu nehmen, und auf meinem Schreibtisch schlief. Thomas blieb bei Redaktionsbesäufnissen oft bis zum Schluss, hielt sich gern in der Nähe der Chefredaktion auf und wirkte dennoch irgendwie unangepasst, über den Dingen stehend, was auch an dem wiegenden Gang lag, mit dem er sich über die Redaktionsflure schob. Er marschierte nicht, er schlenderte.
Die frühen Wendetage verbrachte Thomas Leinkauf zusammen mit dem späteren Chefredakteur Hans Eggert auf der Parteischule. Sie diskutierten über Glasnost und Perestroika, während Tausende DDR-Bürger in den Westen flohen. Im Oktober beorderte SED-Bezirkschef Günter Schabowski die beiden zurück zur Zeitung, um dort einen Erneuerungsprozess voranzutreiben. Sie stellten sich mit anderen Kandidaten für eine neue Chefredaktion einer Vertrauensabstimmung der Redaktion. Thomas bekam keine Mehrheit und zog sich zurück, obwohl das nicht notwendig gewesen wäre. Eine Kollegin, die weniger Stimmen bekommen hatte als er, wurde stellvertretende Chefredakteurin. Im Sommer 1990 lag er mit blutenden Magengeschwüren im Krankenhaus. Ich besuchte ihn dort, draußen tobte das neue Leben, er trug einen verwaschenen Bademantel und sah aus, als habe man ihn vergessen. Er war 37 Jahre alt, und ich empfand das muffige Krankenhaus in Berlin-Mitte damals als sein Fegefeuer.
An einem Abend im Jahr 1990 hat Thomas mir und ein paar Kollegen in einer Kneipe erzählt, dass er in den siebziger Jahren mal einen Westberliner Studenten in seine Wohnung eingeladen habe, die vorher von der Staatssicherheit verwanzt worden war. Wir hatten alle schon ein paar Bier getrunken, was die Wucht dieses Geständnisses sicher etwas dämpfte. Ich erinnere mich, dass ich Thomas mehrfach darum gebeten habe, den Studenten zu suchen, um herauszufinden, ob er Nachteile durch den Besuch in seinem verwanzten Wohnzimmer gehabt hatte, und sich bei ihm zu entschuldigen. Thomas sagte, er könne sich an den Namen nicht erinnern, und es gab ja auch keine Akte.
Die Akte war der Punkt, auf den sich die deutsche Wendegesellschaft geeinigt hatte. Die Leute mit Akte kamen ins Kröpfchen, die ohne ins Töpfchen. Es war eine dünne rote Linie, die Täter von Nichttätern trennte. Es war kein Gesetz, es war eine Konvention. Sie entließ all die vielen anderen kleineren und größeren ostdeutschen Sünder, die eben nicht mit der Stasi zusammengearbeitet hatten, in die Freiheit. So fügte sich die Geschichte des Westberliner Studenten für mich auf den Haufen der Dinge, die jeder Mitarbeiter der »Berliner Zeitung« aus der alten mit in die neue Zeit schleppte. All die Mitgliedsbücher verschiedener Massenorganisationen lagen dort und natürlich die Artikel aus den Tagen, als wir noch kollektive Propagandisten, Agitatoren und Organisatoren waren.
Thomas’ Haufen war vielleicht etwas größer als meiner, aber er war auch zehn Jahre älter als ich und kam aus einer völlig anderen Familie. In einem Alter, in dem ich als Messdiener dreimal die Woche schlechtbesuchte Morgengottesdienste in der Weißenseer St.-Josef-Kirche ministrierte, besuchte er die Botschaftsschule der DDR in Nordkorea. Als ich mit einem Entstörfahrzeug der Wasserwirtschaft Rohrbrüche in Neubrandenburg behob, trat er mit dem Singeclub seiner Erweiterten Oberschule vor Joachim Hermann auf, der später Chefagitator im Zentralkomitee wurde.
Wir hatten andere ostdeutsche Leben gelebt, aber letztlich hatten sie uns beide in die Redaktion einer Tageszeitung geführt, die der SED gehörte. Thomas schrieb Artikel über den Wettstreit der Ideologien, ich verfasste Erfolgsmeldungen aus dem Werkzeugmaschinenkombinat »7. Oktober«. In den ersten Wendetagen schauten wir aus den Redaktionsfenstern auf den Demonstrationszug in der Karl-Liebknecht-Straße. Ich habe mich oft gefragt, wieso die Demonstranten nicht hineinkamen und die Redakteure, die ihnen jahrelang die Taschen vollgelogen hatten, von ihren Schreibtischen vertrieben. Sie liefen weiter, zu den Stasi- und Parteizentralen und schließlich über die gefallene Grenze. Wir folgten ihnen mit unseren Notizblöcken und kamen so über die Zeit.
Als Erich Böhme Herausgeber der »Berliner Zeitung« wurde, gründete er eine Reportergruppe und machte Thomas Leinkauf zu deren Redakteur. Ich war der einzige ostdeutsche Reporter in der Gruppe, die anderen kamen von westdeutschen Zeitungen und Journalistenschulen.
Wir reisten durch das Land, beschrieben die Wendezeit, wir stritten und feierten zusammen. Wir wurden alle Freunde, und das ist auch das Verdienst von Thomas. Er schrieb nicht, er arbeitete für uns Schreiber. Er ermunterte uns, unseren eigenen Stil zu finden, er hetzte uns aufeinander und hielt uns gleichzeitig zusammen. Er war unser Lehrer und gab uns seine besten Ideen. Im Sommer lud er uns manchmal alle in sein Wochenendhaus am Stadtrand von Berlin ein. Wenn es dunkel wurde, holte er seine Gitarre raus und sang Lieder, oft russische.
Die Gruppe zerfiel nach und nach, Thomas’ Schüler aus jenen Tagen arbeiten heute beim »Stern«, beim »Spiegel«, bei der »Zeit« und beim »Kölner Stadt-Anzeiger«. Thomas blieb bei der »Berliner Zeitung«. Mitte der neunziger Jahre hatte er ein Angebot von Mathias Döpfner, der damals Chefredakteur der »Wochenpost« war und heute Vorstandsvorsitzender von Springer ist. Döpfner wollte Thomas Leinkauf zu seinem Stellvertreter machen. Thomas überlegte lange, sagte Döpfner dann aber ab. Er erzählte mir mal, dass die »Berliner Zeitung« immer im Mittelpunkt der Ereignisse stand, man könnte sich hier auch bewegen und entwickeln, wenn man einfach auf seinem Stuhl sitzen blieb. Bestimmt begriff er auch, dass die Zeitung ihm Schutz bot, nur in ihrem Kontext konnte er seine Entwicklung beschreiben.
Jedenfalls fand er den Mut, dem neuen Chefredakteur Michael Maier die Geschichte vom Westberliner Studenten zu erzählen. Maier nahm das Geständnis zur Kenntnis, aber er konnte Thomas nicht erlösen. Sollte eine Akte auftauchen, sagte er, würde er ihn fallenlassen müssen. Aber es tauchte keine Akte auf, und Thomas machte weiter.
Es gab ein neues Layout und viele neue Kollegen, immer mehr Schichten legten sich auf seine Vergangenheit, er knüpfte ein Sicherungsnetz aus neuen und alten Beziehungen, und er hatte Erfolg. Thomas Leinkauf, der die Seite 3 und das Wochenendmagazin der Zeitung betreute, hat sich über die Jahre sehr erfolgreiche Kolumnen ausgedacht und Texte betreut, die viele wichtige deutsche Journalistenpreise gewannen. Als Maier die Zeitung verließ, bot er ihm an, Textchef beim »Stern« zu werden, aber Thomas blieb.
1999 verließ ich die »Berliner Zeitung« und ging für den »Spiegel« nach New York. Auf meiner Abschiedsparty hielt Thomas eine lange Rede, die vor allem von ihm handelte. Er beschrieb die Qualen eines Redakteurs, der an seinen Schreibtisch gefesselt darauf warten muss, dass ihm andere von der aufregenden Welt dort draußen erzählen. Es klang so, als habe es ihn viel Kraft gekostet, all die Jahre im Schatten zu bleiben.
Von New York aus beobachtete ich, wie sich mein Freund langsam ins Licht bewegte. Er schrieb hier und da einen Leitartikel, manchmal eine Glosse, führte Interviews, und am Ende wagte er sich sogar, Marianne Birthler zu interviewen. Sie redeten über die Staatssicherheit, die Täter und die Opfer, aber die Geschichte seines verwanzten Wohnzimmers kam nicht vor. Vielleicht glaubte er, dieses Gespräch mit der Chefin der Stasiunterlagenbehörde würde ihm die ultimative Sicherheit geben. Der letzte Knoten in seinem Netz.
Und jetzt also gab es doch eine Akte. Nach 18 Jahren. Mein Freund Thomas stand plötzlich auf der anderen Seite der dünnen roten Linie.
Es war seltsam, die Akte zu lesen. Ich war neugierig, und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, einen Brief zu öffnen, der nicht an mich gerichtet war. Manchmal wollte ich die Akte zuklappen und an die Wand werfen, weil ich nicht ertragen konnte, wie mein Freund über seine Kommilitonen berichtet hatte. An einer Stelle erzählt er seinem Führungsoffizier, dass eine Studentin mit jedem intim wird, wenn sie ein bisschen zu viel getrunken hat. Sie hatte einen afghanischen Freund, der in Westberlin studierte, und wenn Thomas und sein Führungsoffizier sich über den »Afghanen« ausließen, schien es, als diskutierten sie über einen Hund.
Thomas Leinkauf beschreibt seinen Unterricht als Philosophiestudent an der Humboldt-Universität, er listet Namen von vorbildlichen Kommilitonen auf, die für eine Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit infrage kommen, und nähert sich gemeinsam mit seinen Führungsoffizieren dem Treffen mit dem Westberliner Studenten, von dem er uns damals im Herbst 1990 erzählt hatte. Die Berichte werden zäh und langweilig, auch weil der Student offenbar nicht hielt, was sich die Staatssicherheit von ihm versprach. Er hat keine richtige Lust mehr auf Klassenkampf, an einer Stelle sagt er, dass dies eine Aufgabe der Studenten aus den unteren Semestern sei. Er müsse sich jetzt mehr um sein Studium kümmern. Man hat das Gefühl, sie reden sich ihr Projekt noch ein bisschen schön, aber oft scheint Thomas Probleme zu haben, überhaupt irgendetwas aufzuschreiben.
Am Ende ziehen sie Thomas Leinkauf von dem Fall ab, auch weil er sich auf den Bändern, die die Staatssicherheit in seiner Wohnung aufnahm, nicht an die vorgeschriebene Strategie hält. Er wird ein unsicherer Kandidat. Im Studium diskutiert er über Bucharin und Trotzki, er besucht eine Lesung von Volker Braun, der kurz zuvor die Resolution gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann unterschrieben hatte, und in einem Armeelager der Universität verweigert er mehrfach die Befehle seiner Vorgesetzten, so dass sie ihn vorzeitig nach Hause schicken. Die Staatssicherheit schließt seine Akte. In ihrem Abschlussbericht steht, dass er eigentlich ein gutes Verhältnis zu den Offizieren im studentischen Armeelager hatte, aber trotzdem nach dem Zapfenstreich Gitarre spielte.
Interessanterweise unterscheidet sich die Person, die aus der Akte wächst, kaum von der Person, die ich kenne. Man spürt keine Angst, Skrupel oder Verunsicherung bei IM »Gregor«, er bewegt sich in wiegenden Schritten durch die Berichte.
Es gibt einen Anfang und ein Ende, alles spielt in den siebziger Jahren. Als Thomas sich das letzte Mal mit der Staatssicherheit traf, war ich 13 Jahre alt. Das Seltsame ist nur, dass jeder Treffbericht in der vertrauten Handschrift verfasst war, in der jahrelang auch meine Manuskripte redigiert worden waren.
Ich habe in den neunziger Jahren für die »Berliner Zeitung« viele Texte geschrieben, die sich mit der DDR-Vergangenheit beschäftigten, nicht wenige handelten von Menschen, die als inoffizielle Mitarbeiter für die Staatssicherheit arbeiteten. Und fast immer war Thomas Leinkauf mein Redakteur. Er betreute meine Porträts über den Radiomoderator Lutz Bertram, den Liedermacher Gerhard Gundermann, den Rockmusiker Jürgen Ehle und über Charlotte von Mahlsdorf, die alle IMs gewesen waren. Es gibt Passagen in manchen Texten, die ich jetzt genauso über Thomas schreiben könnte. Er hat sie nicht verhindert. Das spricht jetzt genauso für ihn, wie es gegen ihn spricht.
In dem Porträt über den Radiomoderator Bertram fragte ich den, wie es ihm möglich war, Christa Wolf nach ihrer Stasivergangenheit zu befragen, ohne seine eigene zu thematisieren. Thomas mit seiner Stasivergangenheit hat demnach einen Text betreut, in dem Lutz Bertram mit seiner Stasivergangenheit sich dafür rechtfertigte, Christa Wolf nach ihrer Stasivergangenheit gefragt zu haben. Es ist, als würde man in eine endlose Reihe von Spiegeln schauen. In solchen Momenten glaube ich zu verstehen, was einen Mann wie Hubertus Knabe antreibt, der in seinem Buch »Die Täter sind unter uns« den Einfluss der Staatssicherheit bis auf den heutigen Tag beschreibt.
Anfang des Jahres hat Thomas Leinkauf im Wochenendmagazin der »Berliner Zeitung« ein Porträt von Knabe gedruckt, in dem der Leiter der Gedenkstätte von Hohenschönhausen als besessener, fast wahnsinniger Stasijäger erscheint. Vielleicht ist es ein Zufall, dass Thomas’ Akte wenig später in den Händen verschiedener Journalisten auftauchte. Vielleicht nicht. In jedem Fall wurde sie in einer Zeit entdeckt, in der um die Geschichte der DDR gestritten wird wie kaum zuvor. Nach den Ostalgieshows kamen Spielfilme, man hat inzwischen das Gefühl, dass aufrechte DDR-Bürgerinnen so aussahen wie die Schauspielerin Veronica Ferres. In fünf Jahren glaube ich wahrscheinlich, dass ich die ersten 26 Jahre meines Lebens auf langen mit kaltem Neonlicht bestrahlten Gängen verbracht habe, links und rechts grünlichgraue Türen, hinter denen jemand brüllt. Die Geschichte gerinnt, alle rühren im Beton, bevor er fest wird. Noch vor ein paar Tagen versuchte Hubertus Knabe, die Ausstrahlung eines ARD-Spielfilms zu verhindern, in dem sich ein Stasiopfer in seinen Vernehmer verliebte.
In solchen Zeiten wird man schnell zum Symbol.
In wenigen Tagen ist mein Freund Thomas zu einer Art historischer Figur angewachsen, an der sich alle bedienen. Die Kollegen in der Redaktion der »Berliner Zeitung« diskutieren an seinem Fall über Glaubwürdigkeit, Erneuerungswillen, Konkurrenzkampf, Charakter, je nachdem. Es gibt Leser, die ihr Abonnement kündigen wollen, wenn Thomas Leinkauf bleiben darf, und solche, die es tun würden, wenn er gehen muss. In einem Leitartikel kündigte der Chefredakteur Josef Depenbrock die vorbehaltlose Aufklärung an, in einer Sprache, die in ihrer Hilflosigkeit an DDR-Kommentare zur Planerfüllung erinnert. In den Feuilletons anderer Zeitungen wird Thomas Leinkauf zum Anlass, um über Schuld, Sühne und deutsche Fehler bei der Vergangenheitsaufarbeitung nachzudenken. Die »Süddeutsche Zeitung« nutzt ihn, um klarzumachen, wie viele ehemalige Nazis in der Bundesrepublik berühmte Journalisten geworden sind. Thomas steht dort in einem Zusammenhang mit einem ehemaligen »Stern«-Redakteur, der im Dritten Reich an Massenerschießungen teilnahm. »IM Deutschland« heißt der Text. Mein Freund hat die Größe eines ganzen Landes, als ich ihn das erste Mal wieder besuche.
Er steht scheu in seiner Wohnungstür und schaut in den Flur, ob die Luft rein ist. Er hat keine Ahnung, was die Leute im Haus wissen und was sie denken, sagt er. Ich fühle mich, als betrete ich eine konspirative Wohnung, und er merkt das. In den ersten Tagen nach seiner Enttarnung nahm er sich in der Redaktion sein Mittagessen mit aufs Zimmer, um niemanden in die Verlegenheit zu bringen, sich an seinen Tisch zu setzen. Jede Geste wird in der hitzigen Atmosphäre der Zeitung zu einem Statement.
Er hat ein paar Dokumente aus seinem Leben auf dem Wohnzimmertisch ausgebreitet. Ein Studienbuch der Humboldt-Universität, ein paar Arbeitsverträge, Bewerbungen, Briefe, Zeitungsausschnitte, Fotos aus seiner Kindheit und Jugend. Es ist ein Gegenentwurf zu der Akte, die ich unterm Arm habe. Ein Leben gegen 140 Seiten Papier.