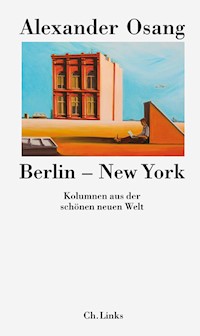9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Literarische Publizistik
- Sprache: Deutsch
Die "Stumpfe Ecke" ist eine alte Arbeiterkneipe in Berlin. Bei einigen Bier kann man hier Lebensgeschichten erfahren, die sonst kaum zur Sprache kommen. Man erfährt etwas von Kohlen-Kalle und seinem Knochenjob, den Abenteuern eines umgeschulten Privatdetektivs, den kurzen Freuden eines Karnevalsprinzen, der Liebe zu einem Fußballclub und dem Ende des guten alten Landfilms.
Alexander Osang liefert keine Porträts im engen Sinne, sondern gesellschaftliche Momentaufnahmen, feinsinnige Reportagen über Ereignisse, bei denen die Menschen viel von sich preisgeben und seltene Einblicke ermöglichen.
In einem ausführlichen Gespräch mit dem Filmemacher und Autor Alexander Kluge beschreibt der mehrfach preisgekrönte Reporter Osang seine Arbeitsmethode, seine literarischen Vorbilder und seine neuen Erfahrungen in New York.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Alexander Osang
Die stumpfe Ecke
Alltag in Deutschland25 Porträts
Mit einem Interview von Alexander Kluge und Fotos von Wulf Olm
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
1. Auflage als E-Book, Mai 2018
entspricht der 3., erw. Druckauflage vom März 2002
© Christoph Links Verlag GmbH
Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0
www.christoph-links-verlag.de; [email protected]
Cover: KahaneDesign, Berlin
unter Verwendung eines Fotos von Wulf Olm
eISBN 978-3-86284-421-0
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Über den Unterschied zwischen »Stumpfer Ecke« und »V.I.P.-Schaukel«
Eine Gulaschsuppe, ein Bier
Kohlen-Kalle, Willy, Conny, Kurt und der Heizer vom Kino UT verbringen die ersten Stunden des Tages in der alten Oberschöneweider Kneipe »Stumpfe Ecke« – Und manchmal bleiben sie auch länger
Frau Breuel war wieder nicht da
Erika Rusch ist es egal, ob sie für DDR-Minister kocht oder für Treuhand-Manager
»Die können wir unseren Fahrgästen nicht zumuten«
Günther Krause wurde vom Major der Staatssicherheit zum Straßenbahnfahrer im Schichtdienst degradiert – aber auch im Fahrerhaus findet er keine Ruhe
Ein Mann für einen Bankraub
Andreas Hesse ist auch mit der schönsten Karnevalsprinzenkappe immer nur Andreas Hesse
Nur stille in der Ecke stehen und zusehen, wie die feiern
Horst Schulz und Manfred Michaelis reden über das Trinken, die Einsamkeit, ein paar Wünsche und den Knacks im Leben
Sie haben immer mal an seiner Wohnungstür geschnuppert
Frank W. lag fast ein Jahr lang tot in einem Berliner Hochhaus
Ein Galopper zieht keinen Kohlenwagen
Über Trainer Erich Schmidtke und seine halbblinde Stute, über Alfred Karategin und seine tote Frau, über den großen Henry Czablewski und sein Pech – über die Trabrennbahn Karlshorst
War Harry schon da?
Privatdetektiv Pannenberg hatte schlechte Zeiten und sehr schlechte
In Seelow schweigen nicht nur die Lämmer
Heinz Rachut gab die letzte Vorstellung im Oderbruch
Anne, bist du’s?
Liselotte Flauß und ihre drei besonnenen Kolleginnen einer kleinen Sparkassenfiliale erlebten bereits acht Banküberfälle
Vietnamesen schwitzen nicht so stark wie deutsche Arbeiter
Binh Luong Hoa und die letzten Normbrecher in einer Thüringer Lederfabrik
»Mein Heim ist doch kein Durchgangszimmer«
Wie der Rostocker Familienvater Hans-Dieter Witt das leidige Asylantenproblem lösen würde
»Ick lass’ jetze allet uff den Endpunkt zuloofen«
Barbara Meyer und ihre Biesdorfer Großfamilie fühlen sich in ihrem neuen Leben immer wieder »übern Nuckel barbiert«
»Ich mußte zehn Jahre auf meinen Skoda warten. Na und?«
Dieter Gotthards Leben in der Braunkohle schlug keine Haken
Wollmamawidder
Heiko Hartmann und die Kokerbrigade der Magdeburger Großgaserei frühstücken
Nie verfluchte er die Maschine, die Firma oder Gott
Hans Reichenbacher verlor vor fünfundzwanzig Jahren seine rechte Hand in einer Presse
Zehn leere gegen zehn volle
Achim Schwarz, Held der Arbeit, wartet, daß es dunkel wird
Moni iss in ihren Suff uff Strümpe los
Polizeiobermeister Thiemann sucht eine hilflose Person
»Ost-Ost-Ost-Berlin!«
Kompotti und seine Freunde haben nur eine große Liebe: den 1. FC Union Berlin
Ick bin doch Mäcki, kennste ma nich?
Reinhard Lauck hat ein allerletztes Mal versucht, Fußball zu spielen
Die scharfe Nockenwelle
Müller kachelt mit 148 PS und ohne Fahrerlaubnis durch den Prenzlauer Berg
Vier Männer in einem Zelt, das im Regen steht
Der Frankfurter Sozialdezernent Christian Gehlsen hofft, daß Quantität in Qualität umschlägt
Fünfundzwanzig Kalikumpel laufen durch ein totes Land
Andreas Ihsenmann hat vierhundertfünfzig verregnete, zugige Kilometer lang auf eine Lawine gewartet, und es hat nicht einmal gerumpelt
Ein Pferd geht länger als eine Kuh
Was Bauer Lengfeld über das hochmoderne Gewerbezentrum denkt, das vor seinem Hoftor aus dem Acker wuchs
Mann, war das ein Jahr!
Olaf Buse fährt nach Bayern, Scheunemann erwartet keine Höhepunkte, Bodo Höflich hat viertausend Nasse und Czichos will nicht nach Spanien
Alexander Kluge im Gespräch mit Alexander Osang
Quellenverzeichnis und Fotonachweis
Über den Autor
Vorwort
Über den Unterschied zwischen »Stumpfer Ecke« und »V.I.P.-Schaukel«
Einmal war ich Talkgast. Das Thema der Talkshow lautete: Kommunalpolitische Interessen und ihre lokaljournalistische Umsetzung oder so ähnlich. Klang langweilig, ich wußte nicht andeutungsweise, worum es gehen soll, habe aber aus lauter Eitelkeit zugesagt. Und, weil Regine Hildebrandt versprochen hatte, auch zu kommen. Leider fehlte sie zuerst. Da saßen nur ein CDU-Politiker aus Oranienburg, der PDS-Vorsitzende Lothar Bisky, ein lustiger, älterer Professor aus Süddeutschland und jemand von einer Potsdamer Werbeagentur.
Die Diskussion begann etwas schleppend, aber dann kriegten sich der CDU-Mann und der lustige Professor in die Haare, und schließlich mischte sich auch Bisky ein. Nur der Mann von der Werbeagentur und ich hatten noch nichts gesagt. Ich hatte auch nicht das Bedürfnis. Ich trank Wasser, hoffte, daß mich jemand anspricht und dem Mann von der Werbeagentur auch nichts einfällt. Doch dann meldete er sich zu Wort und redete nicht einmal Unsinn, wie ich fand.
Das ganze begann mich an meine schlimmsten Seminare in Politischer Ökonomie zu erinnern, in denen ich heimlich durchzählte, wer außer mir noch nichts gesagt hatte. Es wurden immer weniger, immer weniger, bis ich schließlich ganz allein dasaß …
Ich goß Wasser nach und wartete auf eine Idee. Schließlich ging die Tür auf und Regine Hildebrandt stürzte herein, brüllte: »’N Abend. Tschuldigung, dit ick zu spät komme« und riß die Diskussion dankenswerterweise für eine Viertelstunde an sich. Sie beschimpfte Bonn, die CDU, den Westen und ein bißchen auch die Journalisten. Sie stocherte drohend mit dem Finger in meine Richtung, was meine erste Äußerung, ein kokettes Na-Na-Na-Räuspern, möglich machte, welches mir eigenartigerweise eine gewisse Erleichterung verschaffte. Ich hoffte, daß das Publikum vielleicht vergessen könnte, daß ich der einzige war, der noch nichts gesagt hatte.
Aber irgendwie lief dann alles weiter wie bisher, alle redeten, nur ich nicht, die Talkrunde näherte sich ihrem Ende, wahrscheinlich hielt man mich im Publikum für den Ziehungsleiter oder den Notar, mein Mineralwasser war schon lange alle, ich hatte immer noch keine Vorstellungen vom Zusammenhang zwischen Kommunalpolitik und Lokaljournalismus, da sprach mich die Moderatorin an. Ich lächelte in das große schwarze Loch.
Und redete los. Ich berichtete von der Unterhaltungsfunktion des Journalismus, davon, daß Politiker aber oft langweilige Sachen sagen, selbst Kommunalpolitiker, und sich deshalb nicht zu wundern brauchen, daß sie sich kaum in der Presse wiederfinden. Niemand widersprach, mehr noch, ich glaubte, in einer der hinteren Reihen ein zustimmendes Nicken erkannt zu haben. Ich redete weiter und weiter, schließlich endete ich mit der Feststellung, daß die Presse vor allem ein Gewerbe und im übrigen nur eine schlechte Nachricht überhaupt eine Nachricht sei.
Die erste Reihe guckte zweifelnd. Regine Hildebrandt bellte kurz: »Dabei sehen Sie ganz vernünftig aus, junger Mann«! Der Saal lachte. Mir fiel nichts ein. Die Moderatorin sprach das Schlußwort, dann meldete sich noch einmal Regine Hildebrandt und sprach ihr Schlußwort, dann war aus. Ein Alptraum ging zu Ende.
Das sollte mir nicht noch einmal passieren.
Von nun an sah ich Talkshows aus anderem Blickwinkel. Ich saß nicht mehr vorm Fernseher, ich saß bei Biolek im Korbstuhl, lümmelte auf Gottschalks Couch, stand bei Meyer an der Schranke. Ich gab Antworten. Ich trainierte Antworten. Schnell, schlagfertig, komisch. Die besten Antworten sind universell einsetzbar. Sie haben nichts mit der Frage zu tun. Was interessiert die Frage, wenn der Saal über die vermeintliche Antwort brüllt. Ich wußte nun, daß ich, statt blöd zu grinsen, Frau Hildebrandt ins Gesicht hätte schleudern müssen: »Gerade Sie müßten doch wissen, daß man Menschen nicht nach ihrem Äußeren einschätzen soll.«
Ich begriff, wie man zum perfekten Talkshowgast wird. Und endlich wußte ich auch, warum Prominente in Talkshows und in Interviews immer das gleiche erzählen. Die universell einsetzbaren Antworten!
Es ist ja so: Selbst der abgebrühteste Journalist behält immer ein wenig Hoffnung, daß er dem berühmten Menschen mehr entlockt, als alle anderen Reporter zuvor. Er bildet sich ein, bessere, intelligentere, überraschendere, andere Fragen zu stellen und dafür ehrlichere Antworten zu bekommen. Und die Prominenten tun auch so, als sei man der erste, dem sie das jetzt erzählen. Und natürlich spielt man mit. Obwohl man die Pointe mitsprechen könnte.
Gunter Emmerlich vertraute mir an, welche Augen sie in der ersten Reihe machten, als er Helga Hahnemann zurief, sie sei als Schokoladenmädchen nicht die einzige Fehlbesetzung im Lande. Hundertmal gelesener Beweis seiner Aufmüpfigkeit. Der Berliner Jugendsenator Thomas Krüger prahlt seit Jahren damit, daß er immer noch aus den sozialistischen Balladen von »Kuba«, Kurt Barthel, zitieren kann, und der Fußballer Frank Rohde berichtete mir, was ich aus der Zeitung wußte: Er hat im Politunterricht beim BFC Dynamo immer geschlafen. Ein verführerisch gutes Bild für sanften Widerstand.
Deshalb schreibt man es auch immer wieder auf. Die Journalisten sind die, die das Spiel begonnen haben. Sie fragen und fragen und fragen, sie zwingen die Prominenten zum Stereotyp. Weil, soviel neue Geschichten gibt’s nicht einmal in einem abwechslungsreichen Prominentenleben zu erleben.
Gut zu wissen, daß auch Journalisten in die von ihnen ausgelegten Fallen tappen. Sobald sie prominent sind. Als die Reporter der Berliner Zeitung einmal, was wirklich nur ganz selten vorkommt, ein Bier mit unserem Herausgeber Erich Böhme tranken, fragten wir ihn nach seiner Talkshow zum Thema »Outing«, die durch die Anwesenheit des völlig zugedröhnten, schwer lallenden Schauspielers Helmut Berger einen gewissen Kultstatus erlangte. Böhme überlegte einen Moment, lächelte kurz und sagte dann: »Was wollen Sie denn, das paßte doch zum Thema. Der Berger hat sich doch selbst geoutet.« Geradeso als sei ihm diese kleine Wortspielerei eben eingefallen, erzählte er es. Ein paar Tage später las ich in einem Wochen vorher geführten Stern-Interview mit Erich Böhme eben diesen Satz. Genau die gleiche Formulierung.
Manchmal trifft es einen nach all den Porträts immer noch wie am Anfang. Man will einfach nicht glauben, daß sie das alles schon zigmal erzählt haben. Daß man, je nach dem Bekanntheitsgrad seines Gesprächspartners, nur der dritte, vierte oder fünfzigste ist, dem er die Geschichte jetzt auftischt. Sie wissen ganz genau, was ankommt. Sie schmücken es aus, feilen an den Pointen, bis sie hundertprozentig passen, manchmal erzählen sie sie auch immer wieder deckungsgleich. Und irgendwann, wenn sie richtig bekannt sind, besteht ihr ganzes Leben aus kleinen lustigen Geschichten. Eine Perlenschnur von Anekdötchen, die sie hunderte Male erzählt haben.
Das ist ein bißchen tragisch für sie. Und ein bißchen langweilig für die Journalisten. Wenn man aber überlegt, was für interessante Lebensgeschichten, Beichten und einmalige Schicksale von weniger prominenten Menschen ein Reporter so wegwirft, ist es sogar ein bißchen ärgerlich.
Neulich habe ich Anton Odars Lebensbeichte weggeworfen.
Wir saßen in einer verräucherten Kneipe in Waltersdorf bei Berlin. Ein kleines Dorf, dem gegenüber ein riesiges hochmodernes Einkaufszentrum aus dem märkischen Acker gewachsen war. Ich recherchierte ein bißchen rum, redete mit dem halben Dorf und traf Odar in der »Hecke«, einer Imbißbude, in der man nicht weiß, ob einem vom ranzigen Pommesöl, dem Zigarettenqualm oder dem Bauarbeiterschweiß die Augen tränen. Weil das Flaschenbier billig ist und Odar sowieso den ganzen Tag zu Hause sitzt, kommt er manchmal abends hierher. Meistens sitzt er allein am Tisch, der neben der Getränkeluke steht. Er ist ein Außenseiter geblieben.
1940, als Odar sieben Jahre alt war, kam seine Familie aus Jugoslawien zurück ins Reich. Sie landete in Waltersdorf, sein Vater fand Arbeit im Flugzeugmotorenwerk, ging dann zum Volkssturm nach Berlin und wurde später von der sowjetischen Administration als »Verantwortlicher« herangezogen, weil er die russische Sprache von allen Dorfbewohnern am ehesten deuten konnte. »Er war ein ziemlich beweglicher Typ«, sagt Odar.
Sein Vater wurde LPG-Chef und 1950, als Odar siebzehn Jahre alt war, von einem LKW der Nationalen Front über den Haufen gefahren. Es war glatt, der LKW war irgendwie ins Schleudern gekommen und hatte den alten Odar vom Fahrrad gerissen. Sie luden ihn auf und fuhren ihn ins nahegelegene Krankenhaus Hedwigshöh, dort gab ihm eine Krankenschwester ein Bier und schickte ihn erst mal wieder nach Hause. Anton Odar hakte seinen Vater unter, gemeinsam stapften sie über die Felder zurück. Am nächsten Morgen war der Vater tot. An inneren Blutungen verstorben. Niemand stellte die Schuldfrage.
Odars Mutter begann als Reinigungskraft zu arbeiten, er selbst fing im Betonwerk Grünau als Anlagenfahrer an. Er heiratete, zeugte drei Kinder und tat alles dafür, daß sie studieren konnten. Sie studierten, heute sind sie arbeitslos. Wie die Eltern. Der Sohn, ein diplomierter Lebensmitteltechnologe, findet vielleicht, wenn alles gut geht, eine Arbeit als Tischler.
1991 haben sie Odars Wohnhaus weggerissen, weil genau dorthin der neue IKEA-Markt hingesetzt werden sollte. Es war nur ein altes schäbiges Mietshaus, und man hat den Bewohnern neue Eigentumswohnungen am anderen Ende des Dorfes dafür geschenkt. Keiner konnte sich vorstellen, daß Odar und seine Frau trotzdem traurig waren, als sie die letzte Kiste aus dem Haus trugen, in dem sie die längste Zeit ihres Lebens verbracht hatten. Deswegen hat es Odar auch gar niemandem erzählt.
Seine Frau hat sich nicht gewehrt, als sie nach dreißig Jahren als stellvertretende Bürgermeisterin, nie in der Partei und jeden Tag zehn, zwölf Stunden gearbeitet, von der jungen Karrieristin, die gleich nach der Wende aus der SED austrat, einen Tritt in den Hintern bekam. »Es ist eben so«, pflegt ihr Mann zu sagen. Eine Haltung, die er hat, seit sie ihn in der Schule als Ausländerkind hänselten.
Wir haben drei, vier Stunden in der Kneipe gesessen. Zum Schluß waren Odars Wangen ganz rot. Ein bißchen von den Schnäpschen, ein bißchen vom Erzählen. Er hätte gar nicht gedacht, daß er soviel zu berichten hat.
Ein paar Tage später habe ich ihn noch mal in seiner Wohnung besucht. Als seine Frau erzählte, wie sie rausgeschmissen wurde, ist Odar rausgegangen, in die Küche, weil er weinen mußte. Wir haben wieder lange geredet, über das Leben auf dem Dorf. »Wir sind hier irgendwie hängengeblieben«, sagt Anton Odar.
Als ich ging, fragte mich seine Frau: »Sie haben ja alles mitgeschrieben, was wir gesagt haben. Was wollen Sie eigentlich mit dem ganzen Zeug? Das interessiert ja doch keinen.«
Ich habe ihr widersprochen, natürlich. Aber in meinem Bericht über Waltersdorf und sein Gewerbegebiet tauchten weder Anton Odar noch seine Frau auf. Ich hoffe, die beiden haben ihn nicht gelesen. Sie hätten sich wohl bestätigt gefühlt, daß ihr Leben niemanden interessiert.
So ein kleines, einfaches Leben, ohne Höhepunkte.
Dezember 1993
Eine Gulaschsuppe, ein Bier
Kohlen-Kalle, Willy, Conny, Kurt und der Heizer vom Kino UT verbringen die ersten Stunden des Tages in der alten Oberschöneweider Kneipe »Stumpfe Ecke« – Und manchmal bleiben sie auch länger
Früh um fünf hat Willys Kopf noch Ruhe. Die Dunkelheit ist allmächtig, weil Willy sie nicht löschen kann. Ihm fehlt der Strom. Sie haben ihn abgeschaltet. »Sie«, die andere Macht neben der Dunkelheit, der Willy chancenlos ausgeliefert ist. Ein undurchsichtiger Cocktail aus Treuhand, dem »Verkehrsministerarsch«, der »Zicke vom Arbeitsamt«, der Ebag und der Wohnungsbaugesellschaft Köpenick, zusammengemixt und über Willy ausgegossen. Wenn Willys schwerer, geschundener Kopf träumt, dann davon, nicht allzu zeitig aufzuwachen.
Er kann jetzt noch nicht runter in die Kneipe gehen. Seine Zeit beginnt erst um zehn, wenn die Nachtschicht raus ist, und endet um halb zwei, bevor die Frühschicht kommt. In diesem Zwischenraum sieht er seine Freunde. Freunde ist vielleicht zuviel gesagt. Sagen wir: Ansprechpartner. Conny, Kurt, den Heizer vom Kino UT, Klaus, der jetzt immer mal seine Frau mitbringt, Müller, Peter, »den du nie besoffen erleben wirst«, und natürlich Kohlen-Kalle.
Gegen halb sechs erfährt die Wilhelminenhofstraße ihren ersten Wiederbelebungsversuch. Richtig atmen wird sie den ganzen Tag nicht mehr, dazu ist sie schon zu tot. Zumindest rumpeln nun ein paar Straßenbahnen durch das alte Berliner Industriegebiet Oberschöneweide. Es stehen nicht mehr allzu viele Leute in ihrem matten Licht. Die Verkehrsbetriebe konnten den Fahrplan entschlakken, denn nur ein Bruchteil der ehemaligen KWOer, TROer und WFler müssen in diesen Zeiten noch zur Arbeit. Und die Autos stauen sich nur auf den Straßen, die aus Oberschöneweide hinausführen.
In den Fenstern der Wohnhäuser, die den alten backsteinernen Fabrikgebäuden gegenüberstehen, hängen keine Schwibbögen. Es ist ja kaum noch jemand da, der sie anzünden könnte. Die meisten Wohnungen stehen leer, die Häuser warten widerstandslos auf ihren Abriß. In den Erdgeschossen hat man die Leichen mit ein paar bunten Jeansshops, Bäckerläden, Zeitungskiosken und Fernsehgeschäften geschminkt. Dazwischen trotzt die Kneipe »Stumpfe Ecke« seit den zwanziger Jahren allen Krisen.
Um sechs duscht die Nachtschicht des Kabelwerkes, um sechs leiert Jörg Wietrychowski die grauen Rollos seiner Kneipe hoch. Früher, als im KWO noch fast sechstausend Leute gearbeitet haben, drängte sich um diese Zeit schon eine geduschte Menschentraube vor der Tür. Heute steht da niemand anderes als die dunkle Nacht. Viertel sieben kommen die ersten. Drei Hände voll abgekämpfter Nachtschichtler und zwei, drei Leute, die nicht mehr schlafen können.
Es ist kalt in der »Stumpfen Ecke«, und aus dem frisch geheizten Ofen qualmt es. Die Arbeiter stürzen die ersten beiden Biere runter, rauchen und verlieren die zwei obligatorischen Spielautomaten, die in der Ecke baumeln, nicht aus den Augen. Viel geredet wird nicht.
Früher spannte sich ein langer Doppeltresen quer durch den Raum. Die Jungs von der Nachtschicht warteten in vier dichtgeschlossenen Reihen davor auf das nächste Bier. Zwei Wirtsleute zapften unentwegt Gläser voll, die drei Kellnerinnen schnellfüßig zu den Verbrauchern schleppten. Heute schaffen Jörg und Conny Wietrychowski das bequem zu zweit. Den alten Doppeltresen gibt es nicht mehr. Der Wirt hat ihn rausgeschmissen, genau wie das restliche Mobiliar, er hat Holztische und Stühle hingestellt, die man bei gutem Willen rustikal nennen kann. Der neue Tresen sieht aus wie eine Anbauwand. Mit Glasteil. Der Wirt findet das gemütlich und seine Gäste auch.
»Dit war eine totale Räucherkneipe, uff deutsch gesagt«, erinnert sich Hans-Joachim Hörnicke, der hier seit den fünfziger Jahren verkehrt. »Das Bier hatte nie eine Blume. Weil es so schnell ausgeschenkt wurde«, ergänzt Peter Conrad. »Du hast dich beeilt, als erster unter der Dusche zu sein, und bist dann praktisch im Laufschritt rübergerannt, um noch einen Platz zu kriegen«, weiß Andi, der Maschinenhelfer. Ja und hinten, da wo jetzt die hölzerne Sitzgruppe steht, gab es zwei lange Tische, die für sie, die Starkstromkabelhersteller, reserviert waren. Tische, die nie leer wurden. Die Gäste wechselten im Schichtrhythmus. Je mehr sie darüber reden, desto sentimentaler werden ihre Klagen. Irgendwie war es ja doch schön. »Damals«, faßt es Vorarbeiter Peter Conrad zusammen, »sind wir hier rübergekommen, weil es Spaß machte, heute kommen wir aus Frust.« Seine Kollegen nicken zustimmend. Die nächste Runde trifft ein.
Wir bleiben ein bißchen bei den alten Zeiten, die bei jedem Bier besser und lebendiger werden. Conrad, der neunundzwanzigjährige Vorarbeiter, erzählt die unglaubliche Geschichte aus der Berliner Akkumulatorenfabrik, wo er einst gearbeitet hat. Von »hochwertigen« Giften spricht er, vor allem von Blei. »Die Leute hatten gelbe Gesichter, die Zähne fielen ihnen aus, und die Fingernägel wuchsen nicht mehr. Aber die Kohle hat gestimmt. Leider mußte ich aus gesundheitlichen Gründen aufhören.« Leider!
Er wechselte ins KWO, weil auch dort die Kohle stimmte. »Ich hab zwar gearbeitet wie ein Ochse, wenn ich dann aber am Tresen stand und hab den Leuten gesagt, ich verdiene fast zweitausend Mark im Monat, da war Ruhe in der Kneipe. Mensch, da haste doch noch was dargestellt.« Glucksend läuft das Bürgerbräu in Conrad. »Und heute traust du dich kaum noch zu sagen, daß du immer noch in einem der Großbetriebe arbeitest. Du schleichst hier aus’m Tor, damit dich ja keiner erkennt.« Er sei stolz gewesen damals, aus dem Kabelwerk zu kommen.
Und weil’s so schön ist, hängt Conrad die MMM-Geschichte gleich noch mit ran. »Regie 2000« hieß das Gerät, das er in der Jugendneuererbewegung »Messe der Meister von morgen« mitentwickelt habe. »Das war ein Knüller, Mann. Zum Schluß stand das Ding auf einem goldenen Tablett auf der Messe. Die haben sich fast drum geprügelt.« Ja, damals spielte der 1. FC Union auch noch in der Oberliga.
Heute verdient Andi nicht einen Pfennig mehr als vor der Wende und erinnert sich an den Einigungsvertrag. »Die Mieten sollten proportional zu den Einkommen steigen. Ich hab früher tausendvierhundert Mark verdient und verdiene jetzt tausendvierhundert. Aber meine Wohnung kostet inzwischen vierhundertfünfzig Mark, kalt.«
Die Redefetzen schnippen wie eine Flipperkugel zwischen »MMM« und »SED-Regime« hin und her. So richtig wissen die Jungs nicht mehr, auf wen sie schimpfen sollen. Da sind die Angestellten, »die die dicke Kohle abfingern«, »Stasi-Typen, die bei uns noch gigantische Abfindungen kassiert haben«, andererseits ist da ein neues Berlin, das immer »irrer« wird, »vor allem, wenn jetzt noch die Bonzen aus Bonn anrücken«. Jemand schlägt vor, aufs Dorf zu ziehen, am besten ins Land Brandenburg. Langsam dämmert es in der Wilhelminenhofstraße.
Peter Conrad wundert sich, daß man die überproduzierten Kabeltrommeln auf ihrem Werkhof zerstört, »statt sie an Entwicklungsländer zu verschenken«, fünf Sätze später stellt er fest: »Deutschland soll sich erst mal alleine aus dem Dreck ziehen, bevor es sich um andere kümmert.« Sie trinken mehr als ihre üblichen drei Schlafbiere. Irgendwann sagt Andi: »Wer rumhängt, ist selber schuld. Arbeit gibt es immer. Wenn die Leute sich gehenlassen, guck ich schon mal weg. Auch wenn’s ehemalige Kollegen sind.«
Hörnicke ist leise geworden. Fünfzehn Tage hat er noch zu arbeiten. Dann ist Schluß. Es wird wieder eine Nachtschicht sein, gefolgt von einem Tag, an dem er die übliche Runde durch die Verwaltung dreht. 1952 hat er im Kabelwerk angefangen, jetzt ist er fünfundfünfzig, und der Winter steht vor der Tür. Im Sommer hat er seine Laube.
Draußen hat die Dämmerung die Nacht besiegt. Leise und unbemerkt haben sich die ersten beiden Trinker dieses Tages auf die Tische neben dem Klo verteilt. Ihre Gläser stehen ordentlich ausgerichtet vor ihnen. Sie leeren sie in den erforderlichen Schüben. Hörnicke trinkt aus und zahlt. Er ist heute schon viel zu lange hiergeblieben. Er will nicht in die Zukunft sehen. Bleib nie länger als drei Bier. Mehr brauchst du nicht, um schlafen zu können. Der Rest bringt dich den Gestalten näher, die jetzt kommen. Hörnicke hat noch Arbeit. Er geht.
Es scheint ein schöner Tag zu werden. Die Sonne leckt nach den Kneipengardinen, hinter ihnen sieht man die prächtigen gelben Backsteine der KWO-Verwaltung. Conrad, Andi und Heinrich haben den Absprung verpaßt. Zwei beschäftigen einen der Automaten, und Conrad pflegt seine sentimentale Stimmung. Sein Blick tastet die frisch getäfelten Kneipenwände ab, mißbilligend taxiert er die beiden Schlipsträger, die sich auf ein Kännchen Kaffee an den Tresen verirrt haben, mitleidig mustert er die Trinker, deren Zahl sich verdoppelt hat. Vier Mann, vier Tische, kein Wort. »Kiek dir den an, der will doch arbeiten«, sagt er und nickt zu einem Mann, dessen Gesichtsfarbe und Garderobe noch halbwegs in Ordnung sind. »Aber er kann nicht. Man läßt ihn nicht. Der kommt hierher, weil er jemanden zum Quatschen braucht. Und dann findet er nicht mal den. Der beneidet uns, daß wir hier stehen und reden, original.«
Zwischen dem sechsten und siebenten Bier kommt Conrad auf den überraschenden Gedanken, findige Unternehmer könnten ein Museum aus seiner Stammkneipe machen. Er hält das für keine gute Idee. Weil Arbeiter, seiner Meinung nach, nicht ins Museum gehen. »Das hier ist die Kultur der Arbeiter. Die Kneipe. Hier reden sie. Statt vierzig Mark für ’ne Konzertkarte auszugeben, würde ich auch immer lieber in die Kneipe gehen. Da wirste wenigstens nicht lebensfremd. Frag doch mal jemanden von denen, ob er in den letzten zehn Jahren im Theater, in der Oper oder im Konzert war. Da hebt sich kein Arm.« Die Verbliebenen sehen so aus, als könnte Conrad recht haben.
Es ist die tote Zeit der »Stumpfen Ecke«. Die Nachtschichtler sind eigentlich schon weg, und die Stammgäste noch nicht da. Zwischen acht und zehn gibt es hier nur einsame Trinker und Zufallstreffer.
Andi und Heinrich sind mit dem Spielautomaten zusammengewachsen. Conrad hält das Schlußplädoyer. »Ich bin froh, daß es in Ost-Berlin noch solche Kneipen gibt. Wenn alle in den Sack hauen, kannste Oberschöneweide gleich dichtmachen. Dann wird das hier zum totalen Frustgebiet. Das wäre echt schade, weil Ost-Berlin sein letztes Stückchen Seele verlieren würde.«
Ein gebückt gehender Mann mit Rock’n’Roller-Frisur vertreibt den Kneipenpoeten. »Hallo«, ruft er in den Kneipenraum, bestellt ein Kännchen Kaffee und breitet die Zeitung aus, die er mitgebracht hat. »Kohlen-Kalle«, erklärt Peter Conrad. »Das ist Kohlen-Kalle. Der hat dreißig Jahre lang Kohlen geschleppt. Und so läuft er auch. Der ist eins von den kleinen Schicksalen, die hier so rumlaufen.« Die Männer aus dem KWO lösen sich in Luft auf. Ihre Zeit ist abgelaufen. Es ist kurz nach elf. Die Sonne knallt jetzt erbarmungslos in den Zigarettenrauch. Die Gesichter der einsamen Säufer leuchten wie Warnblinkanlagen.
Kohlen-Kalle setzt sich zu Kurt, der krankgeschrieben, aber eigentlich arbeitslos ist. Kalle raucht Roth-Händle, schrubbt sich mit dem Bimsstein immer den Tabak von den Fingern, bevor er zu seiner Ärztin muß, und hat genaugenommen vierunddreißig Jahre lang Kohlen geschleppt. Bis die Währungsunion kam und der private Kohlenhändler, für den er huckte, dichtmachte. Geblieben sind seine Kontakte. Kalle kennt jeden in Oberschöneweide. Und er hat einen Tagesplan gegen die Langeweile.
Morgens holt er sein Fahrrad aus dem Keller, fährt die Zeitung holen, dann kommt er in die »Stumpfe«, trinkt ein Kännchen Kaffee und liest die Zeitung, dann fährt er auf den Markt und hört sich um, dann geht er Mittag essen, dann geht er in den Keller irgendwas basteln oder die Sachen von einer Ecke in die andere räumen, dann kommt er wieder hierher und trinkt Kaffee, dann …
»Ick hab keine Langeweile«, sagt Kalle und geht.
»Kalle ist weg vom Alkohol«, erzählt Kurt. »Sein Problem ist aber, daß er denkt, er kriegt wieder eine Arbeit, wenn er nur will. Kalle ist doch ’n Krüppel, sein Rücken ist total im Eimer.« Kurt war Heizungsmonteur bei der KWV und ist seit zwei Jahren arbeitslos. Er hat’s mit dem Herzen. Gestern, erzählt er, sei er mit so einem Kasten rumgelaufen, der die Werte mißt. Er kommt immer mal auf ein paar Bier, um zu hören, was es Neues gibt.
Bei Willy gibt es offenbar nichts Neues. Montag ist seine ABM-Stelle als Hausmeister abgelaufen. Seitdem ist Willy voll. Er weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. »Jetzt fängt die ganze Scheiße wieder von vorne an«, lallt der Mann.
Willy hat Hochseefischer gelernt. Vor acht Jahren zog er mit seiner Frau von Ueckermünde nach Berlin und arbeitete im KWO als Drahtschneider. Vor drei Jahren starb seine Frau, vor zwei Jahren wurde der Fünfzigjährige arbeitslos, vor einem Jahr sperrte man ihm den Strom, weil er die Rechnungen nicht bezahlen konnte. In dem einen ABM-Jahr konnte Willy wenigstens seine Mietschulden begleichen. Jetzt hat er Angst, wieder welche machen zu müssen und vielleicht auf der Straße zu landen. Kurt versucht ihm das auszureden. Doch Willy ist sich sicher: »Wer einmal auf der Schnauze liegt, kommt nie wieder hoch. Und ich lieg’ auf der Schnauze, aber total.« Da kann Kurt nicht widersprechen. Er trinkt einen Schluck.
Einen Monat glaubt Willy noch »leben« zu können. Dann müsse er weitersehen. »Eine Gulaschsuppe, Conny!« »Und ’n Bier, Willy?« »Nee, mach erst mal ohne Bier.« Später muß er sich dann doch revidieren. Einer der Trinker geht. Er bewegt sich in Zeitlupe. Langsam schiebt er den Stuhl weg, vorsichtig erhebt er sich, streift sich behutsam den Mantel über, hebt bedächtig die Plastiktüte, schiebt geruhsam den Stuhl wieder unter den Tisch und schwebt wie auf Federn aus der Kneipe. »Wenn wir erst mal soweit sind«, grunzt Willy und schnippt, statt den Satz zu beenden, seine Zahnspange wieder in den Oberkiefer.
»Ich will wieder arbeiten. Ich muß wieder arbeiten.« Er bestellt sich eine weitere Gulaschsuppe. Inzwischen sind Klaus und seine Frau da. Klaus quetscht einen Zehnmark-Schein in der Hand. Sie setzen ihn um. Beim ersten Schluck zittert die Hand der alten Dame herzzerreißend. Als sie die Gläser abstellen, guckt ihr Klaus, ein kleines, weißhaariges Männchen, liebevoll in die Augen. Die Frau kann den Blick nicht mehr erwidern.
Willy flüstert, daß er die Frau neulich abends auf der Straße gefunden habe. Er habe sie aufgehoben, gefragt, wo sie wohnt, und dann nach Hause gebracht. »Ich war ja selber voll, aber ich habe sie die Treppe hochgekriegt. Ich kann noch so duhn sein, aber auf der Straße lass’ ich niemanden liegen.« Kurt erzählt, daß man in Oberschöneweide abends öfter über hilflose Häufchen stolpere.
Er stellt die anderen Mitglieder der Übergangsgesellschaft in der »Stumpfen Ecke« vor. Peter, der immer Schnaps und Bier trinkt, aber trotzdem nie besoffen wird. Er kritzelt ständig irgendwelche Listen voll. Und Müller natürlich sowie dessen rotgesichtigen Freund. Müller, der ständig würfelt zum Bier und nie seinen dunkelbraunen Mantel auszieht. Ein Trenchcoat von der steifen Sorte, der nie eine Falte wirft. Sie sitzen und warten, daß es halb zwei wird und die Frühschicht aus dem KWO kommt. Für einige ist es das Signal zum Gehen, die anderen kriegen Gesellschaft. Müller würfelt bis zum Abend. Willy ist dann weg und Kurt auch. Kohlen-Kalle wird noch mal auf einen Kaffee vorbeischauen.
Gleich werden die paar KWO-Arbeiter aus der Frühschicht Feierabend haben. Ihre feuchten Haare tragen sie zurückgepeitscht. Noch bevor sie sich setzen, legen sie ihre Zigarettenschachteln auf den Tisch, obenauf das Feuerzeug. Sie stecken ihre Claims mit »Golden American» ab, mit »Cabinet« und der Sparpackung von »West«. Es ist jeden Tag das gleiche Spiel. Von sechs bis zwanzig Uhr. Werktags.
Conny Wietrychowski hat ein offenes, gutes Gesicht. Die Serviererin ist lange genug im Job, um zu wissen, was mit den Männern los ist, die sie bedient. »Was soll ich machen?« fragt sie. »Ich kann ihnen ja schlecht sagen, daß sie zu trinken aufhören sollen. Erst mal steht mir das nicht zu, zweitens ist es schlecht fürs Geschäft, und drittens gibt es genug Beratungsstellen.« Viertens fällt ihr erst einen Augenblick später ein. »Die meisten, die hierher kommen, mag ich. Die haben alle Probleme. Denen fehlt die Arbeit. Sie kommen sich nutzlos vor. Aber sie sind friedlich. Am anderen Ende der Straße gibt es den ›Treffpunkt‹, da trifft sich das ganze rechte Gesockse. Da sind wir mit unseren Stammgästen schon gut dran.«
Hinter ihr in der Glasvitrine klemmt ein vergilbtes Foto. Das hat irgendwann mal ein alter Mann vorbeigebracht. Conny glaubt, daß er inzwischen tot ist. Die Aufnahme zeigt die Kneipe in den zwanziger Jahren. Damals gab es noch einen kleinen Vorgarten, und über der Tür stand »Gross Destillation zur stumpfen Ecke«. Aber die Arbeiter, die man auf dem Bild sieht, ähneln irgendwie den heutigen Gästen.
Willys Zeit ist abgelaufen. Doch er hat noch eine Idee. »Der alte Baum ist weg«, schreit er. »Der alte Baum ist weg.« »Was ist los?« fragt Kurt. Doch Willy winkt nur mit der Hand und geht. Sie verstehen ihn ja doch nicht.
Dezember 1992
Frau Breuel war wieder nicht da
Erika Rusch ist es egal, ob sie für DDR-Minister kocht oder für Treuhand-Manager
Komischerweise fragen Journalisten prominente Menschen gern danach, was sie am liebsten essen. Komischerweise kommen die Prominenten dann oft mit ganz schlichten Sachen. Berühmte essen einfach. Von Rollmöpsen ist die Rede, von Schmalzschrippen mit Harzer Käse, Kohlrouladen, Currywürsten und Kartoffelpuffern. Es ist zu befürchten, sie wollen uns einreden, sie seien wie wir. Birgit Breuel von der Treuhand mag Pellkartoffeln. Sagt sie.
Es kommt vor, daß Erika Rusch das Ende der Berliner Abendschau nicht erlebt. Sie fällt vorher um. Die Arme sind schwer, die Füße dick, der Rücken schmerzt, und an den Lidern hängen kleine Bleiklötze. Erika Rusch spürt den Tag. Sie spürt die kiloschweren Gemüsekisten, die sie zu den Pfannen schleppt, die tausend Kartoffelberge, die sie auf die Teller schaufelt, die Plastikwanne mit den Klopsen, die sie in den Kühlschrank zerrt, die zähe Pilzragoutmasse, die sie mit einem meterlangen Kochlöffel ausdauernd durchrührt. All die Dinge eben, die sie in der Treuhandküche täglich erledigt. Da sie sich kennt, gibt sie besser auf. Das Ende der Nacht kommt für die Köchin um vier Uhr. Seit fast zwanzig Jahren.