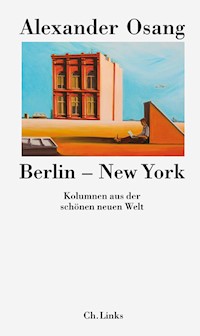9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Literarische Publizistik
- Sprache: Deutsch
Von den blinden Kritikgöttern unbemerkt, ist in Deutschland - abseits vom offiziellen Literatur-(subventions)betrieb - eine junge Autorengeneration entstanden, die gut "erzählen" kann. Nämlich schnell, lebendig und unterhaltsam. Ihr einziger Makel: Sie schreibt keine "Zeitromane", sondern Reportagen, Porträts, Polemiken und kleine Alltagssatiren in Zeitschriften und Tageszeitungen. Ihre Namen sind: Matthias Matussek und Cordt Schnibben (Spiegel), Maxim Biller und Peter Glaser (Tempo), Wiglaf Droste und Max Goldt (Titanic) oder auch die "Ossis" Christoph Dieckmann (Zeit) und der Berliner Lokalmatador Alexander Osang (Berliner Zeitung).
"Diese Geistesenkel von Egon Erwin Kisch und Kurt Tucholsky haben in den letzten Jahren mehr Mut und Stil bewiesen als der ganze Verband deutscher Schriftsteller." Matthias Ehlert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Alexander Osang
Aufsteiger - Absteiger
Karrieren in Deutschland
Mit Fotos von Wulf Olm
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
1. Auflage als E-Book, Mai 2018
entspricht der 4. Druckauflage vom Januar 1998
© Christoph Links Verlag GmbH
Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0
www.christoph-links-verlag.de; [email protected]
Cover: TriDesign, Berlin
eISBN 978-3-86284-417-3
Inhaltsverzeichnis
Wieso beschäftigen Sie solche Leute?
Ein Vorwort über die Scharfrichter der Journalisten
Der böse Fluch der besten Sendezeit
Warum es Gunther Emmerlich leider nicht genügt, ein guter Opernsänger zu sein
»Für viele bin ich nur noch die Xanthippe«
Die Revolution hat Bärbel Bohley gefressen, aber noch nicht verdaut
Boris und ich
Der lange Weg zur bedingungslosen Anerkennung des Becker-Hechtes
Die verlorenen Kinder auf den Straßen von Berlin
Tamara Danz weiß, daß es mehr als Rock ’n’ Roll ist, und sie liebt es
Hannelore auf Kaffeefahrt
Die Schwierigkeiten einer Ehefrau, ihr Lächeln zu verkaufen
»Manche nennen uns auch Hofnarren, mein Gott«
Wie die Volksmusikanten Monika Hauff und Klaus-Dieter Henkler so über die Zeiten gekommen sind
Und überall lauert das Establishment
Die Bundestagsabgeordnete Ingrid Köppe vermißt ihre Wurzeln in Bonn und rennt pausenlos gegen Mauern
Auf »Grace Kelly« sprießen jetzt verräterische Pickel
Der Neubrandenburger Sprintstar Katrin Krabbe ist gefallen, aber noch nicht aufgeschlagen
Ich muß doch erst noch den Amazonas runterrudern
Udo Lindenberg ist crazy nach all den Jahren
Die gescheiterte Verwandlung des guten Menschen in einen weißen Tiger
Boxer Henry Maske will Profi-Weltmeister werden und sauber bleiben
»Wir haben die Zwillingsnummer doch ganz gut rübergebracht«
Ein halbes Jahr nach dem Abschied von den Berliner Regierungssesseln ist kaum zu glauben, daß Walter Momper und Tino Schwierzina jemals funktionierten
Die Einsamkeit des Langstreckenschwimmers
Vom Europameister zum Pförtner – der Fall Frank Pfütze
Sisyphus auf dem Weg zu den Rolling Stones
Der DT64-Chef Michael Schiewack lebt ewig zwischen den Fronten
Der Schnapsbrenner tanzte auf allen Revolutionen
Über Schilkin, der sich ständig drehte und dabei nie zum Wendehals wurde
»Jadup und Boel« - Die Akte zum Film
Wie der DEFA-Regisseur Rainer Simon mitbekommt, daß er nur Statist war
Eier mit Schinken in Wandlitz
Horst Sindermann starb, bevor er verstehen konnte
Die Waffe im Klassenkampf hat keinen Schuß mehr
Karl-Eduard von Schnitzler hockt immer noch im Schützengraben und beobachtet den Feind
Teddybären sind nicht böse
Manfred Stolpe schmunzelt noch den schwersten Vorwurf zur Bagatelle herunter
Anhang
Fotonachweis
Über den Autor
Wieso beschäftigen Sie solche Leute?
Ein Vorwort über die Scharfrichter der Journalisten
Cordt Schnibben, ein ziemlich berühmter Kollege, ruft in einem seiner Beiträge verzweifelt: »Wo kommt eine Zeitung hin, wenn sie auf die Leser hört, die ihr Briefe schreiben!« Die Frage scheint auf den ersten Blick arrogant zu sein. Sie ist es, auch auf den zweiten. Noch vor zwei Jahren hätte ich den Mann für diesen Ausruf verurteilt. Doch inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher. Die Leserbriefschreiber von heute sind längst nicht mehr die, die ich einmal gekannt habe. Etwa in der Zeit, in der die Porträts entstanden, die in diesem Buch stehen, haben sie sich verändert. Entweder sind es andere Leute, die mir heute schreiben, oder es sind dieselben, die nun plötzlich andere Briefe schicken. Wie auch immer. Die Leserbriefschreiber haben vor allem meine Prominentenporträts treu begleitet. Deswegen haben sie sich diesen Platz am Anfang des Buches redlich verdient.
Früher, als meine Zeitung noch eine wesentlich größere Auflage hatte, dafür aber viel dünner war, bekamen wir kaum Leserbriefe. Dabei war die Zeitung schlecht, uninformativ, unlesbar, wutmachend, und die Leute hätten tausend Gründe mehr gehabt, Leserbriefe zu schreiben, als heute. Vielleicht dachten sie, es hat sowieso keinen Zweck. Sie hätten recht gehabt. Daß die Stasi ihre Hände im Spiel hatte, glaube ich nicht. Denn ab und zu lag ja doch einmal ein Brief oder eine Karte auf dem Schreibtisch.
Wahrscheinlich war es 1988, als mir Erna Paslowski (*) schrieb. Ich hatte einen Beitrag zur Eröffnung des rekonstruierten Heizkraftwerkes Rummelsburg verfaßt, in dem ich behauptete, daß eine neuartige Rauchgas-Reinigungsanlage 99 Prozent des Staubes aus dem Rauch des Werkes filtere und der Berliner Luft vorenthalte. Erstens hatte man mir das so gesagt, und zweitens glaubte ich es. Nun schrieb mir Frau Paslowski, daß sie in umittelbarer Nähe des Werkes wohne, und lud mich auf ihren Balkon ein, um die Wäsche zu inspizieren, die sie nach dem Lesen meines Artikels dort aufgehängt habe. Sie sei schwarz vom Dreck, weil nachts nämlich immer heimlich die Filter abgeschaltet würden. Ich freute mich erst einmal, daß es offenbar normale Leute gab, die die Wirtschaftsseite, die wohl schrecklichste Seite einer schrecklichen Zeitung, überhaupt lasen, und rief dann bei dem Betriebsdirektor an, der mir mitteilte, daß sich die Frau irren müsse. Er jedenfalls wisse nichts davon, daß die Filter nachts abgeschaltet würden, und schließlich sei er der Direktor. Obwohl mir zu diesem Zeitpunkt leise Zweifel kamen (warum sollte mich Frau Paslowski anschwindeln), antwortete ich der Frau mit der Direktorenaussage. Ein gutes Gefühl hatte ich dabei nicht. Ich stellte mir vor, wie Frau Paslowski ihrem Mann den Brief zeigt und ruft: »Nu kiek dir dit an. Eener spinnt hier, und ick bin it nich.«
Um so erstaunter fand ich eine Woche später den zweiten Kartengruß von Erna Paslowki auf meinem Schreibtisch, in dem sie ihre Einladung zur Wäschebeschau wiederholte, aber immerhin mitteilte, daß sie nicht mit einer Antwort gerechnet hätte. Sie bedankte sich. Unglaublich!
Die Wendezeit produzierte weniger wohlmeinende Leserbriefe. Sie weckte den Denunzianten im Schreiber. Säckeweise mutmaßten Bürger über die Quelle des Reichtums ihrer Nachbarn. Wer hohe Hecken vorm Haus hatte, war zwangsläufig bei der Stasi. Ein halbes Jahr lang denunzierte jeder jeden. War die Wortwahl zum Anfang noch zaghaft und beschränkte sich darauf, die Funktion der Verdächtigten durch Anführungszeichen zu entlarven. (Solche »Genossen«, und so was nennt sich »Volksvertreter« …), kam man im Laufe der Zeit zur Sache. So notierte Uwe Heinrich im März 1991: »Als Geschäftsführer sind in der Regel eingefleischte Stalinisten und Mitglieder der kriminellen SED tätig. Diese Subjekte …«. Wobei sich der Schreiber der Unterstützung »mehrerer Bekannter« (»So denke nicht nur ich.«) sicher war. Wer für sich allein schrieb, griff dann sicherheitshalber auch mal zum Pseudonym. Wie »Hans Monitor«, der sich als Intimkenner der Unterhaltungskunst-Szene zu erkennen gab, indem er meinen Beitrag zum Duo Hauff-Henkler um wichtige Details ergänzte. (»Das Paar war mit einem Straßenkreuzer westlichen Fabrikats unterwegs.«)
Die interessantesten Briefe dieser Phase waren jene, die kleine Abenteuergeschichten erzählten. Eines Tages erschien ein etwas abgerissenes Männchen in der Redaktion und gab wortlos einen völlig wirren, jegliche Orthographie- und Grammatikregeln ignorierenden Brief ab, in dem er mitteilte, daß sich jeden Abend mehrere Stasimänner bei ihm einfänden und ihn an elektrische Geräte anschlössen.
Bis zum heutigen Tag schaut in meinem Zimmer gelegentlich ein ehemaliger Westberliner Architekt vorbei, um in umfangreichen Schreib- und Zeichenarbeiten zu belegen, wie er vor einigen Jahren mehrere U-Bahnstationen lang von einem BND-Agenten verfolgt worden sei. Seine Schreiben sind bunt illustriert und ähneln frappierend einem riesigen Mensch-Ärgre-Dich-Nicht-Spiel. Beigefügt sind psychiatrische Gutachten, die beweisen sollen, daß er nicht irre ist. Leider kommt der Mann immer in Augenblicken, wenn etwas zu tun ist. Und er redet ebenso ausdauernd, wie er schreibt.
Es folgte ein kurzes Zwischenspiel der Verwirrung unter den Leserbriefschreibern. Nennen wir es die naive Phase. Sie war vor allem dadurch gekennzeichnet, daß sich zahlreiche Leser darüber beschwerten, daß die Zeitung so dick werde. »Das schaffen wir gar nicht mehr«, beklagte man und »Was sollen die ganzen Anzeigen?« Nun, man hätte antworten können, daß Zeitungen nicht gemacht werden, um dem Leser Freude zu bereiten, sondern vielmehr, um Geld zu verdienen. Das ging nicht, aber es wäre ehrlich gewesen. So aber wartete man geduldig auf das Ende der naiven Phase.
Charakteristisch für diese schöne Zeit war meine Korrespondenz mit Ilse Weber. Eine richtige Korrespondenz war es eigentlich nicht, da Ilse Weber, dem Schriftbild nach eine rüstige Rentnerin, zwar über mich, aber nicht an mich schrieb. Zunächst adressierte sie ihre dicken Briefe an die Leiterin unserer Leserbriefredaktion, von der sie wußte, daß sie immer zurückschreibt. Als dies nicht half, schrieb sie an den Chefredakteur. Ich erhielt jeweils Kopien ihrer Wutausbrüche.
Ilse Weber war die personifizierte naive Phase. Sie nahm jedes Wort für bare Münze. In ihrem ersten Schreiben ging es um Gunther Emmerlich. »Dieser Herr Osang will uns noch das Letzte nehmen, was wir haben«, verteidigte sie die vermeintliche DDR-Errungenschaft Emmerlich. Ilse Weber, gewöhnt an wohlwollende Betrachtungen über den Entertainer, genügten zwei drei spöttische Bemerkungen, um eine Schimpfkanonade anzustimmen, die in der Aufforderung gipfelte: »Lassen Sie den Mann nur noch über Sport schreiben!« Durch die besänftigende Antwort der Leserpostredakteurin angestachelt, verfaßte sie einen zweiten dicken Brief, an dessen Ende sie ihre ursprüngliche Forderung zurücknahm und durch den Befehl: »Schicken Sie ihn ein Jahr zum Arbeiten auf die Insel Hiddensee!« ersetzte. In diesem Schreiben tauchten auch erstmals Beschwerden zu einem Beitrag auf, den ich nie geschrieben hatte. »Wie er unseren Professor Ardenne in den Dreck zieht«, schrieb Frau Weber, »ist gelinde gesagt, eine Schande.« Der Ardenne-Vorwurf (über den Wissenschaftler hatte ich wirklich nie eine Zeile geschrieben) zog sich auch durch die folgenden Schreiben. Das Ende setzte Ilse Weber mit einem resignierenden Brief an den Chefredakteur, in dem sie noch einmal alle Schandtaten auflistete, allerdings auch einen recht versöhnlichen Schluß fand. Sie strich ihren gesamten Strafkatalog und seufzte nur noch: »Wahrscheinlich ist er ja jung und lernt noch dazu.« Ilse Weber hatte aufgegeben, die naive Phase war vorbei.
Die Spreu der Leserbriefschreiber begann sich vom Weizen zu trennen. Es kommen immer noch aufgewühlte Briefe von Menschen, die völlig verunsichert durch diese Zeiten gehen. Doch sie sind nicht mehr naiv. Sie sind bitter-kämpferisch. Wirklich tragische Geschichten sind dort zu lesen. Die Briefe berichten über die tägliche Korruption, über alte und neue Seilschaften, seelenlose Beamte, hirnlose Vergangenheitsbewältiger, ohne zu denunzieren, sie wundern sich über Journalisten, die gestern noch felsenfest das Gegenteil von dem behaupteten, was sie heute schreiben, sie suchen nach Wärme, nach Verständnis. Es sind Briefe, die beantwortet werden müssen.
Andererseits gibt es den selbstbewußten, aufstrebenden Leserbriefschreiber. Wahrscheinlich trägt er fliederfarbene Knitterjacketts, lila Seidenhemden und buntbedruckte Krawatten mit Nadel. Jedenfalls benutzt er moderne Schreibmaschinen und schreibt grundsätzlich an Chefredakteur oder Herausgeber. Der selbstbewußte Leserbriefschreiber ist kleinlich und verlangt am Ende seiner langen und streng gegliederten Ausführungen den »vollständigen Abdruck«. Er verlangt keine Entschuldigung oder Erklärung, er fragt nicht oder grübelt, er verlangt, »dieses Schreiben ungekürzt und an herausragender Stelle abzudrucken«.
Michael Peters wurde durch meinen Artikel über Manfred Stolpe offenbar mitten ins Herz getroffen. Er gab ein regelrechtes Rundschreiben heraus. Durchschläge an den Herausgeber, den Chefredakteur und den für mich zuständigen Redakteur. Nur mir schrieb er nicht. Sein Schreiben glich einem 13punktigen Forderungskatalaog. Hier nur Auszüge:
»1. Wie kann es sein, daß solche Machwerke Platz in einer Tageszeitung finden, die sich gern als seriös bezeichnet. (…) 6. Wieso beschäftigen sie solche Leute? (…) 13. Sollte ich noch einmal einen ähnlich gearteten Artikel lesen, sehe ich mich gezwungen, das Abonnement zu kündigen.« Punkt 8 hatte Herr Peters vor lauter Erschütterung völlig vergessen. Aber kommen wir noch einmal zu Punkt 13, die Abo-Kündigung. Der neue selbstbewußte Leserbriefschreiber ist sich durchaus seiner Macht bewußt. Da er weiß, wie die Zeitung mit Reisetaschen-Sets, Kontaktgrills und Espressomaschinen um Abonnenten buhlt, kann er sich denken, welche Katastrophenstimmung seine Drohungen in der Chefredaktion auslösen. Er nutzt seine Macht gnadenlos aus. Dabei bevorzugt er zwei Methoden. Er verbrüdert sich mit der Zeitungsführung gegen den kritisierten Reporter. »Es wäre schade, wenn ich Ihre ansonsten lesbare und informative Zeitung wegen der Pamphlete dieses Mitarbeiters abbestellen müßte.« Ein wütender Landratsbeamter aus Pirna näherte sich dem Herausgeber meiner Zeitung mit der rhetorischen Frage: »Billiger Boulevardklatsch und sensationelles Anschmieren sind doch nicht typisch für die Berliner Zeitung?« Zum Abschied kokettiert diese Spezies mit »noch freundlichen Grüßen«. Die andere, sympathischere Gattung macht kurzen Prozeß. »Dieser Beitrag war ein Grund mehr für mich, Ihre Zeitung nicht mehr zu kaufen«, schreibt ein »Mitarbeiter von Stern Radio«. Herr Weiß teilt mit: »Da mich bei der Lektüre Ihres Blattes zunehmend Ekel überkommt, welcher beim Lesen des im Neubrandenburger Nuttenmilieu aufgemachten Krabbe-Artikels zum Erbrechen führte, sehe ich mich aus hygienischen Gründen zur Kündigung des Abonnements gezwungen.«
Das wäre alles nicht so tragisch, wenn das zwanghaft populistische Leitungspersonal von Zeitungen nicht so empfänglich für Drohungen und Forderungen des selbstbewußten Leserbriefschreibers wäre. Wenn zwei oder gar drei Leserbriefe sich über ein und dieselbe Sache beschweren, hat das für einen Chefredakteur die Aussagekraft einer Infas-Umfrage. Wenn einer der Schreiber auch noch einem Unternehmen vorsteht, das womöglich Anzeigenkunde der Zeitung ist, hat dessen Beschwerde Gesetzescharakter.
Chefredakteure und Leserbriefschreiber mißbrauchen sich aber auch gegenseitig. Selbst ein einziger lapidarer Leserbrief genügt dem Chef, mit den Worten »wie Leser schreiben« Tabus auszusprechen, Mitarbeiter zu kritisieren oder die strategische Linie des Blattes zu ändern. In Notsituationen braucht er dazu nicht einmal diesen einzigen Brief.
Noch halten sich machtbeflissene und verzweifelte Leserbriefschreiber die Waage. Doch das kann jeden Tag kippen. Ich beginne, Schnibben zu verstehen.
Und in schwachen Stunden erinnere ich mich der glücklichen Zeit, als es noch keine Leserbriefschreiber gab. Damals, im sozialistischen Journalismus, gab es allem Anschein zum Trotz allerdings auch schon das Prinzip der Massenverbundenheit. Das forderte mitunter den Abdruck einer Leserfrage. Am beliebtesten waren Leserfragen zur Wirtschaftspolitik. Die Antworten standen in einem Bulletin, das das Presseamt der DDR allwöchentlich herausgab. Unser Chefredakteur kritzelte dann über irgendeinen langweiligen Beitrag des Maschinenbauministers zu den Vorzügen von Zahnflankenschleifmaschinen: »Leserfrage!«, und wir Redakteure hatten uns eine Frage und einen Fragesteller auszudenken. Als Fragesteller tauchten meist Bekannte und Verwandte, mitunter aber auch Leute auf, die Markus Knopf, Michael Jäger oder Robert Zimmermann hießen. Noch besser aber waren die Fragen. Ich war mit der Frage: »Neulich las ich etwas über Braunkohlenstaub. Kann man dieses Abprodukt eigentlich weiterverwenden?« schon ziemlich gut. Ewig unübertroffen aber wird die Idee eines Kollegen bleiben. »Was kann man eigentlich alles aus Kartoffeln machen?«, ließ er fragen. Den Namen des vermeintlichen Lesers habe ich vergessen. Ich glaube, er kam aus 1020 Berlin.
Nein, nein, ich wünsche mir nicht die alten Zeiten zurück. Jedenfalls nicht die Zeitungszeiten. Ich wollte Sie nur warnen, nach der Lektüre dieses Buches zur Feder zu greifen. Ich bin ein geschlagener Mann. Zu vielem von dem, was auf den nächsten Seiten steht, habe ich langwierige und haarige Auseinandersetzungen mit schreibenden Lesern geführt. Mit Leuten, die fanden, daß Karl-Eduard von Schnitzler viel zu gut bei mir wegkommt, und solchen, die anmerkten, ich hätte ihn schlechtgemacht; mit Lindenberg-Fans, die mir vorwarfen, nur neidisch „auf Udo seine Weiber” zu sein. Von den Proteststürmen der Emmerlich-, Krabbe- und Stolpe-Fans haben Sie schon gelesen. Seien Sie also bitte nachsichtig. Zumal in dem Buch auch noch ein paar Porträts stehen, die vor Ihnen noch niemand gelesen hat.
(*) Alle Namen der Leserbriefschreiber wurden geändert, ihre Texte nicht.
Der böse Fluch der besten Sendezeit
Warum es Gunther Emmerlich leider nicht genügt, ein guter Opernsänger zu sein
»In den neuen Ländern muß mehr in-ost-iert statt investiert werden.«
(Gunther Emmerlich, Samstagabend)
Er hat braune Augen. Weiß der Teufel warum, aber ich hätte schwören können, sie seien blau. So groß wie er ist, so blond, so dick und überhaupt. Sie sind überraschend braun und überraschend unsicher. Fast ängstlich springen sie zwischen dem strubbligen Graubart und dem aschblonden Scheitel, der notdürftig die hohe Stirn bedeckt, umher. Gunther Emmerlich hat Angst. Das schlimme ist, er weiß nicht wovor.
In ein paar Tagen wird an der Dresdner Semperoper Mozarts »Entführung aus dem Serail« Premiere haben. Emmerlich spielt den Osmin. Einen dicken, fiesen Haremswächter, mit ein paar menschlichen Zügen, ganz wenigen. Jahrelang hat er davon geträumt, diesen Baßpart einmal zu singen. Nun ist es soweit, und Emmerlich wird ganz gewiß einen vortrefflichen Osmin abgeben. Einen Macho allererster Güte, mit ein paar mehr menschlichen Zügen ausgestattet, als sich Mozart das seinerzeit gedacht hat. Aber wenn Emmerlich auf der Opernbühne Faxen macht, wird selbst der konservativste Regisseur schwach.
»Am schlimmsten«, sagt Emmerlich zum Maskenbildner, der ihn in Osmin verwandelt, »ist eine Glatze, die aussieht wie ’ne Badekappe.« Der Maskenbildner feixt. Dieser Emmerlich. Herr Emmerlich steckt inzwischen im sackigen Leinenhemd und Pluderhose, sein Jeanshemd hängt über der Stuhllehne, die Hosen liegen zusammengeknuddelt in der Ecke, obenauf eine Socke, blaugrau, seine Augenbrauen sind bereits böse, der Bart schwarz, die Haut braungepudert, an der dämonischen Stirnlocke wird gearbeitet. Die Hände sind noch rosig und liegen artig auf der Frisierkommode. »Gibt es eigentlich«, fragt er das Spiegelbild des Fotografen, »eine anerkannte Berufskrankheit bei Ihnen? Einen steifen Finger oder so?« Er kann es nicht lassen. Er muß jede Bemerkung zu einer Pointe führen oder zu etwas, was er für eine Pointe hält. »Er ist schon eine Blüte, der Herr Emmerlich«, sagt der Pförtner der Semperoper.
Fernsehunterhaltungsmacher finden vieles komisch. Manchmal sogar Komisches. So haben sie eines Tages in grauen Vorwendezeiten den Opernsänger Emmerlich für sich entdeckt. In Gisela Mays Talentesendung »Pfundgrube« bewies er, daß er auch Jazz singen und respektlose, witzige Antworten geben kann. Fertig war der Entertainer. Man wob um den vielseitigen Bassisten ein notdürftiges Konzept, nannte es »Showkolade«, schob es auf die Sonnabendabend-20-Uhr-Schiene und feierte hohe Einschaltquoten, wenn Gunther auf Sendung war.
Seit Wochen proben sie die »Entführung«. Heute zum ersten Mal im Kostüm. Das Bühnenbild erinnert ein wenig an einen Schulhof, der sich in unmittelbarer Nähe eines aktiven Vulkans befindet. Der Regisseur sieht aus wie ein Abiturient, gilt als hoffnungsvoll und etwas konservativ. In Beleuchtungsfragen scheint er geschmäcklerisch zu sein. Am Ende der Probe ist der Chefbeleuchter kein Mensch mehr. Bevor der erste Ton gesungen ist, hantiert er mit zittrigen Fingern eine knappe halbe Stunde an den Knöpfen einer unförmigen Wechselsprechanlage herum, um den Unterbeleuchtern die ausgefallenen Lichtwünsche des Regisseurs durchzustellen. Auch keine leichte Zeit für Gunther Emmerlich. Osmin startet nämlich in einem Boot schlafend ins Singspiel. Das Boot ist klein und unbequem, Emmerlich probt mit ein paar Ooaahs, Uuoohs sowie Muuuaahs, wie tief die Stimme heute morgen ist, und scherzt aus dem Boot mit den Bühnenarbeitern. Er gilt als Ulknudel. Auch bei sich selbst. »Es gibt überall Leute, die die Spaßvögel sind, ob in einer Fußballmannschaft oder im Bergbau. An der Semperoper bin ich’s eben.«
Mit einem Knall war er es damals auch im ganzen Land. Er stand an irgendeinem Sonnabend einfach da. Der Vorhang ging auf, ein dicker, bärtiger Schrank grinste uns an und spielte mit seinen Augenbrauen. Er machte ein knappes Dutzend schöne, kleine, intime Shows, immer in Theatern, und lud gute Gäste dazu ein. Ein Showmaster, der nicht pausenlos rumhampelte, blödsinnige Fragerunden veranstaltete und Preise verteilte, dafür aber geistreich plauderte, ein paar brillante Gospel- und Jazznummern ablieferte und zwei, drei gute Witze erzählte. Man kann sich das kaum vorstellen, aber wir haben uns das angesehen, obwohl keine Ted-Ergebnisse abgefragt wurden. Emmerlich war eine Wohltat.
Der kleine Nachwuchsregisseur Piontek hat »Osmin« Emmerlich ganz schön gescheucht. Er hat ihm vorgemacht, wie ein betrunkener Haremswächter umfällt, gezeigt, wie man die Peitsche zu schwingen hat, wenn man richtig wütend ist. Osmin ist über die Bühne gestampft, hat gewütet, gepeitscht und nebenbei noch diese herrlich satten, tiefen Töne aus seiner Brust geholt. Jetzt sitzt er in der Künstlerkantine, Schweißperlen ziehen helle Bahnen ins braune Gesicht. Überall sitzen Turbanträger mit braungepuderten Gesichtern und verschlingen graue Bockwürste. Gunther Emmerlich hat nur die Pausenbanane auf dem Tisch, die an gute Vorsätze erinnert. Dick genug sein, um als Malteserkreuz-Genießer durchzugehen, dünn genug, um in den Sonnabendabend-Smoking zu passen. »Natürlich«, gibt Emmerlich zu, »habe ich meinen Beruf nicht gewählt, um weitgehend unbekannt zu bleiben. Ich verstehe Leute nicht, die jahrelang an ihrer Karriere arbeiten, um dann mit dunklen Sonnenbrillen durch die Gegend zu laufen.«
Emmerlich wollte bekannt werden. Er wollte es zu DDR-Zeiten, was seinen Preis hatte. Spätestens nach der ersten »Showkolade«-Sendung kannte er ihn. Ich weiß, wie weit ich gehen kann, ich nehme in Kauf zu opfern, was zu weit geht. Was soll das Kokettieren mit den acht Pointen, die aus der vorproduzierten Sendung geschnitten wurden, wenn danach noch anderthalb Stunden übrigblieben, während denen sich auch die Funktionäre auf die Schenkel hauen konnten. Emmerlich hat sich vor einen Karren spannen lassen. Doch weder er noch die Zuschauer haben etwas gemerkt. Lustige kleine Spitzen zwischen den Zeilen machten ihn zum Oppositionellen unter den Unterhaltungskünstlern. Sie taten keinem weh. Die Leute haben gedacht: »Oi, oi, oi, was der sich traut.« Die Zensoren haben gedacht, »solange er nicht ans Eingemachte geht«. Emmerlich hat das Kunststück fertiggebracht, als unbequem zu gelten, obwohl er es eigentlich gar nicht war. Genau genommen.
Denn natürlich hat er sich mehr getraut als Ponesky, hat den Langmut der Wachsamen strapaziert. Doch die Tragik des blonden Barden ist, daß er die Relativität seiner Bemühungen aus heutiger Sicht nicht anerkennen will. »Ich wollte eigentlich von selber Schluß machen«, bemerkt er trotzig. Er erzählt davon, wie er Helga Hahnemann vor laufenden Kameras versichert habe, sie sei als Schokoladenmädchen nicht die einzige Fehlbesetzung im Lande. Zu einem Zeitpunkt, als auf DDR-Straßen schon Hunderttausende demonstrierten. Warum hat er die Chance, in einer Live-Talkshow mal aus der Zwischenzeile auszubrechen, nicht genutzt? »Weil ich dann verhaftet worden wäre. Ein Märtyrer war ich nie.«
Herbstrevolutionär schon. »Doch, doch. Da muß ich in aller Unbescheidenheit zustimmen.« Emmerlich beruft sich auf die Resolutionen, die er nach den Theatervorstellungen dem Opernpublikum vorgelesen hat. Sie, so meint er, rechtfertigen auch das Foto, das durch die Medienlandschaft gereicht wurde. Es zeigt Gunther Emmerlich mit hochgeschlagenem Mantelkragen in einem Häusereingang, eine Hand schützt behutsam das Licht der Kerze, die die andere Hand hält. Die Augen blicken traurigernst. »Das Foto stimmt schon so«, erklärt er das Motiv. Aber wie kann man denn, meint man es wirklich ernst, mit diesen bitteren Erinnerungen im nachhinein vor der Kamera posieren? »Die Fotografen haben mich überredet«, gibt Emmerlich auf. Doch der kleinen dunkelhaarigen Frau neben ihm fällt noch etwas ein. »Wir wollten damals zeigen, daß das Licht weitergetragen wird, wo so vieles den Bach runterging.« Emmerlich schaut die Frau nachdenklich an und nickt. Müde zwar, aber er nickt.
Immer wenn Osmin das Feld kurzzeitig den Tenören räumen muß, hastet Emmerlich in den Zuschauerraum. Er stürmt in die Mitte der vierzehnten Reihe und läßt sich auf einen der roten Samtsessel fallen. Er verschnauft kurz und beugt sich dann vor in die dreizehnte Reihe. Dort sitzt die dunkelhaarige Frau, seine Frau. Er will hören, wie er war. Sie kann das einschätzen, sie war Schauspielerin. Und sie liebt ihn, und er liebt sie. Sie will ihm sagen, daß er gut war, er will hören, daß er gut war. So ergänzen sie sich. Meistens ist er gut.
Die hübsche blonde Sopranistin, die Osmin so ungern aus dem Serail ziehen ließ, muß ihr Kind aus der Krippe holen. Die Kritik findet ohne sie statt. Der Regisseur muffelt ein bißchen mit zwei wenig bekleideten Haremswächtern, die irgendwie zu spät oder zu früh auf die Bühne sprangen, entläßt den Chor, beschwert sich ein letztes Mal bei den verschwitzten Beleuchtern, dann bittet er die Hauptakteure zur »Kon«. Was immer das ist, Fremde dürfen nicht dabeisein. »Osmin« Emmerlich steht noch ein wenig gedankenverloren am Boot herum. Die Pluderhose ist verrutscht, von der Schärpe ganz zu schweigen, seine Schultern sind schmal unterm Leinenhemd, der Rücken ist gebeugt, die Stirnlocke längst nicht mehr dämonisch. Niemand redet mit ihm, er steht nicht im Rampenlicht, er ist er selbst, endlich. Doch dann nickt es im Rücken, und das Leinenhemd spannt sich. Er geht ab. Die Glatze sitzt wie eine Badekappe.
»Er kann mehr als ich.« Der Satz steht drei Zigarettenzüge lang im Raum. Anne-Kathrin Kretzschmar erzählt ein wenig über sich, während sich ihr Mann abschminkt. Aber alles, was mit ihr zu tun hat, hat mit dem Mann zu tun, den sie liebt. 1990 hat sie aufgehört, Theater zu spielen, seinetwegen. »Ich habe meinen Applaus gehabt«, ist alles, was sie dazu sagt. Es klingt nicht resignierend, nicht einmal traurig. Sie hat ihre Karriere bewußt und freudvoll der ihres Mannes geopfert. Kritik an ihm trifft sie mitten ins Herz. Sie hat gelitten in den letzten Wochen.
Der Mann, der sich zu uns an den Tisch setzt, ist müde. Müde von der fünfstündigen Probe. Ausgelaugt von der Terminhatz. Angeschlagen von der Kritik. Der Erfolg hat ihn verwundbar gemacht. Er war der Star der DDR, der Star der Wende und Nachwende, der Beispiel-Ossi, er war »Unser Gunther« der Boulevardpresse, die auch Katrin Krabbe, Thomas Doll und die Handvoll anderer Erfolgs-Ossis ihr eigen nannte. Er konnte nicht nein sagen, und plötzlich drehte sich alles um ihn herum. Wenn man seine Gegner nicht mehr kennt, ist es gefährlich, Witze über sie zu machen. Womöglich sitzen sie ja im Publikum. Dann lacht niemand. Schlecht für den Conferencier.