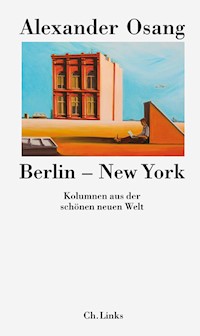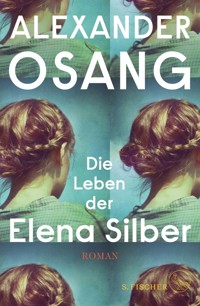8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Gitarrist Alex, der Bassist Paul, der Keyboarder Vonnie, der Schlagzeuger Axel und die charismatische Sängerin Nora sind »Die Steine«. Eine ostdeutsche Rockband aus den 80ern zwischen Protest und Anpassung. Als die Mauer fällt, zerbricht die Band. Nora versucht es allein in New York. Paul steht zwölf Jahre an seinem Fenster. Alex denkt an Nora, die seine große Liebe wurde, als sie schon bei Paul war. Paul liebt nur eine Frau, seine Tochter. Dann gehen sie auf Comeback-Tour. Alexander Osangs mitreißender Roman erzählt mehr als die Geschichte einer Band in drei Jahrzehnten, seine Kapitel sind Songs über Liebe, Verrat und das, was die Zeit aus uns macht. Und darüber, dass das Leben weitergeht, wenn ein Song zu Ende ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Alexander Osang
Comeback
Roman
Über dieses Buch
Der Gitarrist Alex, der Bassist Paul, der Keyboarder Vonnie, der Schlagzeuger Axel und die charismatische Sängerin Nora sind »Die Steine«. Eine ostdeutsche Rockband aus den 80ern zwischen Protest und Anpassung. Dann kommt die Wende – Anfang eines neuen Lebens? Nora versucht es allein in New York. Paul steht zwölf Jahre an seinem Fenster. Alex denkt an Nora, die seine große Liebe wurde, als sie schon bei Paul war. Paul liebt nur eine Frau, seine Tochter. Dann gehen sie auf Comeback-Tour. Eine Geschichte über Liebe, Verrat und das, was die Zeit aus uns macht. Darüber, dass das Leben weitergeht, wenn ein Song zu Ende ist.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Covergestaltung: Schiller Design
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403338-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Motto
Steine-Tapes
Wolkenlos
Truppenabzug
Eines dieser typischen New Yorker Märchen
Geheime Liebe
Himmel über Berlin
Zaungast
Die Beichte
Almost Famous trifft Gunter Gabriel
Über Bord
Ulalala
Einmal auch der helle Schein
Danksagung
Don’t let us get sick
Don’t let us get old
Don’t let us get stupid, all right?
Just make us be brave
And make us play nice
And let us be together tonight
Warren Zevon
Carola Jürgensen: Gab es einen Moment in eurer Bandkarriere, in dem du gespürt hast: So schön wird es nie wieder?
Nora Schwarz: Schwer zu sagen. Ich glaube, so denkt man nicht. Du verstehst ja auch nie wirklich, dass du jung bist. Als ich fünfzehn war, taten mir Neunzehnjährige leid. Ich dachte, die fühlen nichts mehr. Ich dachte wirklich, mit vierzig spring ich aus dem Fenster. Wahnsinn, dann wäre ich jetzt schon dreizehn Jahre tot. Das schreibst du aber nicht, verstehst du.
Was ich sagen will, ist: Du genießt den Moment nicht, weil du ihn nicht verstehst. Du hast keine Vorstellung von der Zeit. Das ist das, was Glück ausmacht, glaube ich. Du bist unsterblich.
Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen: August 88. Das Konzert im Friedrichshain, August 1988.
Wir hatten eine gute Platte gemacht. »Toastbrot und Spiele«. Die Platte war wichtig, nicht schwer, aber wichtig. Relevant. Relevanz hängt in unserem Geschäft von vielen Dingen ab. Vom Alter, von der Lage im Land und der in der Band.
Du reitest die Welle. Wir sind die Welle geritten, ganz oben, da, wo der Schaum war.
Wir hatten die Platte draußen, ein paar Songs liefen im Radio, andere nicht. Die Luft im Land stand still. Es bewegte sich nichts. Alle warteten. Wir hatten das Lied dazu. »Wartesaal«. Es war gerade verboten worden. Das passte wie’n Arsch auf’n Eimer.
Wir hatten den Soundcheck gemacht, nachmittags. Strahlend blauer Augusthimmel. August ist ja auch so ein Wahnsinnsmonat, so bittersüß. Auf den Wiesen saßen schon ein paar Fans, nicht viele, vielleicht hundert. Die Bäume standen da, fett und raschelnd, all diese dicken deutschen Bäume. Die Trümmerberge, die Stadt. Hier hast du verstanden, dass alles noch nicht lange her ist. Und dann doch schon wieder unglaublich lange her. Es war ja alles zugewachsen. Grün. Mythisch.
Wir waren genau richtig da. Richtige Zeit, richtiger Ort.
Wir waren so um halb sechs fertig, denke ich. Danach sind wir alle zu Alex gegangen, der wohnte in der Marienburger. Das war nicht weit. Im Hinterhof konnte man schön sitzen, da standen ein paar Bäume rum, der Seitenflügel und das Gartenhaus waren weggebombt. Da saßen wir und haben gechillt. Bierchen, Weinchen, Zigarettchen. Nicht exzessiv, nur ein bisschen runterkommen. Irgendwann war’s um acht. Es war so ein schöner Abend. Jedenfalls sagt Paul: Wollen wir nicht lieber Baden fahren? Das war klassisch Paul. Dem war alles scheißegal. Ich hab das geliebt, jedenfalls eine Zeitlang. Das Besondere aber war, wir fanden den Vorschlag alle geil. Nacktbaden im Weißen See. Das Konzert sollte halb neun anfangen, und wir wussten ja, dass Conny schon im Kreis lief. Der hatte keine Ahnung, wo wir waren. Es gab ja keine Handys. Wenn er gewusst hätte, dass wir übers Badengehen nachdachten, hätte der einen Herzinfarkt bekommen. Ach, Conny.
Wir sind dann runter zur Greifswalder gelaufen und haben gesagt: Wir fahren mit der ersten Bahn, die kommt. Wenn sie nach Weißensee gefahren wäre, wären wir Baden gegangen, aber sie fuhr zum Hackeschen Markt. Wir sind also die eine Station bis zum Königstor gefahren und kamen halbwegs pünktlich an. Conny war total durchgeschwitzt. Wir haben es ihm nie erzählt.
Er stand da, klitschnass und sagte: 25000.
25000, Caro. Wir hatten noch nie ein Solokonzert vor so vielen Menschen gespielt. Ich bin an den Bühnenrand gegangen und hab rausgeschmult, die Wiesen waren schwarz vor Leuten. Kein Grashalm war zu sehen. Ein unglaublicher Frieden, die haben auf uns gewartet wie auf Propheten. Die Bäume raschelten, und es war immer noch so warm. Ich habe mich umgedreht, da standen die Jungs, mit denen ich eben noch Baden fahren wollte. Ich glaube, ich habe nie jemanden so geliebt wie diese vier Kerle in diesem Moment. Nie zuvor und nie danach.
Und das hat man dann auch gehört. August 1988, Friedrichshain. Wahnsinnsnacht, Caro. Wahnsinnsnacht.
Wir waren unsterblich.
Wolkenlos
Emma, 2013, Herbst
Emma Schmidt war mit einem Surfer ins Bett gegangen und neben einem Soldaten aufgewacht. So kam es am Ende immer, dachte Emma. Sie wollte nicht so denken, sie war um die halbe Welt gereist, um diesen Gedanken zu entfliehen. Ihr Blutdruck war schuld. Es war neun Uhr morgens, ihr Herz schlief noch. Emma sah aus dem Fenster, wo das kalifornische Morgenlicht ihre Einfahrt ausleuchtete wie ein Studioscheinwerfer. Immer das gleiche Wetter, seit fünfeinhalb Monaten. Wolkenlos.
Die Sonne hing wie ein ständiger Vorwurf im Himmel.
Tom trug ein weißes, geripptes Unterhemd, Hosenträger, die seine Schultern breit, aber auch ein wenig brutal aussehen ließen. Seine Haare waren noch nass, in der Stirn lang und weich, im Nacken ausrasiert. Er würde heute sterben. Er war der erste Soldat, der fiel. Sein Name war Hermann, einen Nachnamen hatte er nicht. Er war zu schnell tot. Der Film hieß »Black Dogs« und spielte im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs. In einem deutschen Bunker, den sie in Burbank aufgebaut hatten. Tom hatte ihr Handyfotos vom Bunker gezeigt, ein graues Monster, ein gestrandeter Wal.
Es war so still, wie es in Los Angeles sein konnte. Emma hörte die Flugzeuge, weit oben überm Meer, aber auch das Messer, mit dem sie auf ihrem Toast kratzte. Toms Löffel raschelte im Müsli, als würde er dort nach irgendetwas suchen. Vielleicht nach anständigen Rollenangeboten, dachte Emma. Der verdammte Blutdruck machte sie zu einem Monster. Sie schob ihm die Schale mit dem Obst hin, das sie geschnitten hatte.
»Obst?«, fragte sie. Es war ihr erstes Wort am Frühstückstisch. Sie würgte es aus wie einen Fellball.
Tom sah auf, als erwache er aus einem Traum.
»Leberwurrrrst«, sagte er. Er lachte, seine Zähne waren makellos.
Sie fragte sich, ob er sich auf die Rolle vorbereitete oder zu einem Mann wurde wie ihr Thüringer Großvater. Ein Mann, der stundenlang nichts sagte und dann plötzlich »Gummistiefel« oder »Einigkeit und Recht und Freiheit – dass ich nicht lache«.
»Was?«, fragte sie.
»Ich hätte gern ein bisschen Wurst zum Frühstück«, sagte Tom. Wurrrst, sagte er. Er lachte immer noch, aber es bedeutete nichts. Er war Schauspieler. Gestern Abend war er mit trockenem Schlamm im Gesicht und an den Armen nach Hause gekommen, als habe er auf dem Bau gearbeitet.
»Tut mir leid«, sagte sie. Er war ja nur nervös. Er würde heute sterben.
»Was?«, fragte er.
»Dass ich dir keine Wurst bieten kann.«
»Ach, Quatsch. Es liegt an der Rolle«, sagte er.
»Method acting?«, fragte sie.
Sein Text heute bestand aus zwei Wörtern, seinen letzten Worten. »Mutter.« Und dann noch mal: »Mutter.« Aber warum sollte sie ihn daran erinnern. Ihr Blutdruck war kaum messbar. Sie schlief noch.
»Blutwurst für Bobby de Niro and me«, sagte Tom und schaufelte sich Obst auf sein Müsli.
Das frische Obst sprach für Kalifornien. Das erzählte sie ihren Freundinnen zu Hause und sich selbst. Der Fisch und das Obst. Der wolkenlose Himmel. Und das Meer vor der Tür. Sie dachte an Marlene Dietrich, die spät im Leben, am Ende ihrer ewigen Flucht aus Deutschland, Graubrot und Wurst vermisst hatte. Keine Ahnung, woher Emma das wusste. Sie hätte es erzählen können, jetzt, aber sie würde klingen wie eine der Ehefrauen, die in die Gesänge ihrer Männer einstimmten. Sie war 27 Jahre alt und müde.
Tom strich sich eine lange blonde Haarsträhne zurück, die in seine Müslischale baumelte. Es sah gut aus. Emma stellte sich vor, wie sie die Strähne abschnitt. Er redete von der Szene, der er zum Opfer fallen würde. Er nannte Namen und Orte, die Emma nichts sagten. Sie hatte ihn zweimal zum Set gefahren, einmal waren es Außenaufnahmen gewesen. Sie hatte am Rand gestanden, hinter Absperrungen und Catering-Trucks, am Horizont liefen deutsche und amerikanische Soldaten zwischen Hügeln umher. Aus der Entfernung konnte sie keinen Unterschied ausmachen. Alles eine Armee. Sie nickte, träumte. Es interessierte sie nicht, es erinnerte sie an ihre Tatenlosigkeit. Wie die Sonne. Tom erzählte diese Dinge auch nicht ihr, sondern sich selbst. Gleich würde er aufs Klo verschwinden. Sie würde in der Zeit den Tisch abräumen. Toms Handy summte. Er lächelte.
»Jake würde uns gern kennenlernen«, sagte er.
»Jake«, sagte sie.
»Er findet das alles so faszinierend. Unseren Hintergrund. Deine Geschichte. Ich habe ihm erzählt, dass du aus dem Osten kommst. Von Alex.«
»Du hast ihm von Alex erzählt?«, fragte Emma. Ihr Herz begann zu arbeiten. Sie tauchte aus einem dunklen See auf. Sie schnappte nach Luft.
»Er ist total interessiert. Er ist wirklich so anders, wie sie alle sagen. Er kann zuhören«, sagte Tom und streichelte sein Handy wie eine Katze.
»Was hast du ihm denn erzählt?«
»Nichts von euch, keine Angst. Die alten Geschichten«, sagte Tom. Er lachte. Das makellose Gebiss, das schöne Gesicht. Ein Schauspieler. Er guckte ahnungslos und väterlich zugleich.
Sie fühlte sich, als habe Tom ein altes Spielzeug von ihr an ein Nachbarskind verschenkt, ohne sie zu fragen. Eine Spieldose, die ihrer Großmutter gehört hatte. Sie hätte ihm das ins Gesicht schreien können, aber sie fühlte sich zu dumm für einen Streit, der sich um Alex drehte und um die Band ihres Vaters. Sie hatte nie wirklich verstanden, was damals eigentlich passiert war, und bezweifelte, dass Tom es verstand. Nicht mal Alex hatte es erklären können. Sie hatte nur die Narben gespürt, alte Narben, die schmerzten, wenn sich das Wetter änderte. Sie kannte das von ihren Narben. Alex und sie hatten nicht miteinander reden müssen, was sie nach all dem Therapeutengewäsch genosssen hatte. Sie sah sich in Alex’ altem Jungengesicht wie in einem Spiegel.
Tom hatte die verschlungene Geschichte ihres Freundes an einen Hollywoodschauspieler verkauft, dachte sie. An einen dieser Kerle, die als unangepasst galten, weil sie zwanzig Kilo für eine Rolle abnahmen und in Interviews nachdenklich schwiegen. Wahrscheinlich hatte Tom Alex in einer Rauchpause verraten, um einen Eindruck zu hinterlassen. Tom wurde gleich am Anfang der Schlacht erschossen, sollte aber in den Albträumen des Helden auftauchen, der ihn erschoss. Das hatten sie angedeutet. Jake spielte den Helden. Er entschied, wer in seinen Träumen erschien.
»Ich dachte, der Film spielt im Zweiten Weltkrieg«, sagte sie.
»Verrat ist zeitlos«, sagte Tom.
Er schaute ernst. Er war von seinem Satz beeindruckt, dachte sie. Ein Spruch aus dem Poesiealbum. Sein Handy schnurrte wieder. Er sah es an, lächelte.
»Das ist ja das Problem«, sagte sie.
»Was?«, fragte er.
»Es hört nicht auf«, sagte sie. »Der Verrat geht immer weiter.«
»Genau das meine ich ja, Engel«, sagte er, nahm das Telefon, tippte.
Emma hatte nicht mehr die Kraft, ihm zu widersprechen. Es lag nicht am Blutdruck, dachte sie.
Sie schaute auf die Obstreste in der weißen Schale, die bereits ihre Farbe und ihre Form verloren. Zuerst die Bananen und die Pfirsiche, sie verdarben vor ihren Augen. Es ging alles so schnell. Sie hatte die Schale bei Crate and Barrel gekauft, in West Hollywood. Vor sechs Monaten, als sie sich einrichteten. Ein paar Handtücher, ein bisschen Geschirr, Korkenzieher. Sie hatte nicht gewusst, was sie brauchten, wie lange dieses Leben halten würde. Sie hatte West Hollywood gemocht, den kühlen Laden, in dem es gut roch, aber auch das Gefühl, in die Wärme zurückzukehren. Sie hatte die Leute auf den Bürgersteigen gemocht, denen es egal zu sein schien, was man von ihnen hielt. Tom hatte eine Rolle in einem Sandalenfilm, aus dem er später herausgeschnitten worden war, und die Aussicht, in einem Film über den ostdeutschen Cowboy Dean Reed mitzumachen. Sie hatte die Sachen in dem großen, leeren Papphaus verteilt, und es hatte ihr gefallen, die Leere, das Unverbindliche. Das Haus hatte vier Zimmer, eine große offene Küche und eine riesige Garage, in der Ecke lehnte ein altes Surfbrett. Das Haus stand in Huntington Beach, keine besonders spektakuläre Gegend, aber es waren nur drei Straßen bis zum Strand.
In den ersten Tagen war sie mit Tom zum Meer gelaufen, so oft, wie es ging. Die Welt war weit und offen. Klar war nur, dass Tom nie einen deutschen Soldaten spielen würde.
Er sprach Englisch ohne deutschen Akzent, weil er seine Kindheit in New York verbracht hatte. Sein Vater hatte damals einen Job bei den Vereinten Nationen gehabt, Tom war in die UN-Schule gegangen. Sie hatten Schulsport am East River gemacht. Sie dachte, dass sie sich deswegen in ihn verliebt hatte. Ein Prinz, der sie aus ihrem Dornröschenschloss befreien würde.
»Kommt er zu uns, oder gehen wir zu ihm?«, fragte sie.
»Was?«, fragte Tom.
»Jake«, sagte sie.
»Mal sehn«, sagte Tom.
Sie hatten keine Freunde hier, sie kannte niemanden, auch nicht die Nachbarn. Sie vermisste das nicht, glaubte sie, aber sie merkte, wie sie in den Gesprächen mit ihren Berliner Freundinnen verlorenging. Das Einzige, was sie in Los Angeles festhielt, war die Angst vor zu Hause. Sie hatte keine Ahnung, was sie noch machen sollte. Sie hatte aufgehört zu rauchen, dabei war Los Angeles die perfekte Stadt zum Rauchen. Es gab so viel Zeit und so wenig Gelegenheit zum Reden. Sie ging immer noch zum Meer, aber oft hatte sie das Gefühl, auf eine tapezierte Wand zu starren.
Toms Telefon summte. Er sah es an. Grinste.
»Was ist denn das die ganze Zeit?«, fragte sie.
»Alles wird gut, Baby«, sagte Tom, er tippte.
Emma war jetzt richtig wach. Ihr Herz pumpte, aber ihr Blut war kühl. Sie saß auf einem Schlitten oben auf dem Berg, bereit, herunterzufahren. Sie kannte das Gefühl. Sie wusste, dass sie nicht mehr anhalten konnte, wenn sie einmal losgefahren war. Aber Tom bemerkte das nicht. Er verstand nicht, was sie gesagt hatte. Er lächelte immer noch, den Blick auf dem Handy. Er schien sein Telefon anzulächeln. Ihr Freund verwandelte sich in die kalifornische Sonne, dachte Emma. Sie sehnte sich nach Schatten.
Sie stand auf, strich Tom über den stoppligen Nacken. Sie nahm die Obstschale und trug sie zur Spüle. Er folgte ihr mit seiner Kaffeetasse. Er küsste sie am Abwaschbecken auf die Wange, das Wasser tröpfelte. Aus dem Flur rumpelte der Trockner mit seinen Sportsachen, die sie später zusammenlegen würde.
Sie hatte Tom in Berlin kennengelernt, in Pankow, auf der Party einer Fotografin, die das letzte Cover der Steine fotografiert hatte, der Band ihres Vaters. Die Fotografin war die Tochter eines Schauspielers, der einst Irre, Familienmonster und Könige am Deutschen Theater gegeben hatte und heute gütige Großväter im Vorabendfernsehen spielte. Es waren viele früher berühmte Leute da gewesen und die Kinder der früher berühmten Leute. Zwischen ihnen hatte Tom ausgesehen wie ein kalifornischer Surfer. Die langen blonden Haare, das unschuldige Lachen, nichts von diesem verschwiemelten Ostmief, in dem jeder jeden kannte. Er kannte die Fotografin, hatte aber noch nie von den Steinen gehört. Er heuchelte kein Interesse an der verworrenen Vergangenheit der Partygäste. Erst später, im gleißenden Licht Kaliforniens, begriff er, dass ihre zerrissenen Biographien besseren Filmstoff hergaben als sein sorgloses Leben.
Tom war jeden Morgen im Dienstwagen seines Vaters aus einem New Yorker Vorort zu seiner Schule an den East River gefahren worden. Er spielte mit den Kindern von deutschen Mercedesverkäufern und Lufthansarepräsentanten auf gepflegten Rasenstücken. Vom ostdeutschen Cowboy Dean Reed hatte er erst hier in Los Angeles gehört, als der lange tot war.
Tom suchte seinen alten Gameboy, ohne den er nicht aufs Klo ging. Er spielte Tetris. Seit er zehn war, spielte er Tetris auf dem Klo. Er sah den Bauklötzen zu, die aus dem Himmel regneten. Wie ein kackender Affe.
Sie hörte die Klotür zufallen. Sie drehte das Wasser ab, ging zum Tisch, wo sein Handy lag. Sie las nie in seinen Mails, weil sie sich nicht vergiften wollte. Aber sie ahnte, dass es nicht mehr darauf ankam. Jake hatte geschrieben. Gott.
»really sorry to kill you, hermann! j.«
»its ok. there is an afterlife. t.«
»can’t wait to meet you there.«
»same here.«
Ein Leben nach dem Tod. Es sah so aus, als würde es Soldat Hermann in die Albträume des Hauptdarstellers schaffen.
Sie fragte sich, warum man kurze Namen wie Jake oder Tom abkürzte. Wahrscheinlich, um ihnen Bedeutung einzuhauchen. Ihr Frühstücksgespräch war nur ein Hintergrundrauschen für diesen wichtigen, großen Dialog gewesen. J und T. Der Star und sein Komparse.
Sie hatte immer gedacht, dass Tom irgendwann das Surfbrett von der Garagenwand nehmen und ausprobieren würde. Aber er war kein Surfer. Er sah nur so aus. Er spielte einen schwermütigen skandinavischen Auftragskiller, einen belgischen Drogenkurier in zwei Independentfilmen und dann doch den deutschen Soldaten in einer großen Hollywoodproduktion.
Eine Ausnahme, natürlich. Er hatte es mit dem Regisseur begründet, der einmal für den Oscar nominiert worden war, und natürlich mit Jake.
Sie hatte ihm den Nacken rasiert.
Sie hatte Obst geschnippelt, lange Briefe nach Deutschland geschrieben, den kalifornischen Himmel und das kalifornische Essen fotografiert und gepostet und einen Roman begonnen, in dem sich eine junge Frau in den besten Freund ihres Vaters verliebte. Sie hatte nie richtig beschreiben können, warum ihre Heldin das tat, und das Manuskript weggeworfen. Sie kannte die Betreiber der beiden Liquor Stores von Huntington Beach inzwischen so gut, dass sie nach Long Beach oder San Clemente fuhr, um Weißwein und Tequila einzukaufen. Sie machte Yoga. Neben ihr auf dem Boden lagen Männer in bunten Hosen und stöhnten, was Emmas Konzentration beeinträchtigte. Sie hoffte, dass es anfing zu regnen. Sie zählte die Tage bis Weihnachten, wenn sie nach Hause fliegen würde, ohne zu wissen, zu wem. Beim Einschlafen stellte sie sich vor, wie Los Angeles sich unter ihr auflöste, ein Sternenhimmel zu ihren Füßen. Sie hatte an den kalten, langen Berliner Winter gedacht. Der quecksilberne Himmel. Die verfrorenen Nächte auf dem Alexanderplatz, als sie siebzehn war oder achtzehn, die Hunde und die Punks mit den süddeutschen Dialekten, die sie nie wirklich gemocht hatte.
Das Handy brummte. Jake hatte noch eine Frage. »What does your girl say?«
In diesem Moment fuhr der Schlitten ab. Sie stieß sich nicht ab, sie ließ einfach los.
Sie würde Toms Turnhosen nicht mehr zusammenlegen.
»She says: Fuck you!«, tippte Emma. Eine Sekunde zögerte sie. Dann schickte sie die Nachricht ab. Ihre Botschaft an Hollywood. Es gibt kein Happy End.
Sie steckte Toms Handy ein. Dann ging sie in ihr Zimmer und packte ihre Sachen. Bevor sie das Haus verließ, dachte sie an einen Abschiedsbrief. Aber sie hatte eigentlich alles gesagt, was sie sagen wollte.
Emma kletterte in den Pick-up-Truck, mit dem Tom sich einredete, er gehöre dazu. Sie stellte ihre Reisetasche auf den Beifahrersitz und fuhr los. Die Häuser in der kleinen Straße waren alle flach und sahen aus, als könnte man sie an einem Vormittag abbauen, auf einen Laster packen und am Nachmittag irgendwo anders wieder aufbauen. Nichts hier stand für die Ewigkeit, was beunruhigend war, aber im Grunde nicht schlecht. Die Leute sahen nach vorn, der nächste Film, die nächste Stadt, alles war eine Herausforderung. A challenge. Niemand redete dir deine Träume aus.
Sie sah nicht mehr in den Rückspiegel.
Sie verließ Toms Leben so ansatzlos, wie sie es betreten hatte. Sie hatte in einer eiskalten Dezembernacht im letzten Winter vor seiner Wohnungstür in der Schlüterstraße gestanden. Sie war aus einem Konzert der Steine geflohen, mitten in dem Lied, das Alex für sie geschrieben hatte. Sie war mit der S-Bahn von der Warschauer Straße nach Charlottenburg gefahren und hatte an Toms Wohnungstür geklopft. Sie war bei ihm eingezogen. Ein paar Monate später begleitete sie ihn nach Amerika. Er wollte es versuchen, und sie verstand das. Es gab eine kleine Abschiedsparty im Familienkreis. Ihre Mutter war da und ihr Therapeut, Herr Wilhelm, den sie Ralph nennen musste. Ihr Vater war später dazugekommen, bekifft, mit einer Frau im Arm, die kaum älter war als sie und das Wort »Angus« auf der Innenseite ihres Handgelenks trug. Den Namen der Frau hatte sie vergessen. Das Abschiedsgeschenk ihrer Mutter war ein Christa-Wolff-Buch über deren Zeit in Los Angeles, wo die Schriftstellerin von ihrer ostdeutschen Vergangenheit eingeholt wurde. Sie hatte ihr einen Wackerstein mit auf die Reise gegeben. Vergiss nicht, wo du herkommst. Wir kriegen dich, wo immer du bist.
Es war Zeit gewesen zu gehen. Es war Zeit zu gehen.
Sie war Tom gefolgt wie ein Groupie. Ein anderer Mann. Kein Traum, wieder nur ein Mann. Sie schüttelte sich. Es waren nicht ihre Gedanken, sondern die ihrer Mutter, die immer noch versuchte, von der Band wegzukommen.
Als sie auf den Highway fuhr, stellte Emma sich vor, wie Tom vom Klo kam und nach ihr rief. Wie er langsam begriff, dass sie weg war. Dass es kein Auto gab, mit dem er zum Set fahren konnte, kein Telefon, mit dem er seine Abwesenheit erklären konnte, keine Nachbarn, die ihm helfen konnten. Keine Geschichte. Wenn alles so lief, wie sie sich das vorstellte, würde er seinen Tod verpassen. Ohne Tod kein Afterlife. Ohne Leben nach dem Tod kein Verrat.
Sie verkaufte den Truck an einen Autohändler am Stadtrand von Victorville und kaufte sich dafür einen zehn Jahre alten roten Jetta. Auf dem Weg nach Las Vegas hörte sie die erste der fünf Steine-CDs, die sie mit nach Amerika gebracht hatte. Die Platten hatten in der kleinen Diskothek gestanden, die ihr Vater im Kinderzimmer seiner Wohnung am Gendarmenmarkt für sie eingerichtet hatte. Sie hatte sie ewig nicht gehört, die Lieder schienen komplett aus der Zeit gefallen zu sein. Verstaubt und sperrig. Weil aber draußen die endlose Mojave-Wüste vorbeizog, ohne eine Radiostation, zu der sie flüchten konnte, war sie den Songs ausgeliefert. So lange, bis sie den Eindruck hatte, dass es um sie ging.
Hör auf zu pennen, Baby
Fang an zu rennen, Baby
Nimm meine Hand
Dann wirst du sehn
Laufen ist viel besser als stehn
Renn Baby, renn Baby, renn Baby.
Emma sang den Refrain aus vollem Hals.
An einem Kiosk, der in der Wüste stand wie eine Fata Morgana, kaufte sie sich eine Packung Zigaretten. Sie stand in der Hitze, rauchte und fühlte, wie langsam die Zeit verstrich. Sie mochte die Wüste. Sie hatte nicht viel von Amerika gesehen außer Tijuana, wo sie zweimal gewesen war, um neue Einreisestempel zu bekommen. Als sie die Wüste verließ, hatte sie zehn verpasste Anrufe auf ihrem Handy und fünfzehn auf dem von Tom. Sie schaltete die Telefone aus.
Emma hatte vom Autotausch zweitausend Dollar übrig. Für neunzig Dollar mietete sie ein Hotelzimmer im alten Teil von Las Vegas. Sie verspielte fünfzig Dollar an einem Automaten und ließ sich in einer Bar von einem betrunkenen Geschäftsreisenden aus Chicago zu vier Gin Tonic einladen. Der Mann erzählte ihr, dass er eine Tochter in ihrem Alter habe, die den Kontakt zu ihm abgebrochen habe. Er zeigte ihr Fotos. Ein amerikanisches Mädchen, mit einem Lächeln, das man anknipsen konnte wie eine Lampe. Sie erzählte dem Fremden von Herrn Wilhelm, ihrem Berliner Therapeuten, den sie Ralph nennen musste. Wilhelm hatte mit ihr über ihre Ladendiebstähle, die Nächte unter freiem Himmel, ihre Schlaflosigkeit, ihre schlechten Zensuren und die Beziehung zum Freund ihres Vaters geredet. Vor allem über die Beziehung zum Freund ihres Vaters, der etwa so alt wie Ralph selbst war. Der Gedanke schien ihn zu erregen. Emma spürte, wie der Geschäftsreisende aus Chicago über der Geschichte vergaß, dass sie im Alter seiner Tochter war. Sie verließ die Bar, als er auf dem Klo war. Sie lief durch die blinkende, lärmende Stadt, bis sie jedes Gefühl dafür verloren hatte, wo sie war.
Auf dem Hotelzimmer schrieb sie eine lange Mail an Tom. Sie war betrunken, traurig und einsam. Sie erklärte ihm all die Dinge, die sie heute Morgen, in einem anderen Leben, verschwiegen hatte. Sie schickte die Mail nicht ab, weil sie den Eindruck hatte, dass sie noch nicht fertig war. Stattdessen schickte sie eine kurze Entschuldigung.
Als Toms Antwort eintraf, schlief sie bereits.
»Alles gut, Emma. Pass auf dich auf und komm zurück, wenn du so weit bist. Tom.«
Sie lächelte, als sie das am nächsten Morgen las. Er hatte sie immer noch nicht verstanden. Sie fuhr weiter ostwärts, weiter von ihm weg. Wohin, wusste sie nicht, aber das war egal, sie hatte noch viel Platz. Sie fuhr an Bergen vorbei, die gelb waren, orange, blutrot und dann wieder gelb. Die Steine sangen ihre Lieder aus einer Zeit, die Emma nicht kannte. Eine Zeit aber, in der sie immer noch zu leben schien.
Sie warten nicht auf London, und nicht auf Paris
Sie warten auf ihr kleines Paradies
Später dann im Schrebergarten
machts uns Spaß zu warten
Das Licht geht aus, der Kopf wird kahl
Im Wartesaal, im Wartesaal.
Emma sang, der Himmel über ihr war fast weiß.
In Boulder, Utah, tankte sie an einem alten Trading Post. An der Kasse stand ein Mann mit störrischen schwarzen Locken. Er war vielleicht Mitte zwanzig und hörte Dylan, laut. »Simple twist of fate« vom Album »Blood on the tracks«. Eine ganze Platte Liebeskummer. Das konnte alles kein Zufall sein. Der Junge wirkte, als hätte ihn Tom dort hingestellt. Ein singendes Telegramm. Er sah selbst ein wenig aus wie der junge Dylan. Ein freundlicher, zufriedener Dylan allerdings.
»›Blood on the tracks‹«, sagte sie.
»Doesn’t get any better than that«, sagte der Junge. Besser geht’s nicht.
»Ein bisschen traurig«, sagte sie. Sie kannte die Platte, weil auch die zu der kleinen Sammlung gehörte, die ihr Vater für sie zusammengestellt hatte. Sein Kanon.
»Traurig, aber wahr«, sagte der Junge.
Der nächste Song war »You’re a big girl now«:
Time is a jet plane, it moves too fast
oh, but what a shame
that we’ve shared can’t last
and I can change I swear.
Bob Dylan gab ihr ein kleines Privatkonzert. Sie zahlte.
»Wo geht’s hin?«, fragte der Junge.
»Mal seh’n«, sagte Emma. »Erst mal nach Osten.«
»Gut«, sagte er.
Er wollte nicht wissen, wo sie herkam. Er wollte nicht wissen, wer sie war, wie sie hieß und warum sie Dylans trauriges Album kannte, das viele Jahre vor ihrer Geburt erschienen war. Keine Fragen. Er lebte im Augenblick. Alles, was er wissen wollte, war, in welche Richtung sie fuhr. Ein Schritt und dann der nächste. Herr Wilhelm hätte geklatscht.
»Irgendwas, was ich unbedingt sehen muss?«, fragte Emma.
»Halt dich an die 12. Schöne Straße. Es ist auch die einzige. Du siehst alles, was du sehen musst. Ich komm ja hier kaum raus. Aber wenn du oben auf dem Berg bist, gibt es rechts einen Parkplatz. Von da kannst du übers Tal sehen. Sehr schön. Als würdest du direkt im Himmel stehen.«
Sie sah ein Skateboard und eine Gitarre. Sie sah die hellen Augen des Jungen. Sie hätte gern seinen Namen gewusst und sich noch ein wenig im Augenblick ausgeruht, in dem er lebte, ohne Vergangenheit und ohne Zukunft, aber gleich würde Dylan »If you see her, say hello« singen, und sie war sich nicht sicher, ob sie das aushalten konnte.
»If she’s passing back this way, I’m not that hard to find.«
Boulder, Utah, war winzig, hundert Häuser vielleicht. Sie fuhr in Serpentinen in die Berge und hielt am Aussichtsplatz, den ihr der junge Dylan empfohlen hatte. Eine kleine Gruppe von Menschen stand am Abgrund und sah in den Himmel, wo sich eine riesige schwarzblaue Wolke über einer endlosen Ebene zusammengeballt hatte. Die Wolke schaute auf sie herab wie ein wütender Gott. Auf einer Informationstafel las Emma, dass Boulder Mountain eine Wetterscheide war. »Weathermaker« stand dort. »Wet and wild.« Über ihr und hinter ihr war der Himmel wolkenlos, vor ihr war er schwarz. Es würde regnen, dachte Emma.
Sie stand auf dem Parkplatz, atmete tief ein und aus. Dann lief sie zum Auto zurück. Sie startete den Motor und mit ihm ein Gitarrensolo von Alex.
Der vierte Song von »Thälmannpark«, einem Konzeptalbum der Steine aus den Achtzigern. Ihr Vater hatte es neben »Nebraska« von Springsteen einsortiert. Weil es da hingehörte, wie er sagte.
»Der gelbe Rauch der Kachelöfen liegt auf unseren Hinterhöfen«, sang Nora.
Emma drückte auf die Stopptaste. Sie hatte plötzlich das Gefühl, sie würde an diesem Scheißkachelofenrauch ersticken. Sie wollte nicht wieder zurück zu den verdammten Hinterhöfen. Sie wollte sich nicht wieder in den nächsten Arm werfen. Sie dachte an die Frau, die sie auf dem letzten Konzert der Steine getroffen hatte. Eine Reporterin, die ihre Geschichte hören wollte. Dieser Blick, traurig und gierig zugleich. Sie wollte von ihrem Blut leben, wie Alex von ihrem Blut leben wollte und zuletzt Tom und Jake. Dabei hatte sie schon so niedrigen Blutdruck.
Emma lächelte. Sie ließ die CD aus dem Player schnippen, tat sie in ihre Hülle und warf sie zu den anderen auf den Rücksitz. Genug, dachte sie. Es war genug. Es musste einen Ort geben, wo nicht immer die Sonne schien oder nie.
Sie suchte sich erst mal eine Radiostation. Sie fand einen knisternden Led-Zeppelin-Song, kaum noch zu verstehen, einen Klassiksender und schließlich eine Popstation. Pop war gut. Sie fuhr los, ostwärts, direkt auf die große schwarzblaue Wolke zu.
Die Menschen auf dem Boulder-Mountain-Aussichtsparkplatz schauten der schmalen jungen Frau hinterher. Sie sahen, wie ihr Jetta langsam in der großen dunklen Wolke verschwand. Es schien, als würde die Fahrerin des roten Autos dieser Welt entfliehen.
Truppenabzug
Conny, 1994, Juni
Als der Sommer begann und Jürgen Wilhelm endlich bereit schien, sich auf eine neue Beziehung einzulassen, meldete sich seine alte Liebe zurück.
Es war Juni, und Jürgen Wilhelm, den alle Conny nannten, obwohl kaum jemand wusste, warum, flog mit hundertfünf Stundenkilometern über das schnurgerade Stück der Fernverkehrsstraße 96 in Richtung Löwenberg. Brandenburgische Alleebäume, Pappeln zumeist, salutierten, silbrige Blätter flirrten in der Mittagssonne, aus den Autolautsprechern schrie Zazworka, eine Lichtenberger Band, die Conny im Begriff war, groß rauszubringen:
Ich tat den Stich
die Meute wich
Ich häute dich
Ich häute dich!
Da rief Nora an und bat ihn zurückzukommen. Natürlich bat sie nicht direkt – Nora war kein Mensch, der um etwas bat, schon gar nicht Conny –, aber er hörte es schon am Ton, in dem sie ihren Namen sagte. Er las es zwischen den Zeilen. Wenn jemand zwischen den Zeilen lesen konnte, dann er.
»Wat iss denn dit fürn Lärm?«, fragte Nora.
»’ne Band, die ick manage«, sagte Conny und zog instinktiv den Bauch ein. Nora pflegte mit einem Blick auf seinen Bauch Diskussionen zu beenden. Der Bauch trennte ihn von der Band. Die da, er hier. Es war nicht besser geworden in den beiden Jahren, seit die Steine sich aufgelöst hatten. Seine Jeansgröße war im Bund von 36 auf 38 gewachsen, und er hatte erst vor ein paar Minuten den obersten Knopf geöffnet.
Nora atmete.
»Vielleicht«, sagte Conny.
»Vielleicht wat?«, fragte sie.
»Vielleicht manage«, sagte er.
»Die klingen wie Nazis in zu engen Hosen«, sagte Nora.
»Na ja«, sagte Conny Wilhelm und schaltete, das größer werdende Löwenberger Ortseingangsschild im Blick, vom fünften in den vierten Gang herunter. Zazworka waren im Schnitt zehn Jahre jünger als die Bandmitglieder der Steine, und er war sich sicher, dass Nora sich darüber informiert hatte, bevor sie ihn anrief. Nora duldete keine fremden Götter neben sich, schon gar keine jüngeren, auch wenn das natürlich eine Frechheit war.
Sie hatte ihn gefeuert. Zweimal in den letzten vier Jahren hatte Nora Conny gefeuert.
Das erste Mal hatte sie es im Februar 1990 getan, nachdem sie aus New York zurückgekehrt war, wo sie in den Monaten nach dem Fall der Mauer zu sich selbst finden wollte, zu ihren Wurzeln, zu ihren Überzeugungen oder wozu auch immer. Conny hatte es nie ganz verstanden. Nora aber glaubte, als neuer Mensch aus Amerika zurückgekehrt zu sein. Dieser neue Mensch brauchte keinen Manager mehr. Gleich nach der Landung in Berlin löste sie die Band auf, um sich auf ihre erste Soloplatte zu konzentrieren. Die Platte erschien ein Jahr später, im Januar 1991, sie hieß »Bungalow« und floppte, obwohl sie gut war. Es war die erste brandenburgische Rockplatte überhaupt. Man höre das Harz aus den Nadelbäumen tropfen, hatte jemand in der kulturpolitischen Wochenzeitung Sonntag geschrieben, kurz bevor diese in Freitag umbenannt worden war.
Conny schaltete in den dritten Gang, rollte mit sechzig Stundenkilometern in Löwenberg ein und passierte den Blitzer, der dreißig Meter hinterm Ortseingangsschild wartete, mit zweiundfünfzig. Er konnte die Strecke zu seinem Hof volltrunken im Halbschlaf fahren und hatte es oft genug getan. Der Löwenberger Blitzer stand dort schon zu Ostzeiten, glaubte Conny, obwohl er sich nur schwer vorstellen konnte, wie sie damals in der Lage gewesen sein sollten, so komplizierte Geräte überhaupt herzustellen. Er begann zu vergessen. Das tat gut, einerseits. Andererseits schmerzte es.
Der Anruf von Nora wühlte in ihm.
Conny strich sich ein paar Zuckerkrümel des Fettgebäcks, das er in Oranienburg gekauft und kurz vor Teschendorf gegessen hatte, vom Bauch. Ein Pfannkuchen und ein Kameruner. Besser als zwei Pfannkuchen, hatte er in der Bäckerei gedacht. Auch die Füllung machte dick. Ein paar Krümel rutschten in den leicht geöffneten Hosenbund seiner Jeans.
»All meine dunkle Wut fährt in dein warmes Blut«, brüllte Fleischer, der Sänger von Zazworka.
»Wo bist’n?«, fragte Nora.
»Aufm Weg nach Hallgow«, sagte Conny.
»Halligalli«, sagte Nora, die alles, was sie mochte, aber nicht besaß, in Phantasiewörter kleidete. Sie machte seine Welt zu ihrer Welt. Auf ihrer Soloplatte hatte sie die Bäume, die Vögel und den Sand Brandenburgs besungen. »Ich bin eine Kiefer im Märkischen Sand«, hieß es in einem Lied. Conny hatte geweint, als er es zum ersten Mal hörte. Nora erzählte von Conny. Sie sang über Hallgow, wo er 1978 einen alten dreiseitigen Bauernhof gekauft hatte, auf dem sich in jedem Sommer der achtziger Jahre die halbe ostdeutsche Rockszene getroffen hatte. Die bessere Hälfte. Hier waren sie gewachsen, in diesem trockenen Boden steckten ihre Wurzeln, das fühlte Conny, wenn er Noras Lied hörte, die Wurzeln anspruchsloser, widerstandsfähiger Geschöpfe. Sie waren struppig, wuchsen schnell und dufteten, wenn die Sonne auf sie fiel. Nora hatte verstanden, aus welchem Holz sie waren, vor allen anderen, das war immer ihre Stärke gewesen.
Er wusste nicht, was sie im Moment dachte. Die Landschaft vor seinen Autofenstern blühte.
Es klang, als zündete sich Nora eine Zigarette an. Conny rauchte seit zwei Jahren nicht mehr und fühlte sich besser seither. Noch schlimmer, als dick zu sein, war rauchen und dick zu sein. Er war ein dicker Raucher gewesen. Er hatte Duett geraucht, eine kleine Extravaganz. Es war ihm erstaunlich leichtgefallen aufzuhören, aber jetzt fühlte er den Phantomschmerz zwischen seinen Fingern.
Conny schaltete in den zweiten Gang und bog, nun in der Dreißigerzone, nach rechts auf die Löwenberger Dorfstraße.
»Schön, dass du dich meldest«, sagte er, schlich durchs Dorf, links der Bäcker, ein guter Bäcker. Conny war satt und hungrig zugleich. Er dachte an einen Spruch, den ihr Roadie Schwenni in den Achtzigern gemacht hatte. »Entweder ick hab Hunger, oder mir iss schlecht.« Guter Spruch, wie für ihn gemacht.
»War Zeit«, sagte Nora.
»Das kannst du laut sagen«, sagte Conny.
»Mmhh«, machte Nora.
Das zweite Mal hatte sie ihn vor einem guten Jahr rausgeschmissen, praktisch noch während der Wiedervereinigungstour der Steine. Anfang ’93 hatte Nora die Band wieder zusammengetrommelt. Um genau zu sein, hatte sie Conny damit beauftragt, die Band zusammenzutrommeln. Er war immer der Erste, der wieder eingestellt wurde, vermutlich, weil er auch der Erste war, den sie rauswarf. Nie wäre es Conny in den Sinn gekommen, sich dagegen zu wehren. Als Manager. Er war kein Strippenzieher, er war ein Zuhörer, ein Therapeut, ein Dienstleister. In guten Momenten suchte Nora das, in schlechten hasste sie ihn dafür.
Die Jungs kamen zurück, sie schienen damals auf seinen Anruf gewartet zu haben. Nur Vonnie, ihr Keyboarder, wollte nicht mehr. Etwas in ihm schien zerbrochen zu sein. Conny versuchte lange, ihn zu überreden, obwohl er ihn verstand und sogar ein wenig beneidete. Sie nahmen ein paar neue Songs auf und gingen auf Tour. Die Sisyphus-Tour. Es war ein Desaster. Vielleicht lag es am Titel. Die Menschen wollten Steine, die flogen oder rollten, keine, mit denen man sich den Berg hochquälte. Zum Konzert in Jena kamen 25 Fans, Weimar musste abgesagt werden, auf dem Weg nach Erfurt entließ ihn Nora zum zweiten Mal. Er blieb noch bis zum großen Finale (der Tour) in Berlin dabei, aber er war ein toter Mann. Er erinnere sie zu sehr an früher, hatte Nora, im schmalen Gang des Tourbusses schaukelnd, gesagt. Im Guten wie im Schlechten. Es war eine grundsätzliche Erklärung gewesen, die Conny allerdings nur zur Hälfte verstanden hatte, weil im Busrekorder gerade »Paradise City« von Guns N’ Roses lief. Schwenni liebte Guns N’ Roses und hatte die Anlage auf volle Lautstärke gedreht. »Take me down to the paradise city, where the grass is green and the girls are pretty. O won’t you please take me home.«
»Was kann ich für dich tun?«, fragte er.
Es hörte sich an, als würde Nora Rauch in die Muschel blasen. Sie hasste diese aufgeräumte Managerart an ihm, und er wusste das. Eigentlich. Sie hatten lange nicht mehr miteinander geredet, er war eingerostet. Sie wollte einen Manager, und sie wollte auch keinen. So war das, dachte Conny.
»Bis du noch da?«, fragte er.
»Wir haben neuet Material«, sagte Nora. »Songs, Texte, Pipapo.«
»Wir?«, fragte Conny.
»Ick habe geschrieben, Alex hat geschrieben, und wir dachten, wir stellen es der Band vor.«
»Ihr redet wieder miteinander?«, fragte Conny, schaltete hoch und beschleunigte den Wagen, das Löwenberger Ortsausgangsschild im Auge, auf achtzig Stundenkilometer. Die Fernverkehrsstraße 96, die noch vor zweihundert Metern Berliner Straße hieß, nannte sich nun Granseer Straße. Löwenberg war die Wasserscheide, die Südseite des Ortes wurde noch von Berlin angezogen, der Norden steckte in Brandenburg fest. Er dachte an die epischen Schlachten, die sich Nora und ihr Gitarrist Alex in den letzten Jahren geliefert hatten. Sie hatten sich geliebt, sie hatten sich gehasst. Sie trieben die Band an, aber am Ende hatten sie die anderen genervt. Das Rausgerenne, Türengeknalle und diese endlosen Ansprachen. Als schaue man einem hoffnungslosen Ehepaar bei der Scheidung zu.
»Wir mussten reden.«
»Was heißt denn das?«
Fleischer schrie aus dem Autoradio: »Ich zieh das Eichenblatt von deiner Scham, schöpf’ meinen Rahm, schöpf’ meinen Rahm.«
»Kannste ma die Mugge bisschen runterdrehen«, sagte Nora. »Dit iss ja grauenvoll.«