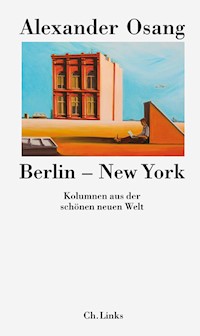9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Literarische Publizistik
- Sprache: Deutsch
Alexander Osang spürt in seinem dritten Porträtband der Verführbarkeit kleiner wie großer Leute nach. Alle wollen sie letztlich auf die Sonnenseite des Lebens kommen, möglichst im Rampenlicht stehen und bewundert werden. Dafür sind viele bereit, einen außergewöhnlich hohen Preis zu zahlen, frühere Grundsätze aufzugeben. Dies betrifft den prominenten Talkmaster genauso wie den Politiker, den bewunderten Sportler wie den alternativen Musiker, die kleinkriminelle Trinkerin wie die schöne Hausfrau mit ihren Amerika-Träumen.
Osang denunziert seine Figuren nicht, sondern versucht sie begreifbar zu machen. Unaufdringlich werden die vielfältigen Versuchungen vorgeführt, denen jeder von ihnen ausgesetzt ist. Dabei nimmt sich Osang selbst nicht aus, sondern berichtet mit entwaffnender Offenheit von seinen eigenen Versuchungen in der alten wie der neuen Gesellschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Alexander Osang
Das Buch der Versuchungen
20 Porträts und eine Selbstbezichtigung
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
1. Auflage als E-Book, Mai 2018
entspricht der 1. Druckauflage vom März 1996
© Christoph Links Verlag GmbH
Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0
www.christoph-links-verlag.de; [email protected]
Cover: KahaneDesign, Berlin
unter Verwendung eines Fotos von Ronald Siemoneit
eISBN 978-3-86284-418-0
Für Anja und all die Versuchungen,von denen hier nicht die Rede ist
Inhaltsverzeichnis
Eigentlich nein
Vom großen Glück, daß Pjöngjang nicht New York ist
Ich war doch gut, oder?
Otto Waalkes ist nach zwölf Jahren Pause wieder auf Tournee – er hat sich nicht verändert, aber er wird nie wieder so wie früher
Der gespaltene Arsch
Als Wolfgang Lippert der Nachfolger von Thomas Gottschalk werden sollte
Zusammen 305 Kilo
Den Herzbuben Wilfried Gliem und Wolfgang Schwalm darf jeder an den Bauch fassen, der Lust dazu hat, denn die beiden sind Scherzartikel
Du mußt kein Schwein sein
Sebastian Krumbiegel von den Prinzen zitiert Freddy Mercury, kauft Immobilien und wählt die PDS
Mühsame Schritte zum Regenbogen
Der ehemalige RIAS-Star-Diskjockey Lord Knud verlor Bein, Geld, Freunde, Job, Publikum – und macht weiter
Ein kleines deutsches Abenteuer
Erich Böhme ist als Herausgeber der Berliner Zeitung grandios gescheitert, aber niemand hat es gemerkt
Der Ball ruht
Heinz Florian Oertel kommentiert noch einmal ein Weltmeisterschaftsspiel, diesmal aus seinem Wohnzimmer
Sepp Herberger in Parchim
Berthold Fieber kaufte für seinen kleinen Mecklenburger Fußballverein einen afrikanischen Stürmerstar und träumt von großen Tagen
Der Pate von Dresden
Der ehemalige Dynamo-Präsident Rolf-Jürgen Otto spielte mit Fußballern, Pferden, Bauarbeitern, Kellnern und Croupiers – und verlor
Den Damen muß man guten Tag sagen
Michail Gorbatschow auf dem Weg zum idealen Werbeträger
Bringt das was?
Gregor Gysi muß immer schlagfertig und witzig sein, auch wenn er traurig ist
Daniel in der Löwengrube
Der Politiker Thomas Krüger zwischen Anarchie und Anpassung
Der Herbstrevolutionär im Beamtenkleid
Gelegentlich will Joachim Gauck der Welt beweisen, daß er nicht so staubig ist wie die Akten, die er zu verwalten hat
Stimme ohne Radio
Der ehemalige Star-Moderator Lutz Betram würde gern bereuen – aber was eigentlich?
Der Wächter der Flugschule
Die Trips des Gerhard Gundermann
Venus wollte am Schluß nicht einmal bezahlen
Meister Krüger versammelte seine ehemalige Rohrlegerbrigade nach vier Jahren wieder zu einer Grillparty – es sollte so sein wie früher
Sie lebt noch
Heldin, Lügnerin, Reuevolle – das Potsdamer »Skinheadopfer« Elke Sager-Zille ist nach einem kurzen Medienwirbelstrurm wieder zu Hause
Pamela vor Rauhfaser
Um dem Star aus der SAT.1-Serie »Baywatch« nahezukommen, frisierte Nicole Bohneberg aus Halle sich und ihre Biographie
Klavier konnte ich auch
Die 52jährige Berliner Trinkerin Monika Kößler wurde wegen Kleindiebstählen mit einem Schaden von etwa 1 000 DM zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt
Der Kohlhaas von Köpenick
Von seinem Sofa aus rechnet Aurel Müller-Schönlein mit dem »Mistvolk« dieser Welt ab
Eigentlich ja
Ein Tag im Leben
Quellen- und Fotonachweis
Über den Autor
Eigentlich nein
Vom großen Glück, daß Pjöngjang nicht New York ist
Manchmal sitzt einem die Versuchung schon auf dem Schoß, und man erkennt sie trotzdem nicht. Weil sie so harmlos aussieht, so unansehnlich, überhaupt nicht verführerisch eben. Sie sitzt da, grinst einen unterwürfig an und tut einem fast leid, so blaß, wie sie ist.
Meine zum Beispiel nannte sich Jörg und sah aus wie ein Arsch.
Ich meine, er sah aus, wie man sie sich immer vorgestellt hatte. Ein leicht aufgedunsenes, blasses Gesicht, mit einem weichen Lächeln mittendrin, das er aus- und anknipsen konnte. Die schmutzigblonden, dünnen Haare hatten sich bereits bis zum Ende der Stirn zurückgezogen. Er trug eine dunkelbraune Bundlederjacke und war vielleicht Anfang dreißig. Er sah aus, wie sie eben aussahen. Untalentierte Lehrlinge oder Studenten, die hauptamtliche FDJ-Sekretäre wurden. Soldaten, die ihre Dienstzeit freiwillig von anderthalb auf zehn Jahre erhöhten. Junge Funktionäre, die in ein paar Jahren Alkoholprobleme bekommen würden. Keinen Mut, keinen Charakter, keinen Halt – nur irgendwelche verwaschenen Überzeugungen und trinkfeste Vorgesetzte als Vorbilder. Er hätte Kriminalist sein können, wie er am Telefon gesagt hatte. Aber er war kein Kriminalist. Und wahrscheinlich hieß er auch nicht Jörg.
Ich betrat also das Café Kisch, das es einst Unter den Linden gab, um der Kriminalpolizei bei den Ermittlungen gegen einen Straftäter zu helfen, von dem ich bislang nur wußte, daß er in meinem Haus wohnen sollte. Der Mann, der sich Jörg nannte, saß an einem kleinen Tischchen neben der Bar im Qualm und winkte. Ich setzte mich zu ihm, und er fragte, was ich denn trinken wolle. Kaffee, sagte ich. Er bestellte ein Kännchen, und bis es kam, erzählte er, daß ihm mein Name in der Berliner Zeitung aufgefallen wäre, weil mein Schreibstil, nun ja, irgendwie spritziger sei als der der anderen, was mir schmeichelte, obwohl ich mir nicht vorstellen konnte, daß es stimmte. Schließlich war ich Wirtschaftsredakteur. Dann war das Kännchen Kaffee da, und er sagte: »Ich muß dir erst mal was gestehen. Ich bin nicht von der Kriminalpolizei. Ich arbeite für das Ministerium für Staatssicherheit. Und wenn du jetzt gehen willst, dann kannst du das gern tun.«
Ich trank einen Schluck Kaffee.
Wieso duzt er mich eigentlich?
Du weißt doch, daß sie das alle tun, diese Funktionärstypen. Kümmere dich nicht drum! Bedanke dich für den Kaffee und verschwinde!
Moment mal, ich weiß doch gar nicht, was er von mir will. Vielleicht will er mir ja irgendwas sagen, was wichtig ist.
Bist du wahnsinnig!? Staatssicherheit – Stasi, Staasiiiii! Steh auf! Hau ab! Er hat es dir angeboten!
Eben. Er hat es mir angeboten. Er hat mich überhaupt nicht unter Druck gesetzt. Wenn er mir gesagt hat, was er will, dann kann ich immer noch gehen.
Du weißt doch, was er will!
Nein.
Doch.
Was denn?
Tu nicht so naiv.
Gut, aber ich weiß nicht, was er weiß. Vielleicht weiß er ja was von mir. Wir sollten nichts überstürzen.
Wenn dich hier irgend jemand von deinen Freunden mit diesem Typen sitzen sieht, bist du untendurch. Ich meine, der sieht doch aus wie der Prototyp eines Stasi-Spitzels.
Er könnte auch Kriminalist sein.
Eri s tkein Kriminalist.
Ich will ja nur wissen, was er weiß. Nur das. Dann gehe ich einfach raus. Und das war es.
Tu’s doch, wenn du es mußt. Du bist doch sowieso der letzte Opportunist geworden. Du Parteijournalist! Schau dich doch mal an. Lügst deine Leser an. Und jetzt sitzt du mit ’nem Stasi-Typen am Tisch.
Ach, komm.
Wenn du auch nur ein einziges Zugeständnis machst, bringe ich mich um.
»Ich meine, es kann ja sein, daß du irgendwelche grundsätzlichen Probleme mit dem Staatssicherheitsdienst hast«, sagte Jörg. Und lächelte.
»Äh, grundsätzliche, nein. Hat ja irgendwie jedes Land so einen Sicherheitsdienst, nicht? Offenbar braucht man den.«
»Gut«, sagte Jörg, als sei damit irgend etwas entschieden, »dann kann ich dir erst mal eine erfreuliche Mitteilung machen. Deine Redaktion hat ja den Antrag gestellt, daß du zu den Weltfestspielen nach Korea fährst. Ich kann dir sagen, daß wir diesem Antrag zugestimmt haben. Ich weiß es aus den Akten.«
Das war nun wirklich ein Hammer. Ich hatte nicht damit gerechnet. Korea! Das war fast Japan! Eine andere Welt! Ich strahlte, und Jörg strahlte auch.
Offenbar war es das gewesen, was er mir sagen wollte. Denn Jörg hatte es auf einmal eilig. Hier sei nun wirklich nicht das richtige Umfeld für ein Gespräch unter vier Augen, meinte er. Das schien mir einleuchtend. Überall standen Leute, rauchten und redeten. Korea!
Jörg sagte, daß der Kaffee selbstverständlich auf seine Rechnung ginge. Er würde sich noch mal bei mir melden. Er würde anrufen. Eine Bitte habe er jedoch. Zu keinem ein Wort über unser Treffen. Logisch, dachte ich. Nichts leichter als das. Ich sah mich noch mal um, ob hier irgendein bekanntes Gesicht war, entdeckte niemanden, verabschiedete mich und betrat wieder die Linden.
Die Sonne schien. Korea!
Du bist der letzte Idiot!
Ich?
Ja du. Was willst du denn mit dem unter vier Augen bereden?
Mensch, was willst du denn überhaupt? Er hat mich überhaupt nichts gefragt. Ich mußte kein Zugeständnis machen.
Ach ja? Und was war mit deinem Jedes-Land-braucht-einen-Sichherheitsdienst-Gequatsche.
Ein Allgemeinplatz.
Ja und was soll er davon halten? Ich will dir sagen, was das für ihn heißt: grundsätzliche Bereitschaft zur Zusammenarbeit! Alexander Osang ist grundsätzlich bereit, mit uns zusammenzuarbeiten. Alexander Osang ist grundsätzlich bereit, Stasi-Spitzel zu werden.
Das habe ich nicht gesagt.
Aber er hat es so verstanden.
Das ist sein Problem.
Es wird dein Problem werden. Er wird wieder anrufen.
Ja und?
Er wird dir Fragen stellen.
Ich habe keine Angst vor Fragen.
Das werden wir noch sehen. Du willst doch nach Korea fahren, oder?
Ja sicher.
Du hast ihm eben versprochen, kein Wort über euer Treffen zu sagen. Und was erzählst du deiner Freundin? Sie weiß doch, daß du dich mit einem Kriminalisten treffen wolltest, oder?
Ich werde ihr sagen, daß es ein Irrtum war. Daß sie einen anderen suchten, irgend so was. Mir fällt schon was ein.
Ich werde dir mal was sagen, mein Freund. Du sitzt in der Scheiße.
Hör doch auf. Ich habe ihm versprochen, nichts zu sagen. Also sage ich nichts. Was ist denn schon dabei.
Ich kann’s nicht mehr hören. Du bist ein Weichei. Du kannst nicht nein sagen. Sieh dir doch nur dein verpfuschtes Leben an. Du charakterloses Schwein. Du kannst doch keinem mehr in die Augen gucken. Und jetzt sagst du dir: Ach, dann mach’ ich eben auch noch bei der Stasi mit.
Niemals!
Wir werden sehen.
Der Anfang war wohl, daß ich mitspielen wollte. Jedenfalls passierte es öfter, daß meine Klassenkameraden nach der Schule noch irgend etwas zusammen unternahmen, das sie Pioniernachmittag nannten. Sie banden sich blaue Halstücher um, nahmen sich an die Hände und marschierten irgendwohin, wo es offenbar lustig war. Manchmal erzählten sie am nächsten Tag davon. Man kam sich vor, als habe man »Daktari« verpaßt.
Wenn die Klasse zum Pioniernachmittag aufbrach, blieben zwei Kinder zurück. Annegret Teschner und ich. Annegret Teschner war ein blasses, zerbrechliches Mädchen, das an einer schweren Krankheit litt. Einmal, als Annegret fehlte, sie fehlte oft, erzählte uns unsere Klassenlehrerin mit ernster Miene, daß Annegret viel früher sterben würde als wir. Womöglich schon bald. Das tat mir sehr leid, aber ich wäre dennoch lieber mit Frank Barnow, dem besten Fußballspieler meiner Klasse, von den lustigen Pioniernachmittagen ausgesperrt worden, als mit der hohlwangigen Annegret, die eine gläserne, hohe Puppenstimme hatte und eine spitze Nase. Ich war dick und hatte Sommersprossen, was im Alter von sechs, sieben Jahren ohnehin schwer zu ertragen ist. Zudem heiße ich Alexander, worauf sich »Arsch auseinander, Arsch wieder zusammen und du bist dran« reimt, meine Eltern erlaubten mir nicht, Jungpionier zu sein, und dabei hatte ich auch noch die sterbenskranke Annegret an meiner Seite. Und leider passierten im Religionsunterricht, den ich besuchen durfte, nicht die interessanten Dinge, mit denen ich meine Mitschüler hätte beeindrucken können. Wir hatten einen Kaplan, der uns an den Ohren zog, wenn wir in dem Bibelquiz, das er jede Stunde durchführte, versagten, und einen rotgesichtigen Pfarrer, der wenige, graue Haare und immer schlechte Laune hatte. Frank Barnow kannte zwar alle Spieler von Tennis Borussia, aber was ein Kaplan war, wußte er nicht.
Als ich in die vierte Klasse kam, konnten es meine Eltern offenbar nicht mehr mit ansehen. Vielleicht hatte es auch eine Aussprache gegeben, weil zum gleichen Zeitpunkt auch Annegret Teschners Eltern aufgaben. Annegret und ich bekamen bei einer kleinen, intimen Aufnahmefeier unsere blauen Halstücher ausgehändigt. Die Pioniernachmittage waren dann gar nicht so lustig, wie ich angenommen hatte. Aber ich war dabei. Ich gehörte dazu. Ich war kein Außenseiter mehr. Es war warm und wohlig in der Masse. Ich begann mich aufzulösen. Das war wohl der Anfang.
In der Folgezeit stand ich manchmal andächtig vor den Gedenkstätten ermordeter Grenzsoldaten, ministrierte dreimal in der Woche in der Frühmesse der St.-Josephs-Kirche, die um sechs Uhr begann und abwechselnd von meinem Kaplan und dem mürrischen Pfarrer vor etwa einem Dutzend alter Damen abgehalten wurde. Manchmal frühstückte ich anschließend in der kleinen Wohnung des Kaplans, wo es Nesquik und viele glänzende West-Platten gab, und manchmal lernte ich danach in der Schule, daß derjenige, der nicht für die Sache sei, automatisch ihr Gegner wäre. Als Jungpionier verpflichtete ich mich zu einem monatlichen Solidaritätsbeitrag von einer Mark, in der Sonntagsmesse legte ich einen Groschen in den Kollektekorb. Ich wurde der Trommelreporter meiner Pioniergruppe und betete nach der Beichte im Auftrage meines Kaplans vier Vaterunser, damit meine Eltern, die sonntags gerne länger schliefen, öfter zum Gottesdienst erschienen, was übrigens nichts half. Ich empfing die Erstkommunion und die Jugendweihe. Mein Großvater erschien nur zur Kommunionsfeier. Aus Prinzip.
Kurz vor der Firmung baten mich zwei Herren ins Zimmer unseres Stellvertretenden Schuldirektors, um mir vorzuschlagen, Offizier der Nationalen Volksarmee zu werden. Die Leistungen dazu hätte ich ja. Mein Großvater, der gerade noch aus prinzipiellen Erwägungen meiner sozialistischen Jugendweihe ferngeblieben war, riet mir zu. Bei den Osangs habe es immer Offiziere gegeben. Der letzte war wohl, wie ich später erfuhr, Generalmajor bei der Wehrmacht gewesen. Seine Witwe lebte in Schwaben, wo sie eine unglaubliche Pension bezog, von der wir aber nichts abbekamen. Mein Vater, der verhindern wollte, daß ich Jungpionier wurde und mich auch sonst sehr kritisch zum Staate DDR erzog, hatte der Witwe in den 50er Jahren mal zehn Mark zurückgegeben, die sie ihm gönnerhaft überlassen wollte, damit er sich auch mal einen schönen Abend machen könne. Aus Stolz, wie er sagte. Seitdem gab es keinen Kontakt mehr.
Ich war trotz der ziemlich praktischen Plateausohlen der Kleinste in der Klasse, haßte Geräteturnen und alles, zu dem man in einer Reihe antreten mußte. Außerdem hatte mir mein älterer Cousin erzählt, daß bei Manövern der Nationalen Volksarmee gelegentlich Soldaten unter die Panzer geraten und überrollt würden. Das passiere gar nicht so selten. Gefühlsmäßig fürchtete ich mich vor Kasernen, Uniformen, Gemeinschaftsduschräumen und Maschinenpistolen, aber im Literaturunterricht argumentierte ich zu der Fabel von Fuchs und Igel wie ein Politoffizier der NVA. »Laß dir erst deine Zähne brechen«, sagte der Igel, »dann werden wir uns weiter sprechen!« Ich verknüpfte das äußerst überzeugend mit der Friedenspolitik der Warschauer-Vertrags-Staaten und kriegte eine Eins. Ich war vierzehn Jahre alt und ziemlich durcheinander.
Ich lernte, hier das zu sagen, dort jenes und einen Kalender zu führen, wie ein Ehebrecher. Und wie bei Ehebrechern geht das gelegentlich in die Hose, wenn man einen Fehler macht.
An einem eiskalten Novembernachmittag besuchte unsere FDJ-Gruppe das Museum für deutsche Geschichte. Es ging um Antifaschismus, wenn ich mich recht erinnere, und als wir rauskamen, war es kalt und dunkel. Ich war ziemlich in Eile, weil ich am Abend die Jugendstunde meiner Gemeinde nicht verpassen wollte. Ich schaffte gerade so die letztmögliche Straßenbahn nach Weißensee und erschien pünktlich auf dem Kirchhof, wo die anderen Schüler zwischen weißen Atemwolken standen und mit unserem Kaplan redeten. Es war ein neuer Kaplan, einer, der nicht mehr an unseren Ohren zog, sondern mit uns diskutierte, leise redete und bald in den gerade entstehenden Neubaubezirk Marzahn ging, wo die Menschen, wie er sagte, dringender seine Fürsorge bedürften. Er war ein sehr toleranter, freundlicher Mensch. Das machte alles nur noch schlimmer.
Ich lief auf die Gruppe zu, und als ich etwa fünf Meter von ihr entfernt war, wußte ich, daß ich einen Fehler gemacht hatte. Ich wußte es, bevor der erste sagte: »Sag mal, was ist denn mit dir los?«. Bevor ihm der Kaplan dafür einen strafenden Blick zuwarf und sagte: »Hallo Alexander. Schön, daß du da bist.« Aber ich bemerkte es erst, als es zu spät war.
Ich hatte noch mein FDJ-Hemd an. Sein blauer Kragen ragte gut sichtbar aus meiner Winterjacke. Es war ein einmaliges, verräterisches Blau. Nirgendwo sonst gab es dieses Blau der Freien Deutschen Jugend. Verwechslungen waren ausgeschlossen. Die bis dahin fürchterlichste Stunde meines Lebens begann. Auch heute noch bekomme ich eine Gänsehaut, wenn ich nur daran denke.
Das lag ganz sicher daran, daß es sehr, sehr unüblich war, so forsch und unverfroren von der einen in die andere Welt zu marschieren. Es lag an der Kraft des Symbols. Ähnlich provokativ wäre es wohl gewesen, in der Parteiversammlung mit dem Rosenkranz zu klimpern. Es lag an meiner Urangst, ertappt zu werden, wobei auch immer. Es lag an meinem Kaplan, der so tat, als sei alles wie immer. Und es lag daran, daß unser Religionszimmer sehr gut geheizt war. Außerordentlich gut.
Eines war klar, ausziehen konnte ich die Jacke nicht. Die Sonne wäre aufgegangen, die helle, optimistische Sonne des Jugendverbandes, die auf meinem Hemdsärmel klebte, die Sonne der Kampfreserve der Partei, die Sonne der Freien Deutsche Jugend mitten im Herzen der St.-Josephs-Gemeinde. Es war fürchterlich. Ich schwitzte wie ein Schwein. Durch einen feuchten Nebel nahm ich den Kaplan und meine Mitschüler wahr. Worüber sie redeten, wußte ich nicht. Der Kragen, der blaue Verräterkragen, der Judas-Kragen, leuchtete. Er brannte auf der Haut, er schnürte mir den Hals zu. Ich flüchtete in Fieberträume. Ich verfluchte meinen Eifer, spielte alles noch mal durch, nur diesmal verpaßte ich die Straßenbahn und schaffte es nicht. Ich bat Gott um Verständnis, bat ihn, die Zeit zurückzudrehen, und bat ihn auch, die Stunde schnell vergehen zu lassen. Er tat mir den Gefallen nicht.
Ich muß unendlich viel Wasser verloren haben. Meine Jacke wurde immer schwerer, der Schweiß rann auf den blauen Kragen, und irgendwann, Monate später, beendete der Kaplan die Stunde. Er hatte mich nicht einmal angesprochen, wofür ich ihm noch heute danke. Wahrscheinlich hätte ich hysterisch geschrien. Zum Schluß schenkte er mir noch ein aufmunterndes Lächeln. Ich schleppte mich aus dem Raum, und draußen in der Kälte sagte mir einer der Jungen: »Von dir hätte ich es am wenigsten erwartet, Alexander.« Der Junge war immer ein Außenseiter gewesen. Ein blasser, pickeliger Büßertyp, der im Haus neben der Kirche wohnte und nie den Religionsunterricht verpaßte. Seine Sachen waren schäbig, er stotterte, roch schlecht und hatte beim Bibelquiz immer versagt. Ich hatte nie mit ihm zu tun gehabt. Niemand hatte mit ihm zu tun. Was hatte er denn von mir erwartet? Daß ich so war wie er? Enthaltsam? Langweilig? Ohne Ehrgeiz? Ich sah ihn einen Augenblick an. Ein weißes, ernstes Kindergesicht. Dann ging ich vom Kirchhof und kam nie wieder.
Ich hatte meine Chance gehabt. Ich dachte nicht über sie nach, ich rannte weg. Ich ging nie wieder zu einer Beichte, aber meine Mutter bezahlte meine Kirchensteuer, und auch vor der Prüfung in dialektischem und historischem Materialismus bat ich um Gottes Hilfe. Und natürlich vor der Russischprüfung.
Ich machte so weiter wie bisher. Und das Leben machte es mir leicht. Ich durfte wegen »der Kirchensachen« nicht auf die Erweiterte Oberschule, aber ich bekam einen Platz in der Berufsausbildung mit Abitur. Eigentlich sollte ich Ingenieur werden, weil aber mein naturwissenschaftliches Talent eher unterentwickelt war, suchte ich mir aus der Studienführer-Broschüre irgendeine Richtung raus, in der es keine Mathematikstunden gab. Journalistik. Gut, warum nicht. Ich gab meine Bewerbung für ein Zeitungsvolontariat zwei Wochen zu spät und ohne Hoffnung ab, wurde aber angenommen. Ich ging nur anderthalb Jahre zur Armee, weil ich dort niemals auch nur einen einzigen Tag länger verbracht hätte. Andererseits hat mich auch nie jemand genötigt, länger zu gehen, während einige meiner Freunde regelrecht erpreßt wurden, für drei Jahre zu unterschreiben. Beim WM-Finale 1982 war ich in unserem Armeefernsehraum der einzige, der für Italien war, und Italien gewann. Niemand gab mir die Schuld. In einem Kurzurlaub zeugte ich in Berlin einen Sohn, als er geboren wurde, und später, als er nachts aufwachte und schrie, trieb ich mich auf Studentenpartys im fernen Leipzig rum. Ich konnte ja ausschlafen.
Einmal, als ich am Eingang unseres Studentenwohnheims Nachtwache halten mußte, organisierte ich auch dort eine Party. Etwa zwanzig junge Menschen drängten sich in der kleinen Wachstube. Wir tranken und tanzten, und irgendwann im Morgengrauen, als ich gerade auf dem Klo war, drückte ein betrunkenes Mädchen auf den Knopf der Alarmanlage in dem kleinen Zimmer, das ich zu bewachen hatte. Drei Heimbewohner wachten auf, einer, er hieß Plothe und war ein eifriger wissenschaftlicher Assistent, schwärzte mich am nächsten Tag in der Sektionsleitung Journalistik an. Dort erfuhr ich von meinem Sektionsdirektor Fuchs, einem kleinen, gelbgesichtigen Mann, der nie lachte, daß mein Versagen nicht einfach nur ein disziplinarisches Versagen sei. »Sie haben politisch versagt. Oder haben Sie den NATO-Doppelbeschluß vergessen? Es herrscht Kriegsangst.« Daran hatte ich wirklich nicht gedacht.
Die Sache, sagte er, würde ein unangenehmes Nachspiel für mich haben. Ein sehr unangenehmes. Auf den Fluren wisperte man von Exmatrikulation, und als ich den FDJ-Sekretär meines Studienjahres fragte, wie schlimm es wirklich stehe, sagte der: »Schlimm. Sag mal, wolltest du nicht eigentlich Kandidat der SED werden?« Wollte ich selbstverständlich nicht. Wollte ich überhaupt nicht. Niemals.
Etwa vier Monate später stand ich in einem großen Hörsaal der Karl-Marx-Universität Leipzig und begründete vor etwa 130 Genossen, warum es mir ein Herzenswunsch sei, Kandidat ihrer Partei zu werden.
In der Nacht zuvor konnte ich kein Auge schließen, ich betete um Verständnis und darum, daß es meine Eltern nie erfahren mögen. Dann argumentierte ich mein Gewissen in die Knie. War ich nicht Fan von Stahl Riesa und der DDR-Nationalmannschaft? Haßte ich nicht alle BRD-Sportler? War nicht derjenige, der nicht für die Sache war, gegen die Sache? Konnte man diese verknöcherte Partei nicht nur aus ihrem Innern aufbrechen? Und wollte ich nicht Journalist werden? Hatte Lenin nicht Parteiorganisation und Parteiliteratur geschrieben? Und hatte Lenin nicht recht?
Mein Gewissen sagte, ich sei ein Arsch, und im übrigen sei es müde und wolle schlafen. Ich ließ es und lernte meinen Begründungstext auswendig.
Es war nicht angenehm dort unten zu stehen, ich fühlte mich schlecht, aber nicht annähernd so schlecht wie damals, als ich im FDJ-Hemd unterm Kruzifix gesessen hatte. Dort oben auf den Bänken des Hörsaales saßen ja meine Freunde, meine Kumpels, Bettgefährtinnen und Kritiker des Systems. Ich war ja zu Hause. Wir würden alles anders machen.
Anschließend gab ich einen aus.
Ich hatte nie wieder Schlafstörungen. Ich machte mein Diplom in Stilistik, ich erfand eine Darstellungsart, die es bis dahin nicht gegeben hatte. Das Pointieren. Ich galt als ein bißchen schräg und ein bißchen unangepaßt, weil ich längere Haare hatte und auf unserem Abschlußball einen dogmatischen Dozenten parodierte. Ich hatte eine Freundin, deren Stiefvater Journalist in West-Berlin war und gelegentlich einen Spiegel mitbrachte. Das war Journalismus, fand ich, aber ich lebte nun mal in der DDR. Vielleicht später. Ich bestand den Sportreportertest beim DDR-Fernsehen, aber die Absolventenlenkungskommission schickte mich für drei Jahre in die Wirtschaftsabteilung der Berliner Zeitung. Planberichterstattung. Dort würde ich überwintern, dann würde ich Sportreporter werden. Wenig Politik und viel Reisen.
Ich war Wirtschaftsredakteur. Ich berichtete den Lesern, wieviel Preßlufthämmer der VEB Niles Druckluftwerkzeuge über den Plan produzierte, wie es um den Drei-Temperaturzonen-Kühlschrank des VEB Kühlautomat stand, der nie fertig wurde, und erklärte ihnen, was ein Abrichter für Zahnflankenschleifmaschinen ist, obwohl ich es selbst nicht wußte. Ich interviewte Jugendforscher, ökonomische Direktoren, FDJ-Sekretäre und hoffte, daß es niemand las. Ich log nicht mal, ich ließ weg, färbte schön und überließ anschließend meine Manuskripte den Stiften meiner Vorgesetzten.
Immer mehr wurde meine Redaktion eine Welt, die ihre eigenen Werte hatte. Eine kleine künstliche Welt, die nichts mit der richtigen dort draußen vor den Zeitungsfenstern zu tun hatte. Hier drin gab es Lob und Kritik an einer Arbeit, die sich längst völlig von ihrer Aufgabe verabschiedet hatte, den Lesern die Welt zu erklären. Ihnen zu berichten, was draußen vorging. Sie erfüllte eher eine gegensätzliche Funktion. Und dennoch freute mich das Lob dieser Welt, und ihre Kritik ärgerte mich.
Die richtige, rauhe Wirklichkeit filterte ich durch mein kleines, ängstliches Parteijournalistenherz. Ich sah sie, roch sie, fühlte sie, aber ich ließ sie nicht in meine Texte. Nicht in meine Notizbücher. Und manchmal ließ ich sie nicht einmal in mein Hirn.
Bei den Recherchen für eine Reportage über das Bauwesen in Leipzig brach der SED-Bau-Sekretär weinend an seinem Schreibtisch zusammen, weil irgendwelche Parteibürokraten aus Berlin kurzerhand 50 Denkmäler von der Denkmalsliste gestrichen hatten, damit Leipzig sein Wohnungsbauprogramm erfülle. Ein heulender Parteifunktionär. Ein gutes Bild. Der mutige Chefarchitekt der Stadt führte mich in die schlimmsten, verkommensten Gegenden. Er zeigte mir Geisterviertel, die nur noch von Ratten bewohnt wurden, verfallenene, schimmlige Messehöfe, die einmal wunderschön waren, Häuser, die nur bis zum Erdgeschoß rekonstruiert worden waren, damit der Generalsekretär aus seinem Autofenster einen guten Eindruck gewänne, und er nannte das Politbüro einen »Haufen alter Knallköppe«. Ich fragte ihn, ob er mir nicht auch mal was Schönes zeigen könne. Wegen der Ausgewogenheit. Und er zeigte es mir, obwohl es schwer zu finden war. Weil er ja wußte, wie das Spiel lief.
In meinem Artikel war das kaputte, marode Leipzig kaum noch wiederzuerkennen. Ein stellvertretender Chefredakteur verwandelte seine Rudimente dann restlos in eine blühende Stadt. Einem wütend protestierenden Kollegen, dem er mal einen Artikel über die Rekonstruktion des Schienennetzes der Reichsbahn umgeschrieben hatte, sagte dieser Mann einmal: »Für seine Partei muß man sich auch mal lächerlich machen können.«
Ich beschwerte mich nicht, er entschuldigte sich nicht. Er ließ mitteilen, ihm sei ein bißchen viel »Abriß« im Text gewesen.
In Leipzig ging es also vorwärts mit dem Bauen. Mein Artikel wurde in der Redaktionskonferenz gelobt. Das dämpfte meinen Ärger. Wenn ich überhaupt noch Ärger empfunden hatte.
Ich betrachtete die drei Jahre Absolventenzeit wie einen Wehrdienst. Ich zählte die Tage, bis ich endlich Sportreporter sein würde. Sicher müßte ich dort weitere fünf Jahre Bewährungszeit durchstehen, um richtig arbeiten zu können. Aber die Uhren gingen langsam damals. Was waren fünf Jahre? Und irgendwann hätte ich es dann geschafft. Wenig Politik, viel Reisen.
Wer war ich?
Ein Mensch, der Journalist geworden war, weil er sich im Mathematikunterricht langweilte. Mit 27 Jahren arbeitete er auf die Rente beim Sportfernsehen hin. Sein einziger politischer Widerstand hatte darin bestanden, daß ein besoffenes Mädchen eine Alarmanlage auslöste, als er gerade auf dem Klo war. Das war ich? Offensichtlich.
Als anderthalb Jahre Zeitungsdienst rum waren, die Hälfte sozusagen, klingelte das Telefon auf meinem Redaktionsschreibtisch.
Es war Frühling 1989, und Jörg war am Apparat …
Ich erzählte meiner Freundin, daß die Sache mit der Kriminalpolizei ein Irrtum gewesen war. Sie stellte keine Nachfragen. Ich hoffte, daß Jörg nicht mehr anrufen würde. Zwei Tage später kam in unserer Redaktion die offizielle Information an, daß ich zu den Weltfestspielen nach Korea fahren könnte. Vielleicht war jetzt alles vorbei. Jörg meldete sich nicht. Langsam begann ich ihn zu vergessen. Vielleicht hatten sie ja das Interesse an mir verloren. Alte Disziplinschwierigkeiten in der Kaderakte gefunden oder so was. Alexander Osang: Unzuverlässig. Nicht zu gebrauchen. Untauglich.
Zehn Tage später meldete er sich. Er rief in der Redaktion an. Ich tat so, als würde ich nichts verstehen. »Bitte? … Wer ist da? … Tut mir leid, ich verstehe überhaupt nichts …«, sagte ich und riet ihm, bevor ich auflegte: »Versuchen Sie es doch noch mal.« Nichts wünschte ich weniger als das. Ich saß an meinem Schreibtisch und starrte das Telefon an. Ich schwitzte, mir war übel. Ich wartete. Aber das Telefon rührte sich nicht. Jörg hatte aufgegeben, vielleicht hatte er keine Zwanziger mehr, oder er hatte mich durchschaut. Ich starrte auf das Telefon.
Ich hatte getan, was ich immer tat. So getan, als sei gar nichts passiert. Und ich hoffte, was ich immer hoffte. Daß alles gut wird.
Und?
Was und?
Keine Angst, was?
Hör auf, mir ist schlecht. Außerdem bin ich ihn erst mal los.
Und was machst du beim nächsten Mal?