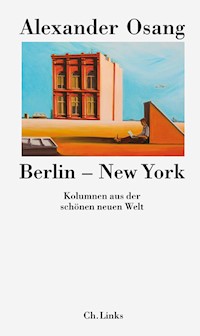9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alles ist genauso passiert, soweit ich mich erinnere … Ihre Wege kreuzen sich schon, laufen nebeneinander, lange, bevor Alexander Osang beschließt, Uwes Geschichte aufzuschreiben. Und mit ihm aufbricht auf einem Schiff in die Vergangenheit. Die weißen Nächte über der Ostsee - sie sind fast hell, verheißungsvoll und trügerisch, so wie die Nachwendejahre, die beide geprägt haben. Doch während Uwe der Unbestimmte, Flirrende bleibt, während sich seine Geschichte im vagen Licht der Sommernächte auflöst, beginnt für Alexander Osang eine Reise zu sich selbst, getrieben von der Frage, wie er zu dem wurde, der er ist. Eindringlich und mit staunendem Blick erzählt er von den Zeiten des Umbruchs und davon, wie sich das Leben in der Erinnerung zu einer Erzählung verdichtet, bei der die Wahrheit vielleicht die geringste Rolle spielt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Alles ist genauso passiert, soweit ich mich erinnere …
Ihre Wege kreuzen sich schon, laufen nebeneinander, lange, bevor Alexander Osang beschließt, Uwes Geschichte aufzuschreiben. Und mit ihm aufbricht auf einem Schiff in die Vergangenheit. Die weißen Nächte über der Ostsee – sie sind fast hell, verheißungsvoll und trügerisch, so wie die Nachwendejahre, die beide geprägt haben. Doch während Uwe der Unbestimmte, Flirrende bleibt, während sich seine Geschichte im vagen Licht der Sommernächte auflöst, beginnt für Alexander Osang eine Reise zu sich selbst, getrieben von der Frage, wie er zu dem wurde, der er ist.
Eindringlich und mit staunendem Blick erzählt er von den Zeiten des Umbruchs und davon, wie sich das Leben in der Erinnerung zu einer Erzählung verdichtet, bei der die Wahrheit vielleicht die geringste Rolle spielt.
Über Alexander Osang
Alexander Osang, geboren 1962 in Berlin, studierte in Leipzig und arbeitete nach der Wende als Chefreporter der Berliner Zeitung. Für seine Reportagen erhielt er mehrfach den Egon-Erwin-Kisch-Preis und den Theodor-Wolff-Preis. Seit 1999 berichtet er als Reporter für den SPIEGEL, acht Jahre lang aus New York, und bis 2020 aus Tel Aviv. Für seine Reportagen erhielt er mehrfach den Egon-Erwin-Kisch-Preis und den Theodor-Wolff-Preis. Er lebt heute mit seiner Familie in Berlin. Zuletzt erschien von ihm der Roman »Die Leben der Elena Silber«, der für den Deutschen Buchpreis nominiert war.
Im Aufbau Taschenbuch ist sein Erzählungsband »Winterschwimmer« lieferbar.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Alexander Osang
Fast hell
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Buch lesen
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Epilog
Impressum
Niemand kann schnell genug schreiben, um eine wirklich wahre Geschichte zu erzählen.
Rian Malan, »The Lion Sleeps Tonight«
Ich kannte Uwe aus New York, obwohl er eigentlich aus Ostberlin kam wie ich. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich ihn zum ersten Mal sah, wahrscheinlich Anfang der Zweitausender auf einer Party bei Solveigh, die aus der Nähe von Dresden stammte, aber seit über dreißig Jahren in Brooklyn lebte. Ich hatte eine kleine ostdeutsche Gemeinde in New York. Meine Frau natürlich, die in Berlin-Lichtenberg groß wurde, Solveigh, die kurz vor dem Mauerfall einen New Yorker Juden heiratete, der seine Sommerferien im Sozialismus verbracht hatte, Sabine, die aus einem Dorf bei Erfurt kam und Ende der Achtziger ausgereist war, ihren Freund Bert, der nach einem Fluchtversuch aus Ostberliner Haft freigekauft worden war, Kathleen aus Gera, die ein Jahr in unserem verrumpelten Büro arbeitete, obwohl sie aussah wie ein Filmstar, ein junges Thüringer Ärztepaar, das irgendwann nach New Mexico weiterzog, später dann auch Else, die eigentlich Sabine hieß, aus Eilenburg kam und einem Mönch in einen Tempel nach Manhattan gefolgt war. Uwe gehörte dazu. Keine Ahnung, wovor der weggelaufen, wem der gefolgt war. Er trat mir aus dem Gewirr der Riesenstadt entgegen. Er war schwul, glatzköpfig und besaß ein Haus in Spanish Harlem, das er in einer Art Stadtlotterie gewonnen hatte. Die Sommer verbrachte er auf Fire Island, wo auch wir ein Ferienhaus gemietet hatten. Er bewohnte mit zwei pensionierten Tänzern des Bolschoi-Balletts einen Bungalow in Cherry Grove, dem gay village der Insel. Unser Haus stand in Oakleyville, wo niemand war, außer uns, einem verschrobenen Verwalter namens Sam, der einst Affären mit Yoko Ono und Greta Garbo gehabt haben soll, sowie einem einheimischen Messie namens Chuck, der den Klimawandel anzweifelte, obwohl seine Insel langsam aber sicher im Atlantischen Ozean versank. Einmal im Sommer liefen wir durch die Hitze am Strand entlang und besuchten Uwe in Cherry Grove, wo er auf einer Terrasse im Schatten saß und schon auf uns zu warten schien. Wenn ich dort ankam, fühlte ich mich, als sei ich nur kurz weg gewesen. Uwe gehörte zu den Menschen, in deren Gegenwart ich sofort anfing zu berlinern.
Ich habe nie einen Mann an Uwes Seite gesehen. Ich kannte nur Geschichten von seinen Partnern. Sie klangen meist tragisch. Er erzählte sie mit gespitzten Lippen und kraus gezogener Nase. Aber vielleicht bilde ich mir das ein. Es hätte auch Solveigh sein können, die mir aus Uwes unglücklichem Liebesleben berichtete. In ihrem sächsisch-amerikanischen Singsang, mit der rechten Hand unentwegt ihre Frisur ordnend.
Einmal hatte Uwe eine Affäre mit einem deutschen Familienvater, den er als Darsteller in einem Netflix-Film entdeckte. Eine schwule Liebesgeschichte. Wie er den nackten Mann aus dem Film gefunden hat, ist mir ein Rätsel. Der Mann jedenfalls kam ab und zu nach Amerika, die Flugtickets bezahlte Uwe. Und jetzt, da ich das erzähle, fällt mir ein, dass ich zumindest diesen Liebhaber einmal gesehen habe. Auf einer Geburtstagsfeier, einem Brunch, zu dem Uwe uns in ein Restaurant am Hudson eingeladen hatte. Der Mann sah gut aus, erschien mir aber nicht besonders vertrauenswürdig. Er kam aus dem Ruhrgebiet, war mit einer Frau verheiratet und hatte einen Sohn. Er wollte ins Schauspielgeschäft, ins richtige Schauspielgeschäft, sagte er, er wirkte wie ein Mann, der Kontakte suchte, die ihn weiterbringen konnten. Ich hatte den Eindruck, dass Uwe weder diesen Geliebten noch die anderen Geburtstagsgäste richtig kannte. Er war herzlich und gleichzeitig distanziert zu allen. Ein Gast auf seiner eigenen Party.
Ich jedenfalls wusste damals kaum etwas von Uwe. Er kam aus Biesdorf, wo seine Mutter immer noch lebte. Er nannte sie »Muttern«. Muttern schickte ihm ab und zu Zeitungsausschnitte aus der Berliner Zeitung. Was er über mich wusste, wusste er aus diesen Artikeln, denn ich schrieb dort oft über mich oder zumindest über die Kunstfigur, die ich in meinen Kolumnen von mir angefertigt hatte, ein heimatloser Weltreisender, der über seine Möglichkeiten staunt.
Uwe hatte eine Bosch-Waschmaschine, die ihm wichtig war. Er wusch mit Persil. Es ging ihm um einen Duft von zu Hause, und das verstand ich. Gerüche werden wichtiger, wenn man älter wird. Sie ersetzen irgendwann unsere Erinnerungen.
Ich war nur einmal bei Uwe in Harlem. Ich erinnere mich an ein riesiges Haus, das er zu großen Teilen vermietet hatte, und an zwei sehr dicke Katzen. Vielleicht waren es auch drei, aber dick waren sie in jedem Fall. Wir saßen in einem kleinen, gut beleuchteten Raum mit niedriger Decke. Alles wirkte sehr sauber. Wir aßen Schnittchen, die uns Uwes Mutter geschmiert hatte, die gerade zu Besuch war. In meiner Erinnerung waren die Stullen geviertelt und mit Wurst belegt, auf dem Tisch lag eine karierte Wachstuchdecke, und das Licht kam aus Neonröhren. Aber das muss nicht stimmen. Es ist fünfzehn Jahre her. Vielleicht war seine Mutter gar nicht da. Die Tischdecke und die Neonröhren hätten auch aus einem Film über den Osten stammen können. Was ich genau weiß, ist, dass mir Uwe an diesem Nachmittag die Waschmaschine zeigte, von der er oft gesprochen hatte. Die Bosch. Auf einem Bord stand das deutsche Waschmittel. Großpackung. Alles war ganz sauber und roch nach Persil. Es hätte natürlich auch Ariel sein können oder Weißer Riese, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Persil war.
Seltsam ist nur, dass Persil gar nicht der Duft unserer Kindheit im Osten war. Persil war ein Duft des Westens.
Es roch im Intershop nach Persil. Intershops hießen die Geschäfte, in denen man im Osten Westprodukte kaufen konnte, wenn man Westgeld besaß. Die Westpakete rochen so, vor allem wenn sie mit gebrauchten Kleidern gefüllt waren. Zu Weihnachten roch das ganze Postamt so. Kaffee, Waschmittel, Schokolade. Es war der Duft einer imaginären Welt. Süß und sauber. Meine Westwelt roch anders, glaube ich. Sie muss nach Kaugummis, dem Papier von Westzeitungen, meiner neuen Levi’s-Jacke gerochen haben, die ich im Intershop an der Friedrichstraße kaufte. Sie roch wie mein orangefarbener Römer-Integralhelm von innen roch, als ich ihn das erste Mal aufsetzte. Die Westwelt, die ich mir vorstellte, war bevölkert von Figuren aus den Songs von Bruce Springsteen und Paul Simon, illustriert mit Bildern aus Filmen von Martin Scorsese, Woody Allen, Sergio Leone und Sidney Lumet. In dieser Welt lebten Huck Finn, Philipp Marlowe, Captain Yossarian und Holden Caulfield. Ich kannte ein Mädchen, das sich im Lesesaal der Berliner Stadtbibliothek den nicht ausleihbaren Roman »Der Fänger im Roggen« in ein Notizheft abschrieb, um ihn immer bei sich zu haben. Ich starrte in meinem Kinderzimmer stundenlang auf das Cover der Amiga-Platte von »Double Fantasy« und stellte mir vor, mit Yoko und John in der Upper West Side herumzustehen und auf den Central Park zu gucken, in unserem Rücken ein New Yorker Mülleimer.
Ich war enttäuscht, als ich im November 89 zum ersten Mal hinter die Mauer schauen konnte, und brauchte ein Jahr, bis ich fand, was ich dort vermutet hatte. New York. Die einzige Stadt, die mit meinen Erwartungen mithalten konnte. Es war August 1990, als ich dort endlich ankam, und es war heiß. Ich blieb drei Tage, in denen ich nicht schlief. Ich habe das oft erzählt, obwohl ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass es stimmt. Drei Tage und drei Nächte ohne Schlaf, das hält kein Mensch aus. In meinen Erinnerungen aber existiert kein Bild davon, wie ich die Nachttischlampe in meinem handtuchgroßen Hotelzimmer ausschalte. Woran ich mich genau erinnere, ist die Erregung, die ich verspürte, als ich im August 1990 in Manhattan aus dem Kleinbus stieg, der uns vom Flughafen in die Stadt brachte. Ich wusste augenblicklich: Ich bin da. Es gab den Ort meiner Sehnsucht wirklich. Es gab die Sirenen, das Licht, die Energie. Ich schlüpfte in die Stadt wie in einen Film. Zehn Jahre später zog ich dann mit meiner Familie an diesen Sehnsuchtsort. Wir blieben acht Jahre lang. Ich war glücklich dort, aber irgendwann verstand ich, dass es nur ein Fluchtort war. In New York konnte ich am besten vergessen, dass ich eigentlich kein Zuhause hatte. Als das klar war, ging ich nach Berlin zurück.
Uwe blieb in New York. Im Traum. In der Vorstellung von einer Welt unbegrenzter Möglichkeiten. Er sagt gern, New York sei der einzige Platz auf der Welt, wo er er selbst sein konnte. Wer immer dieser Mensch ist.
Es half natürlich, dass er dort ein großes Haus besaß.
Das nächste Mal traf ich Uwe auf einer Silvesterfeier in Berlin Prenzlauer Berg, einige Jahre nachdem wir New York verlassen hatten. Bestimmt sahen wir uns auch zwischendurch, aber daran erinnere ich mich nicht. Uwe hatte um die Weihnachtszeit seine Mutter in Biesdorf besucht, und wir nahmen ihn mit zu einer Silvesterparty bei unseren Freunden Magda und Milan in die Senefelderstraße. Es war der Jahreswechsel von 2017 auf 2018, wir saßen in der Küche, und Uwe redete polnisch mit Magda, die aus Polen stammt. Keine Ahnung, wie gut sein Polnisch war, es klang flüssig. Er wirkte natürlich, selbstverständlich, obwohl er zum allerersten Mal in dieser Küche saß. Auch unsere Freundin Katja war da, die wie Uwe eine Zeitlang in Moskau gelebt hatte. Er traf sie in dieser Nacht zum ersten Mal, schien sie aber besser zu kennen als ich. Ich fand sein Verhalten zunächst distanzlos und befremdlich. Dann aber, vielleicht aber auch erst jetzt, da ich mich daran erinnere, angenehm offen. Normalerweise stehen Deutsche ja erstmal in der Ecke rum, wenn sie irgendwo neu sind. Uwe redete von einer Filmklasse, die er an der New York University unterrichtete. Er kannte sich sehr gut mit deutschen Filmklassikern aus. Auch das hatte ich bis dahin nicht gewusst. Milan ist Schauspieler. Für einen Augenblick dachte ich, Uwe hatte sich auf den Abend vorbereitet.
Anfang 2019 kam Uwe nach Tel Aviv, wo ich inzwischen lebte. Er hatte Freunde dort, sagte er. Er hat überall auf der Welt Freunde oder Leute, die er Freunde nennt. Er war in den neunziger Jahren oft in Tel Aviv, sagte er am Telefon. Er liebe es. Die Schönheit der Menschen, die Energie, das Meer. Ich verstand das. Ich lebte aus ähnlichen Gründen in Israel. Es war direkt, rau, unfertig und voller Energie, es erinnerte mich an New York, aber das Wetter war besser, und man brauchte nur vier Flugstunden nach Berlin. Dazu kam, dass die Stadt mich etwas anging, sie hatte mit mir zu tun, sie hatte Relevanz. Jedenfalls redete ich mir das ein.
Uwe war über Weihnachten wie immer bei Muttern in Biesdorf gewesen und wollte noch ein paar Tage in die Sonne. Am Telefon begrüßte er mich mit »Schalom, Schalom«.
Ich holte ihn mit dem Auto im Norden von Tel Aviv ab. Seine Freundin wohnte in einer kleinen Erdgeschosswohnung, die so hell ausgeleuchtet war wie ein Drehort. Die Frau sah müde aus, wirkte aber munter. Sie hieß Josephine. Wir standen höchstens zehn Minuten in ihrem Wohnzimmer, sie redete, und ich hatte das Gefühl, dass Josephine Uwe nicht viel besser kannte als mich. Auf einem Tischchen lagen Kinderschokoladen-Riegel herum, die, so nahm ich an, Uwe mitgebracht hatte. Uwe erzählte mir später Tel Aviver Geschichten aus den Neunzigern, als er oft hier war. Die Geschichten klangen aufregend, viel aufregender als das, was ich bislang in der Stadt erlebt hatte, und die erschöpfte Freundin war in ihnen frisch, verrückt und abenteuerlustig. Er erzählte von einer gemeinsamen Reise nach Ägypten, Mitte der Neunziger, wo er sich mit Hepatitis angesteckt hatte. Wir fuhren über den Ayalon Highway Richtung Süden. Uwe bestaunte die leuchtenden Türme von Downtown Tel Aviv, die in seiner Abwesenheit in den Himmel gewachsen waren. Er schien so stolz, als habe er sie selbst mit aufgebaut. Ich kenne einige Ostdeutsche, die Israel lieben und verehren wie ihre eigentliche Heimat.
Ich empfahl ihm »Eine Geschichte von Liebe und Finsternis«, Amoz Oz’ Lebensroman, der mir Israel erklärt hatte wie kein anderes Buch, aber Uwe schien nicht richtig zuzuhören.
Unser Haus in Jaffa sah er nur flüchtig an. Auch unsere neue Katze interessierte ihn nicht. Er hatte eine königliche Art, bestimmten Dingen Aufmerksamkeit zu schenken und sie anderen Dingen zu entziehen, willkürlich, als verändere er damit die Welt. Es erinnerte mich an die schönen, zickigen Mädchen aus meinem Leben, obwohl Uwe glatzköpfig, rund und etwa so alt war wie ich. Wir gingen auf den Shuk, um etwas zu essen. Es war schon dunkel, aber noch zu früh zum Abendessen. So um sechs. Wir saßen ganz allein in einem Restaurant und warteten darauf, dass die Küche öffnete. Uwe überbrückte die Zeit mit einem Gin Tonic und einem zweiten. Dazu rauchte er seine elektrische Zigarette. Es war kühl, es war Mitte Januar. Wir redeten ein bisschen über New York, gemeinsame Bekannte, unsere Familien, die Zeiten. Irgendwann redete nur noch Uwe. Er hatte einfach die besseren Geschichten. Sie spielten in Ludwigsfelde, Peking, Hongkong, Moskau, New York, Westberlin, Buenos Aires, Paris, Bulgarien, Sibirien, Lappland und in einem Garten in Biesdorf, in Rotlichtvierteln, Hochsicherheitsgefängnissen, auf Teeauktionen, in Schwulenbars und im Kofferraum eines argentinischen Diplomaten in Ostberlin. Ein-, zweimal hätte ich gern einen Notizblock gehabt, um etwas mitzuschreiben, aber die meiste Zeit genoss ich es einfach, so gut unterhalten zu werden. Wir saßen auf diesem dunklen orientalischen Markt in Jaffa, Uwes Geschichten krochen aus dem Nebel seiner E-Zigaretten wie die Märchen aus Tausendundeiner Nacht.
Nach dem Essen fuhr ich ihn zu seiner Freundin nach Ramat Gan zurück. Ich sah ihn aus dem Auto in dem schmucklosen Mietshaus der Frau verschwinden wie einen Geist. Innerhalb weniger Stunden war aus dem fremden Freund eine schillernde und vertraute Figur geworden. Ein Romanheld, der durch die Zeit und die Welt reiste. Er hatte sich ausgemalt, geschminkt.
Noch in der Nacht schrieb er mir eine Mail, in der er eine tragische Geschichte andeutete, die Josephines Leben vor ein paar Jahren aus dem Takt gebracht haben musste. Außerdem schickte er mir das Foto der englischen Ausgabe von Oz’ Roman, den er wahrscheinlich im Bücherregal seiner Gastgeberin entdeckt hatte. A Tale of Love and Darkness.
Mir fiel ein, wie Uwe vor ein paar Jahren in einem Cafe in Brooklyn dem Barista bei der Bestellung gesagt hatte, er heiße Peter. Als ich ihn fragte, warum, hatte er gesagt, dass niemand in Amerika den Namen Uwe buchstabieren oder aussprechen konnte. Außerdem sei Peter der Name seines Vaters. Als Peter aufgerufen wurde, um seinen Kaffee abzuholen, zögerte Uwe keine Sekunde.
Im Mai 2019 bat mich DER SPIEGEL, das Magazin, für das ich arbeite, einen Text für ein Sonderheft über die rätselhaften Ostdeutschen zu schreiben. Es sollte im Herbst erscheinen, wenn der 30.Jahrestag des Mauerfalls begangen werden würde. Der Redakteur wollte eigentlich ein Porträt über Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, aber ich dachte gleich an Uwe. Seine Geschichte schien aus dem Stoff zu sein, aus dem die letzten dreißig Jahre unseres Lebens bestanden. Der Irrsinn war da, der Schmerz, die Sehnsucht, das Glück, die Enttäuschung, die Fremde, die ewige Suche nach dem Paradies hinter der Mauer. Die Rätsel, die sie so gern erklärt haben wollten. Uwe schien ein ostdeutscher Weltbürger zu sein. Ein Oxymoron. Ein Mann, dessen Erinnerungen an seine Heimat kaum getrübt worden waren durch die Gegenwart. Ich könnte mir noch einmal neu erzählen lassen, was passiert war, mich überraschen lassen.
Ich schrieb Uwe eine Mail aus Tel Aviv nach New York. Ich fragte, ob er bereit sei, sein Leben einer größeren Öffentlichkeit zu erzählen. Er erbat sich einen Tag Bedenkzeit. Dann sagte er zu. Wir verabredeten uns für den Sommer. Ich habe mich später gefragt, worüber er an diesem einen Tag Bedenkzeit eigentlich nachgedacht hatte. Ob er am Schluss seiner Überlegungen wusste, wie diese Geschichte enden würde. Und wenn ja: Ob er deswegen mitmachte oder trotzdem.
Eins
Die Fähre, die uns von Helsinki nach St. Petersburg bringt, heißt Princess Anastasia. Sie ist ein hochhausgroßer Kasten, orange und blau angemalt, mit einem kleinen Eingang, durch den wir uns alle an Bord zwängen. Uwe und seine Mutter teilen sich eine fensterlose Kabine im Innern des Schiffes, ich habe eine mit Blick aufs Wasser. Ich schließe die Tür und lege mich auf mein Bett. Ich bin in der Nacht von Tel Aviv nach Helsinki geflogen und hundemüde.
Wir haben uns in Finnland verabredet, um von dort gemeinsam nach Russland zu fahren. Uwe hat die Reise seiner Mutter zum achtzigsten Geburtstag geschenkt. Sie wollte gern nach Russland, auch wenn ich nie richtig verstehen werde, warum eigentlich. Uwe wäre lieber nach Lappland gereist. Er wollte seinen amerikanischen Pass nicht wochenlang im russischen Konsulat von New York abgeben, um ein Visum zu bekommen. Er hatte, jedenfalls sagte er mir das am Telefon, Angst, ihn nicht zurückzukriegen. Er fand eine Agentur, die visumfreie Reisen nach St. Petersburg anbot. Das Reisebüro heißt GO RUSSIA, hat eine Adresse in London und eine Frankfurter Telefonnummer. Da rief ich an. Die Frau, die sich meldete, nannte sich Alissa und sprach Deutsch mit russischem Akzent. Das war alles verwirrend, klang aber wie ein guter Anfang für meine Reportage. Ich buchte Alissas Reisepaket. Zwei Nächte auf der Fähre, drei Tage in St. Petersburg. Das sollte genügen, um Uwes Lebensgeschichte aufzuschreiben, dachte ich. Ich las »Weiße Nächte« von Dostojewski, um in Stimmung zu kommen. Es ist eine verstörende Liebesgeschichte aus vier Sommernächten in St. Petersburg.
Jetzt, da ich auf dem schmalen Kajütenbett der Anastasia liege, die im Fährhafen von Helsinki schaukelt, scheint mir das alles eine Schnapsidee zu sein. Dostojewski, um Himmels willen.
Ich fühle mich am Beginn von Recherchen oft kraftlos und überfordert. Ich verstehe dann, wie vermessen mein Plan ist, und kann mir nicht vorstellen, an die Tür zu klopfen, hinter der der Mensch wohnt, den ich beschreiben möchte. Aber ich mache es lange genug, um zu wissen, dass das vorbeigeht. Sobald sich die Tür öffnet, schlüpfe ich in die Geschichte. Die Leben der anderen helfen mir, mein eigenes zu verstehen. Wenn sie überleben, kann ich es auch.
Als die Fähre den Hafen von Helsinki verlässt, stehe ich auf und steige mit Uwe und seiner Mutter nach oben, an Deck. Nach den blassen, verwaschenen Farben des israelischen Sommers, aus dem ich komme, wirken die Kontraste im finnischen Himmel dramatisch. Die Wolken sind sehr weiß und der Himmel ist sehr blau. Es weht ein kräftiger, kühler Sommerwind, als die Fähre langsam aus der Stadt treibt. Es ist Anfang Juli, aber ich fühle mich, als sei ich überraschend in den Herbst geraten. Möwen umflattern die Passagiere an Deck. Uwe und seine Mutter stehen an der Reling, beide tragen die zweckmäßige Reisekleidung, an der man Deutsche im Ausland oft erkennt. Aus der Entfernung könnten sie auch ein Paar sein. Uwe raucht seine E-Zigarette. Die Mutter steht aufrecht, sie trägt einen dieser winzigen Rucksäcke, die bei älteren Frauen beliebt sind, und ein Lächeln, das nie verschwindet. Erst nach einer Weile verstehe ich, dass das gar kein Lächeln ist.
Ich friere bald in meiner israelischen Sommerkleidung, und so kehren wir in den Bauch des Schiffes zurück. Dort drinnen sieht es aus wie in einem in die Jahre gekommenen Spielsalon. Es gibt viel Glas und Chrom, das Personal trägt Uniform, wirkt aber keineswegs vertrauenswürdig. Die meisten sehen aus wie verkleidete Kleinkriminelle. Wir haben Schwierigkeiten, einen Tisch in einem der Restaurants zu finden, weil die Fähre so voll ist.
Uwe verhandelt mit einem der Kellner, der eine zu enge Weste über einem zu engen Hemd trägt sowie einen blonden Schnurrbart. Der Mann hält uns für Russen. Uwes Mutter bemüht sich, diesen Eindruck aufrechtzuerhalten, indem sie durch die Ansprache des Kellners hindurch lächelt. Ich rede ein bisschen, frage, ob das Bier russisch oder finnisch sei und ob sie Pelmeni anböten. Mein Russisch ist armselig, wenn man bedenkt, dass ich es vierzehn Jahre lang an verschiedenen Schulen lernte und eine russische Großmutter habe. Uwe dagegen scheint akzentfrei zu sprechen. Kein Russe glaubt ihm, dass er Deutscher ist.
Er verändert sich, wenn er eine Fremdsprache spricht. Er wird nicht leise, klein und verlegen, wie die meisten Menschen, die ich kenne. Er stürzt sich in eine Rolle. Er spielt einen Russen, einen Märchenrussen, weich und flehend, er feilscht, scherzt, schmeichelt und übertreibt, ein Kater eher als ein Mann. Man könnte denken, er wäre gern einer von ihnen, ein schwermütiger, unberechenbarer Seelenmensch, aber das ist, soweit ich das einschätzen kann, nicht der Fall. Er traut Russland nicht, seinen Beamten, Diplomaten, Politikern, seiner Macht. Manchmal redet er verächtlich über das große Land, manchmal mitleidig. Die russischen Passagiere an Bord nennt er Heimwehtouristen, Leute, die sich visumfrei für ein paar Tage in ihre alte Heimat stehlen. All das erzählt er natürlich auf Deutsch.
Am Tisch neben uns sitzen drei polnische Frauen, auch mit denen wechselt Uwe ein paar Worte in ihrer Sprache, und dann kichern die Frauen. Er sagt, seine erste Freundin war Polin, damals in Ostberlin, als noch niemand, nicht mal er selbst, wusste, dass er schwul ist. Ich frage mich, für wen sie uns halten. Zwei mittelalte Männer und eine alte Frau auf einer Schiffspassage nach St. Petersburg. Wir könnten aus einer Erzählung von Patricia Highsmith stammen. Die Frage ist, wer am Ende über Bord geht.
Der Kellner bringt unsere Getränke. Uwe trinkt einen Gin Tonic, seine Mutter Wasser, ich ein russisches Bier, das aussieht wie Eistee.
»Spassibo«, sage ich, aber der Kellner schenkt dem keine Beachtung.
»Andjschella treffen wir vielleicht auf der Rückfahrt in Helsinki«, sagt Uwe. Ich höre den Namen Andjschella zum ersten Mal. Uwe wirft gern mit Namen von Leuten um sich, die man nicht kennen kann. Man fühlt sich ahnungslos, und er genießt das. Die Namen der Unbekannten sind sein Bühnennebel.
»Wer ist Andjschella?«, frage ich.
Uwe zieht die Nase kraus und erzählt eine Geschichte.
Andjschella ist die Tochter des ehemaligen sowjetischen Gebietssekretärs von Murmansk, den Uwes Familie in einem Bulgarienurlaub in den siebziger Jahren kennengelernt hat. Sie blieben in Kontakt und besuchten die sowjetische Familie später auch in Sibirien. Ich verstehe langsam, dass Uwes Familie ein gutes, ostdeutsches Leben geführt hat, vielleicht sogar ein sehr gutes. Meine Familie zum Beispiel machte keine Bulgarienurlaube, schon gar keine, bei denen man Gebietssekretäre der KPdSU kennenlernen konnte. Wir hatten einen Bungalow im Süden von Berlin, den meine Eltern dort Mitte der siebziger Jahre aufgestellt hatten. Reisen nach Murmansk lagen in jenen Jahren außerhalb meiner Vorstellungskraft. Ich habe einmal, viel später, aus einem meiner Bücher, das ins Bulgarische übersetzt worden war, in Sofia gelesen und mehrere Nächte im ehemaligen Gästehaus der kommunistischen Partei in den Bergen über der Hauptstadt verbracht, das zu der Zeit schon schäbig aussah und vergessen, aber das Wort Bulgarienurlaub klingt in meinen Ohren immer noch luxuriös und ausschweifend. Uwe und seiner Mutter geht das ähnlich, glaube ich. Privilegien, die man verloren oder nie genossen hat, wiegen schwerer als die, die man besitzt.
»Der Sekretär war ein stattlicher Mann«, sagt Uwes Mutter. »Er trank viel, sicher, aber das machten sie ja alle. Er hat den Zusammenbruch nicht verkraftet. Er wurde dann schnell krank. Ich glaube Magenkrebs. Er war ein Schatten seiner selbst, als wir ihn das letzte Mal sahen. Ein dünnes Männchen. Er starb auch wenig später.«
Es klingt, als beschreibe sie den Untergang des kommunistischen Riesenreiches am Beispiel einer bulgarischen Urlaubsbekanntschaft. Stattlich. Trunksüchtig. Schwach. Tot.
Andjschella, die Tochter des Gebietssekretärs, ist nach der amerikanischen Kommunistin Angela Davis benannt worden, erfahre ich. Angela Davis war eine große Nummer in unserer sozialistischen Jugend. Eine kalifornische Kommunistin mit Afro. Schlau, schön und auch noch auf unserer Seite. Ein Popstar. Wir sammelten in den siebziger Jahren Altpapier und Flaschen und spendeten die Erlöse auf ein Solidaritätskonto für ihre Befreiung aus dem US-Gefängnis und die amerikanische Revolution, das schien damals dasselbe zu sein. New York würde bald rot sein, dachte ich, als wir Kinder waren. Andjschella aus Murmansk verliebte sich als Mädchen am Schwarzmeerstrand in Uwe aus Ostberlin. Sie glaube ihm bis heute nicht, dass er schwul sei, sagt Uwe. Sie ist über fünfzig, aber immer noch in der Lage, sein Kind zu empfangen, wie sie ihm kürzlich versicherte. Sie lebt in Finnland. Sie wartet da auf ihn.
»Andjschella, die Fruchtbare«, sagt Uwe.
Ich schreibe die drei Wörter in mein Notizbuch, was Uwes Mutter misstrauisch beobachtet. Sie weiß, dass ich als Reporter hier am Tisch sitze und nicht als Reisebekanntschaft. Das heißt nicht, dass sie das billigt. Sie nennt mein Notizbuch: »Das böse Buch«. Sie will das alles nicht. Sie will Kontrolle über die Familiengeschichte, ich verstehe das und werde es später noch besser verstehen.
Wir beginnen die Geschichte von Uwes Flucht um die Welt jedenfalls mit der Fluchtgeschichte seiner Mutter.
Uwes Mutter wurde in Pommern geboren, in der Nähe von Koszlin, etwa fünfzehn Kilometer entfernt von der Ostsee. Ihre Eltern hatten einen kleinen Bauernhof. Der Vater wurde im Januar 1944, vierzehn Tage, bevor die Rote Armee ihren Ort erreichte, in den Volkssturm eingezogen, das letzte Aufgebot der deutschen Weltkrieger. Sie warteten noch zwei Jahre in Polen vergeblich auf die Rückkehr ihres Vaters, sagt Uwes Mutter. Dann, 1947, zogen sie Richtung Westen. Sie, ihre Mutter und zwei Brüder. Sie landeten in Sachsen, in Siebenlehn, einem Ort, der zwischen Leipzig, Dresden und Chemnitz liegt. Fünfhundert Flüchtlinge aus dem Osten strandeten nach dem Krieg in Siebenlehn. Jeder fünfte Einwohner der Kleinstadt war ein Heimatvertriebener, wie sie das nannten. Niemand wollte sie da haben, sagt Uwes Mutter. Sie war acht Jahre alt, als sie in Sachsen ankamen, und wuchs dort auf. Obwohl sie insgesamt länger in Berlin gelebt hat, hat sie einen leicht sächsischen Akzent behalten. Ihre Mutter arbeitete als Köchin in Siebenlehn. Sie warteten weiter auf die Rückkehr des Vaters, aber der kam nicht.
Ihren Mann lernte Uwes Mutter Anfang der 60er Jahre bei einem Tanzvergnügen in Roßwein kennen, das war die nächstgrößere Stadt. Er hieß Peter und hatte ebenfalls eine Fluchtgeschichte zu erzählen, eine ganz andere allerdings. Peter kam aus Berlin, hatte in Wismar studiert und wollte 1963 mit ein paar Kommilitonen im Boot über die Ostsee in den Westen fliehen. Eine Grenzpatrouille hatte die Männer aus dem Wasser gefischt, sie wurden von der Hochschule geworfen. Peters Vater war Schauspieler in Berlin, ein Kommunist, der gute Beziehungen zur Familie Feist hatte, aus der Margot Honecker stammte. Die halfen dabei, den Jungen vor dem Schlimmsten zu bewahren. Peter durfte sein Studium an der Ingenieurschule in Roßwein fortsetzen, die praktisch niemand kannte.
Das klang alles ziemlich exotisch für die junge Bauerntochter aus Pommern. Im Mai 1965 heirateten Uwes Eltern, im November wurde er geboren.
Wir brauchen fast zwei Stunden, bis wir dort angekommen sind.
Uwes Mutter hat sehr detailliert über einen ersten, kurzen Fluchtversuch aus ihrem Geburtsort in Pommern geredet. Das war im Januar 1945. Sie flohen vor Russen, die sie nicht gesehen hatten. Sie flohen vor dem schlechten Ruf der nahenden Roten Armee. Sie flohen vor einem unsichtbarer Feind. Sie kamen nicht weit, ihre Zweifel, so klang es, hielten sie auf. Die Zweifel und die Kälte. Nach anderthalb Tagen drehten sie wieder um, kehrten zurück in ihr Haus. Die Russen waren noch nicht da, aber in ihrer kurzen Abwesenheit hatten die Nachbarn alles ausgeräumt. Das Bild des leeren Hauses, in das sie zurückkehrten, muss sich der Frau tief eingeprägt haben. Die Kälte, die Dunkelheit, die Nachbarn, denen man nicht trauen konnte. Der Boden hatte sich unter ihr geöffnet. Sie war sechs Jahre alt und hatte keine Gewissheiten mehr, denke ich. Aber vielleicht denke ich da auch schon an meine Mutter, mit deren Kindheit ich mich in diesem Sommer ziemlich intensiv beschäftigt habe. Das kann ich alles gar nicht mehr richtig auseinanderhalten. Die alten, heimatlosen Frauen mit den kleinen Rucksäcken.
Meine Mutter hat ihre ersten Lebensjahre in Schlesien verbracht. Auch sie hat so eine Herkunftsgeschichte, aus der sie ihr Schicksal ableitet. Die Erinnerungen eines Mädchens an eine Nacht in Schlesien. Alles andere erklärt sich, zumindest für sie, aus dieser Nacht, die sie mir immer wieder in allen Einzelheiten beschrieben hat. Sie glaubt, auf dem Marktplatz ihrer Geburtsstadt eine Massenerschießung beobachtet zu haben, an die sich niemand erinnern will. Ein achtjähriges Mädchen, dem keiner glaubte. Auch meine Mutter war zwei Jahre nach dem Krieg aus dem Osten, der inzwischen Polen war, nach Deutschland gezogen. Auch sie war ein Flüchtlingskind. Auch ihr Vater war in dieser Zeit unter nie geklärten Umständen verschwunden. Ich glaube, dass viele Probleme und Ängste, die ich habe, mit dieser Nacht zusammenhängen. Natürlich kann meine Mutter mir das auch eingeredet haben, aber am Ende ist es egal.
Uwes Mutter klagt über die polnischen und die sächsischen Nachbarn, die sie nicht haben wollten, und verknüpft das bald mit den Flüchtlingen, die momentan aus dem Orient nach Deutschland kommen und nicht bereit seien, sich in die Gesellschaft einzuordnen. Denen es so leicht gemacht werde, wenn man es mit ihrem Schicksal vergleicht. Uwe schaut durch seine Mutter hindurch. Er raucht und trinkt, und als das Essen kommt, isst er. Er hat Jakobsmuscheln bestellt, das teuerste Essen auf der Speisekarte. Seine Mutter und ich essen das billigste, eine Kürbiscremesuppe, die aussieht wie ockerfarbenes Latex und nach gar nichts schmeckt. Uwe erträgt die Klagen seiner Mutter regungslos. Er lässt sie reden. Er wartet einfach darauf, dass sie müde wird.
Ich schreibe ab und zu in mein Notizbuch, obwohl ich nicht glaube, dass es irgendetwas aus den Kriegstagen und der Nachkriegszeit in meinen Text schaffen wird. Ich will meine Rolle als Reporter etablieren. Das ist unsere Geschichte: ein Mann und seine Mutter auf einer Schiffspassage, begleitet von einem Reporter. Niemand muss sterben, aber ganz ohne Schmerz geht es auch nicht.
Nach dem Essen sehen wir noch einmal raus aufs Meer. Uwe behauptet, am Horizont Estland zu erkennen. Seine Mutter schüttelt den Kopf, und ich glaube in dieser kleinen, aber entschiedenen Bewegung erkennen zu können, dass es Uwe als Kind nicht leicht hatte und heute immer noch nicht leicht hat. Dann geht die Mutter schlafen.