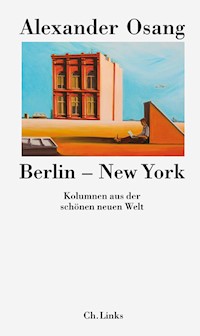4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Literarische Publizistik
- Sprache: Deutsch
"Neunundachtzig. Ich habe immer eine Weile gebraucht, um den Leuten den Titel dieses Buches zu erklären. Die Zahl berührt die beiden wichtigsten journalistischen Ereignisse meines Lebens. Den Untergang der DDR und den Angriff auf New York.
89 ist das Jahr in dem die Mauer fiel und 89 ist die Nummer der Etage des World Trade Centers, deren Schicksal ich beschreibe. Beim ersten war ich noch kein Reporter, beim zweiten wollte ich für einen Moment keiner mehr sein. Einmal schien ich ganz dicht dran zu sein, einmal ganz weit weg. Aber letztlich gab es kaum einen Unterschied. Ich mußte nirgendwo hinfahren, ich war schon da. Beide Male stolperte ich ein paar Augenblicke durch den Sturm, bevor ich mich auf den sicheren Boden des Beobachters rettete.
Ich bin Reporter. Ich mache keine Geschichte, ich hänge mich immer nur ran. Ich lebe von Helden, so kann ich alt werden. Für die Helden aber ist das schwerer. Die Menschen rennen weiter, es gibt soviel zu tun."
Alexander Osang
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Alexander Osang
Neunundachtzig
Helden-Geschichten
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
1. Auflage als E-Book, Mai 2018
entspricht der 2. Druckauflage vom Januar 2003
© Christoph Links Verlag GmbH
Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0
www.christoph-links-verlag.de; [email protected]
Cover: KahaneDesign, Berlin
eISBN 978-3-86284-422-7
Inhalt
Neunundachtzig – Ein Vorwort
Wenn Menschen in die Geschichte geraten
Achtzehn Wagen
Mein Schwager gelangt in den Westen
Zelmanowitz’ Tat
Ein Jude aus Brooklyn taucht in einer Präsidentenrede auf
Nennstiels Haus
Ein Eigenheimbauer büßt für ein Land
Das Baby lebt
Eine Kellnerin versucht, eine Katastrophe festzuhalten
Wer läuft, schwitzt
Ein Grüner wird weltberühmt
Die 100-Milliarden-Dollar-Show
Eine Raucherin aus Florida wird zum Beweis in einem Jahrhundertprozeß
Die Zeugin
Eine Dame hört einen Pistolenschuß auf ihrem Hinterhof
Der Preis eines Wunders
Ein Indianer kommt ins Fernsehen
Die bewegte Frau
Eine Naturwissenschaftlerin zieht es in die Politik
Die Suche nach der Angst
Ein Junge geht ins Tor
Hitlers Unterschrift
Ein Gästebuch der Stadt Leipzig verschwindet in Texas
Der ewige Sieger
Ein Schwergewichtsboxer gerät in den Klassenkampf
Kampf um Rom
Ein Verteidiger muß in den Angriff
Die letzte Guerrillera
Eine Revolutionärin landet in Hollywood
Mehr Franz als Boris
Ein Tennisspieler stürzt ins Leben
Der Kuß des Kosmonauten
Eine Kanadierin verliert sich in einem russischen Raumschiff
Der lange Abschied
Eine Polizistenwitwe lebt weiter
Der kurze Abschied
Ein Feuerwehrmann verschwindet
Eiszeit
Eine Eiskunstläuferin gerät zwischen die Welten
Die 89. Etage
Einfache Helden
Quellennachweis
Fotonachweis
Über den Autor
Neunundachtzig
Wenn Menschen in die Geschichte geraten
An einem Abend im Frühsommer 1989 drückte mich mein Schwager in die Polster des Zweisitzers seiner Schwedenmöbelcouchgarnitur, auf die ich immer ein bißchen neidisch gewesen war, und schaute ernst. Er wollte mit mir reden. Es war eine ungewöhnliche Situation. Ich glaube, bis dahin hatte ich mit meinem Schwager keine ernsthaften Gespräche geführt.
Ich war 27 Jahre alt, 1,81 Meter groß und Diplomjournalist. Mein Schwager war zweieinhalb Jahre jünger als ich, aber einen Kopf größer. Er sprach das »Z« aus wie ein scharfes »S«, viele Berliner tun das. Er sagte »Sssucker« statt »Zukker«. Er hatte die 10. Klasse gerade so geschafft, aber er fuhr bereits sein drittes Auto. Sein Hängeboden war mit Autoersatzteilen vollgestopft, aber das wußte ich damals noch nicht. Er besaß alle Platten von Udo Lindenberg, er hatte weiche, beigefarbene Auslegeware und die hellen Möbel aus Holz und Leinen, die meine Mutter »Messemodelle« nannte, wie alle Produkte, die ihr zu gut für die DDR schienen. Er hatte viele, gesunde Zimmerpalmen und immer ein bißchen Westgeld. Er wirkte nie angestrengt. Er war hilfsbereit, er hatte die Decken meiner Wohnung tapeziert, eine Aufgabe, die mir unlösbar schien. Wenn gar nichts mehr lief, fiel ihm immer noch irgend etwas ein. Einmal besorgte er mir eine Sekretärin, die meine Diplomarbeit in zwei Tagen abtippte. Ich hatte nur noch diese zwei Tage bis zum Abgabetermin, und es war Wochenende. Niemand konnte mir helfen. Mein Schwager lud mich in sein Auto, ich glaube, es war gerade ein Saporoshez, und fuhr zu einem grauen Neubaublock in der Greifswalder Straße, er klingelte in einer oberen Etage, ein Mann in Unterwäsche machte auf, es schrieen Kinder, und zwischen ihnen in der kleinen, überheizten Wohnung gab es auch eine Frau, der mein Schwager irgendwann mal einen Gefallen getan hatte. Diese Frau war eine erstklassige Sekretärin. Sie konnte meine Handschrift lesen und schaffte es an dem Wochenende. Mein Schwager kannte überall Leute, die einmal wichtig sein konnten. Den meisten hatte er mal einen Gefallen getan. Er hatte im Wasserbau gearbeitet, dann in verschiedenen Malerbetrieben, seit ein paar Monaten verkaufte er an der Ostsee Turnhosen, auf die er Puma-Zeichen gedruckt hatte. Er verdiente damit an einem Wochenende soviel wie ich im halben Jahr als Wirtschaftsredakteur der Berliner Zeitung. Er verkaufte gefälschte Turnhosen, ich schrieb gefälschte Planwirtschaftsmeldungen. Mein Schwager kam mit dem Leben in der DDR offenbar besser zurecht als ich.
Wir saßen uns also im 4. Stock seiner Altbauwohnung im Prenzlauer Berg gegenüber.
»Wir hauen ab«, sagte mein Schwager.
Es dämmerte, wir waren gerade vom Wochenendgrundstück meiner Eltern zurückgekommen. Mein Schwager hatte mich mitgenommen. Ich hatte damals kein Auto und war überzeugt davon, daß ich mir in den nächsten zehn Jahren auch keines leisten könnte. Es war warm, die Türen zum Balkon standen offen. Den Balkon durfte man nur noch auf eigene Gefahr betreten, das alte Mietshaus zerbröselte. Es war die Zeit, in der die ersten Leute über Ungarn in den Westen flüchteten. Es schien, als hätte mein Schwager seine Flucht schon lange vorbereitet. Er erwähnte Tauchübungen, jetzt aber wollte er mit seinem Freund Mike wie die anderen über die ungarische Grenze nach Österreich fliehen. Anschließend würde er meine Schwester anrufen, die überrascht tun, schließlich aber einen Ausreiseantrag stellen würde. Er wollte sich Arbeit suchen, eine Existenz aufbauen, in zwei oder drei Jahren wäre die Familie wieder zusammen. Das war der Plan.
»Die Welt ist zu groß«, sagte mein Schwager.
Ich könnte schwören, daß er auch sagte: »Der Sinn meines Lebens kann nicht darin bestehen, einmal das Grundstück deiner Eltern zu erben.« Aber als ich ihm das neulich mal erzählte, stritt er es ab. Es hätte natürlich auch gut in meinen Kopf gepaßt. Es ist ein schönes Grundstück, es liegt im Wald und an einem See.
Bestimmt dachte ich an meine Schwester, die nebenan ihren kleinen Sohn ins Bett brachte. Ich würde sie lange nicht wiedersehen. Es war Frühsommer, die DDR wankte nicht, die Mauer stand noch fest. Ich wollte nicht abhauen. Ich würde von der Einschulung meines Neffen nur die Fotos sehen.
Das war traurig, aber ich kam nicht auf die Idee, sie zurückzuhalten. Nicht einen Moment lang. Womöglich habe ich sie verstanden, aber vielleicht habe ich auch schon an ihre Pakete gedacht. Ich würde endlich Westverwandte haben. Westverwandte ersten Grades. Ich müßte nicht mehr darauf warten, daß meine Mutter Rentnerin wurde. Das wäre erst im Jahr 1997 gewesen, ich wäre 35 Jahre alt gewesen und damit – davon war ich überzeugt – zu alt für die Jeans, die meine Mutter mir dann mitbringen könnte. So würde alles sehr schnell gehen. Ich war 27. Ich würde bald Jeans haben und Lindenbergplatten.
Ein Auto kriegte ich sofort.
Mein Schwager überließ mir seinen Polski Fiat an jenem Abend wie ein Vermächtnis. Er wollte das Auto in guten Händen wissen, sagte er. Er sprach über den 17 Jahre alten polnischen Wagen wie über einen Sohn. Autos waren damals auch Kinder. Er würde es so aussehen lassen, als hätte er es mir geborgt, bevor er ging. Er wollte 4000 Mark für das Auto haben, was praktisch geschenkt war, zumal ich keine 4000 Mark besaß. Es war eine Summe in Reichweite. Mein Schwager nannte mir Adressen von Leuten, die mir helfen würden, wenn zum Beispiel die Wasserpumpe kaputtgehen sollte. Die Wasserpumpe des Polski Fiat war sehr sensibel. Wir beschlossen auch, mich als Untermieter in ihre Wohnung einschreiben zu lassen. Es war eine kleine, helle Wohnung im Bötzow-Viertel zwischen Friedrichshain und Greifswalder Straße. Ich dachte daran, sie später zusammen mit der kleinen Karlshorster Wohnung, in der ich mit meiner Freundin und unserem Sohn wohnte, in eine große zu tauschen.
An diesem Abend griff die Geschichte direkt in mein Leben, aber ich spürte nichts davon. Ich dachte nicht an Geschichte, ich dachte an Jeanshosen. Als ich nach unten ging, streichelte ich den fleckigen Polski Fiat, der vor ihrem Haus stand. Mein erstes Auto. Ich behielt das Geheimnis. Aber als ich ein paar Tage später mit dem Auto zur Ostsee fuhr, fühlte ich mich schon wie der Besitzer. Dort rief mich meine Schwester irgendwann an und sagte, daß ihr Mann in den Westen abgehauen war. Ich hatte jeden Tag auf diesen Anruf gewartet. Jetzt stand ich im Essensaal eines FDGB-Heims in Ahlbeck auf der Insel Usedom und tat überrascht.
»Was!« rief ich in den Hörer.
»Jaa!« rief sie zurück. »Ist das nicht schlimm? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll.«
»Bleib ruhig«, rief ich zurück.
Wir spielten ein aufgeregtes Telefongespräch, weil wir sicher waren, daß man uns dabei zuhörte. Meine Schwester war in den Mittelpunkt der Welt gerückt. Ihre kleine Familie war zerrissen, verstreut über zwei Gesellschaftssysteme. Ihr Mann war unvorstellbar weit weg, wir waren alle nie im Westen gewesen. Wahrscheinlich hatte die Staatssicherheit in diesen Tagen wichtigere Dinge zu tun, aber woher sollten wir das wissen. Meine Schwester wollte so schnell wie möglich raus, und mein Leben in der DDR ging ja weiter.
Ich weiß noch genau, wie ich an den Tisch zurückging, an dem meine Freundin mit unseren Urlaubsbekanntschaften aus Pankow saß. Es war ein langer Weg, auf dem ich versuchte, ernst zu bleiben. Mein Schwager war in Gießen. Er war durch ungarische Wälder gerobbt, während ich im Strandkorb saß. Er war ein Held, ich ein FDGB-Urlauber.
Er hat wohl eher an sich gedacht als an das sozialistische Lager. Aber er brachte es ins Schwanken. Er, sein Freund Mike und all die anderen. Sie waren Helden der Geschichte, sie bestimmten die Nachrichten. Ich dagegen richtete mich in meiner kleinen Welt noch ein bißchen gemütlicher und fester ein.
Mein Schwager reiste nach Westberlin und winkte seiner Familie von einem der Grenztürme zu. Sie standen im Prenzlauer Berg und winkten zurück. Meine Schwester begann, die Wohnung aufzulösen. Einmal trug ich mit meinem Vater einen Kühlschrank runter, mehr weiß ich nicht mehr. Es war Herbst, es wurde früher dunkel.
Immer mehr Menschen gingen in den Westen. Ich blieb. Ich schlich um die Funktionärshäuser, die mit Westgeld gebaut wurden, ich interviewte Horst Sindermann in seinem Wohnzimmer in Wandlitz, Alexander Schalck-Golodkowski auf der Parteiversammlung des Außenhandels in Berlin-Mitte und Volkspolizisten in der Wache an der Gethsemane-Kirche. Aber als die Mauer fiel, ging ich ins Bett. Ich machte das Radio aus, in dem Menschen schrieen, ich schloß die Fenster und klappte die Klappliege aus. Ich war enttäuscht. Ich habe nicht mal daran gedacht, daß ich hier eine historische Nacht verpassen könnte. Ich war soweit weg. Meine Schwester packte ihre Sachen und fuhr rüber zu ihrem Mann. Damit ging die Geschichte zu Ende. Der Plan war erfüllt, für die äußeren Umstände konnte man sie nicht verantwortlich machen.
Ich hatte noch gar nicht angefangen, für meinen Schwager war an diesem Novemberabend die Heldenzeit vorbei. Es gab jetzt neue Helden. Ich folgte ihnen. Ich fuhr mit dem geerbten Polski Fiat übers Land.
Die Grenzen zwischen meinem Leben und dem Leben, das ich beschrieb, berührten sich nun.
Die Wohnung im Bötzow-Viertel stand leer. Mein Schwager zog mit seiner Familie in ein Westberliner Umsiedlerheim gegenüber von Möbel Hübner. Sie teilten sich mit einer anderen Familie einen kleinen Schlafraum. Sie hatten eine elektrische Kochplatte in der Ecke, die Bäder waren auf dem Flur, vorm Haus war ein Straßenstrich. Zum ersten Weihnachten nach dem Mauerfall bekamen wir unsere Westgeschenke. Ich kriegte »Der Friedhof der Kuscheltiere« von Stephen King, mein Sohn eine »Scout«-Schultasche. Das werde ich ihnen nie vergessen. Eine Woche später wurde ich für drei Monate Praktikant bei einem Hamburger Wirtschaftsmagazin und verdiente mehr Westgeld als sie.
Im Frühjahr 1990 fuhr mein Schwager wieder auf das Wochenendgrundstück meiner Eltern wie in dem Jahr zuvor. Im Mai lackierte er mir dort den fleckigen Polski Fiat knallrot. Er liebte ihn immer noch, obwohl er inzwischen einen metallic-grünen Opel-Rekord mit Breitreifen besaß. Der Polski Fiat war mehr als ein Auto. Bei einer Reportage über das Dorf Marxwalde, das seinen Namen gerade in Neuhardenberg umwandelte, ließ mich der Wagen zum ersten Mal im Stich. Es war im Winter 1990. Ich war gerade Reporter geworden, die Grenzen zwischen meinem Leben und dem da draußen lösten sich auf. Ein örtlicher Autohändler bot an, den Wagen zu verschrotten, wenn ich einen SEAT bei ihm kaufte. Ich konnte das nicht. Der Wagen war ein Vermächtnis. Ich besuchte den Mann, der bei Wasserpumpenproblemen helfen konnte, immer öfter. Er hatte ein riesiges Haus im Süden von Berlin, das er mit meinen Ersparnissen verschönerte. Das Auto blieb immer wieder stehen, im Sommer 1991 fuhr es dann gar nicht mehr. Ich nahm mir Mietwagen, das ging jetzt. Ich verlor den Kontakt zu dem Wagen, der mir noch vor kurzem soviel bedeutet hatte. Im Herbst klauten sie die Reifen, mein Sohn rettete die Scheibenwischer, vor den anderen Kindern, die inzwischen in dem Auto spielten. Unserem Auto. Ich gab auf. Ich ließ es von einem Schrottwagen abholen. Etwa um diese Zeit warf mich meine Freundin zwischen zwei Reportagen aus der Wohnung in Karlshorst. Ich bekam es kaum mit. Ich zog in die immer noch leerstehende Wohnung meines Schwagers. Auf dem Zwischenboden fand ich zufällig die Ersatzteile für den Polski Fiat, den es nicht mehr gab. Ich machte den Zwischenboden wieder zu, ich besaß sowieso nichts, was ich dort hätte lagern können. Ich befand mich auf einer Reise, die nicht aufhörte. Mein Leben war eine Kette von Reportagen. Mein Schwager wohnte immer noch in einem Auffanglager neben dem Babystrich. Meine Schwester arbeitete für eine Zeitarbeitsfirma. Wir besuchten sie zu ihren Geburtstagen wie die verarmten Verwandten. Sie wollten nicht zurück in den Osten. Es wäre ihnen vorgekommen wie ein Verrat an ihrem Plan.
Ich schlief einen Winter lang in meinem schwarzen neuen Mantel in der unbeheizten Wohnung, weil ich den Keller nicht aufbekam. Ich besaß einen Koffer und eine Schlafcouch. Ich fuhr immer schneller durch das Land und beschrieb alle Helden, die ich finden konnte. Kleine und große. Sie starben wie die Fliegen. Nachts betrat ich manchmal den Balkon auf eigene Gefahr und sah die dunkle Straße hinunter. Wenn sich gar nichts mehr bewegte, ging ich ins Bett.
Irgendwann war alles beschrieben. Ich riß den Zwischenboden raus, warf die Ersatzteile weg, zog erst nach Berlin-Mitte und später nach New York.
Zwölf Jahre nachdem mein Schwager im Westen angekommen war, stand ich auf der Brooklyn-Bridge und sah den ersten Turm des World Trade Centers zusammenbrechen. Es war das Erstaunlichste, was ich je in meinem Leben beobachtete. Ein Bild wie ein Seufzer. Ich habe nach irgend etwas vergleichbarem gesucht, als wollte ich mich daran festhalten. Ich weiß noch, daß mir der Absturz des »Hindenburg«-Zeppelins einfiel. Ich habe eine CD-ROM, auf der das Time-Magazine das letzte Jahrhundert zusammenfaßt. Es gibt ein paar kurze Filme auf der CD, einer davon zeigt das Kennedy-Attentat, einer den brennenden Zeppelin, die rennenden Menschen. Es war das größte, was mir einfiel, aber es reichte nicht.
Heute kann man sich die Fotos der Menschen ansehen, die zugucken, wie das Haus zusammenfällt, der Unglaube, das Entsetzen macht all die verschiedenen Gesichter New Yorks für einen Moment gleich. Ich war am 9. November 1989 im Bett. Vielleicht haben die Leute ähnlich geschaut, als die Mauer fiel. Auch das schien ja unmöglich.
Aber irgendwann läuft die Zeit dann weiter und mit ihr die Menschen.
Die Menschen rannten. Viele waren bereits mit weißem Staub bedeckt. Einige Frauen hatten ihre Schuhe ausgezogen, sie liefen barfuß in ihren Busineßkostümen über die Brücke wie über den Strand. Alle wollten weg von Manhattan, der Insel, ihrem ewigen Ziel. Dort, wo sie hinliefen, in Brooklyn, war meine Familie. Ich dachte daran, zu ihnen zurückzugehen, mit den anderen zu laufen. In meiner Erinnerung wackele ich. Es war eine Lebensentscheidung. Dann lief ich auf die grauweiße Wolke zu. Es kamen mir immer weniger Menschen entgegen, und als ich Manhattan betrat, hatte ich das Gefühl, beinahe da zu sein. Es war weiß, still und friedlich. Ein paar wenige Fotografen liefen ohne Eile durch die Asche des Südturms wie durch Schnee. Mein Handy ging schon lange nicht mehr, ich hatte kein Kleingeld fürs Telefon. Ich fragte einen koreanischen Händler nach ein paar Münzen, aber der wackelte nur mit dem Kopf und verrammelte seinen Laden. Wahrscheinlich hatte er Angst vor Plünderern, es war wie im Krieg. Ein Mann schenkte mir einen Quarter, ich rief im Büro an und sagte, wo ich bin. Dann lief ich weiter, auf den noch stehenden Turm zu. Als ich direkt vor ihm stand, zwischen der kleinen Kapelle und dem Hilton-Millenium, stellte sich ein Feuerwehrmann in meinen Weg.
»Was willst du hier, Junge?« fragte er mich.
Näher ran, dachte ich und schwieg.
»Geh zurück«, sagte er.
Ich drehte mich um und wollte es in der nächsten Straße versuchen. Ich mußte näher ran, ich verstand noch nichts. Dies war das Unbeschreibbarste, Unmöglichste, was ich je erlebt hatte, ich war Journalist. Vielleicht erfüllten sich im nächsten Moment all meine Sehnsüchte. Womöglich war die Reise hier zu Ende. Ich war soweit gekommen, ich war in der Stadt, in der ich immer sein wollte. Die Stadt, die ich mir bis zum Schluß aufgehoben hatte. Die Stadt, die so vermessen ist wie mein Beruf. Vielleicht würde ich heute morgen erlöst. Ich wollte dichter ran, ganz dicht. Ich lief ein paar Schritte zurück, da rief der Feuerwehrmann: »Renn! Wir verlieren den zweiten Turm!«
Ich sah mich noch mal um, der Turm stand, aber seine Haut zitterte. Dann rannte ich. Neben mir rannten jetzt ein paar Bauarbeiter. Hinter uns grollte es, leise nur. Ich war nicht panisch, ich war euphorisch, weil ich das Gefühl hatte, dabei zu sein. Ich war so dicht dran wie es ging, ich hatte mir nichts vorzuwerfen. In meiner Erinnerung lache ich einem der Bauarbeiter beim Rennen zu. Die schwarze Wand in unserem Rücken kam näher. Wir rannten in eine schmale Straße, von vorn kam eine zweite schwarze Wand. Sie schlugen über uns zusammen. Dichter heran konnte ich nicht mehr.
Ich war jetzt da. Alles war schwarz.
Wir blieben stehen, es gab keine Eingänge, nur eine Blechtür zu einem Keller. Einer der Bauarbeiter brach sie auf. Ich hielt die Luft an. Wir standen eine Weile vor der Kellertreppe, die Bauarbeiter schwiegen. Es war dunkel, und es wurde nicht heller. Irgendwann mußte ich einatmen. Die Luft war warm und dick. Einer der Bauarbeiter leuchtete mit einem Feuerzeug in den Keller, ich wußte nicht, ob es gut ist, dort runterzugehen oder oben zu bleiben, oder weiterzurennen. Ich war mir sicher, daß ich gleich umfallen würde. Ich sehnte mich nach Brooklyn, nach meiner Familie. Ich nahm mir vor, den Beruf aufzugeben, wenn ich das überleben sollte. Der Rauch ging nicht weg. Irgendwann kam ein Polizist mit einer Stabtaschenlampe und stieß uns in den Keller. Wir liefen ein paar Gänge entlang, bis wir eine Tür fanden, unter der ein schmaler Lichtstreifen zu sehen war. Sie ging auf. Wir betraten einen Kellerraum, in dem etwa 15 Leute zusammenhockten. Die Menschen schienen verzweifelt, sie husteten und weinten, aber die Luft war besser, und es gab Polizisten. Ich lebte, die Prioritäten verschoben sich. Vor drei Minuten wollte ich noch meinen Beruf aufgeben, jetzt fing ich an, Interviews zu führen. Eine Frau weinte, weil ihr Mann in einer Etage des Nordturmes arbeitete, in die das erste Flugzeug direkt hineingeflogen war. Ein jüdischer Anwalt kämpfte mit seinem Asthma, eine Polizistin übergab sich. Aus einem Kofferradio erfuhren wir, daß auch in Washington und Pennsylvania Flugzeuge abgestürzt waren. Wir saßen im Luftschutzkeller. Ich war hellwach. Ich schrieb Telefonnummern und Namen auf. Später lief ich, mit weißem Staub bedeckt, den Broadway hoch und hatte wieder das Gefühl, dabeigewesen zu sein.
Das war natürlich ein Irrtum.
Ich bin kurz vor Weihnachten noch einmal in der Straße gewesen. Das New Yorker Büro des Stern hatte seine Weihnachtsparty in einer Bar am Ground Zero gefeiert. Nach der Party wollte ich meiner Frau den Platz zeigen, zu dem ich damals flüchtete. Es war nach Mitternacht, aber die Straßen waren in weißes Baulicht getaucht, sie suchten immer weiter nach Toten. Wir irrten in unseren Weihnachtsfeieranzügen wie durch eine Kulisse. Ein Officer stoppte uns irgendwann und lächelte uns mitleidig an. Ich kam mir vor wie ein Katastrophentourist.
Ich war nie dabei. Ich war immer nur außen.
Ich habe viele New Yorker Geschichten geschrieben in den Wochen und Monaten nach dem Anschlag. Für eine Reportageserie im Spiegel recherchierten wir, so gut es ging, was an diesem Morgen in den Türmen passiert war. Das Thema schien beherrschbar. Aber es brach unter unseren Händen auf. Unsere Sekretärinnen und Rechercheurinnen fanden immer mehr Geschichten, immer mehr Menschen, die mit uns reden wollten. Es kamen weitere Reporter nach New York, um sie aufzuschreiben. Ich taumelte einen Monat von einer Leidensgeschichte in die nächste, ohne eine Ordnung zu entdecken. Manchmal saß ich mit Hinterbliebenen in ihren Wohnzimmern und ahnte, während sie mir ihre traurigen Geschichten erzählten, daß ich sie nie aufschreiben würde. Irgendwann fiel mir auf, daß zwei der Leute, mit denen ich sprach, aus dem 89. Stock des Nordturmes geflohen waren. Genau vier Stockwerke über ihnen war die Maschine eingeschlagen. Sie kannten sich bis zu diesem Moment nicht, obwohl sie doch lange nebeneinander gearbeitet hatten. Ich fand mehr Leute aus der Etage. Ich zeichnete ihre Büros und ihre Namen in eine Flurskizze. Ich konnte mir zum ersten Mal vorstellen, wie es in dem riesigen Gebäude ausgesehen hatte. An normalen Tagen und an jenem Morgen. Ein Mann erzählte mir von einem Kollegen, den er immer nur auf der Toilette traf. Ein Chinese, der am Pinkelbecken seine Krawatte über die Schulter warf. Das war alles, was er von dem Mann wußte. Und, daß er an diesem Morgen starb.
23 Menschen aus der 89. Etage überlebten. Sie waren eine halbe Stunde lang eingesperrt, weil alle Türen zu den Notausgängen blockiert waren. Sie warteten. Irgendwann tauchten zwei Männer mit Bauarbeiterhelmen auf und befreiten sie. Ich schrieb eine Geschichte über diese Etage, aber die Namen der beiden Retter fand ich erst viel später.
Sie sind tot.
Jeder der 23 Überlebenden hat andere Erinnerungen an sie. Es ging so schnell. Es war dunkel, sie sahen nur den Ausgang. Einer war groß, einer klein. Einer dunkel, einer weiß. Einer trug einen Bart und einen Ohrring. Ich zeigte ihnen Fotos von Vermißten, bis irgendwann feststand: Einer der Männer war Pablo Ortiz. Ortiz beaufsichtigte die Bauarbeiter, die im World Trade Center Reparaturen und Umbauten machten. Ein Mann mit Bart, Ohrring und der Hautfarbe eines Puertoricaners.
Ich habe versucht herauszufinden, was für ein Mensch Pablo Ortiz war. Es war eine traurige Recherche.
Ortiz war ein einfacher Mann, und so wie es aussieht, war er an jenem 11. September zum ersten Mal der Held, der er immer sein wollte.
Sicher ist das natürlich nicht.
Sicher ist nur eins. Er war irgendwo in dem Haus, in das ich an jenem Morgen wollte, um ganz dicht dran zu sein.
Ich sitze in der Wohnung eines Freundes in der Straße, in der mein Schwager mir vor 13 Jahren verriet, daß er in den Westen geht. Es ist wieder Sommer. Es ist sehr warm. Gegenüber wird das letzte narbige Haus der kleinen Prenzlauer Berger Straße glattrestauriert. Alle Balkons sind jetzt zu betreten. Abends jogge ich rüber zum Trümmerberg, auf dem ich als Kind Schlitten fuhr. Ich fühle mich wohl im Prenzlauer Berg und sehne mich nach New York. Ich höre die neue Platte von Bruce Springsteen, auf der er den 11. September verarbeitet. Es ist jetzt ein Jahr her. Die Platte ist gerade rausgekommen. In Dresden ist Hochwasser. Männer mit schweren Arbeiterhänden retten die Bilder aus der Gemäldegalerie. Es gibt Tote, es werden neue Helden geboren. In den Zeitungsberichten lese ich, wie sich das Entsetzen mit dem Stolz der Reporter mischt, dabei gewesen zu sein. Sie kaufen sich jetzt Gummistiefel. Ich habe noch die Schuhe, die ich damals trug und auch noch den Katastrophentrinkbecher der US Army, den mir einer der Polizisten im Keller gab. Ich weiß noch, wie ich am Mittag des 11. September den Broadway hinauflief und mir immer wieder ernst auf die Schuhe sah, die mit Asche bedeckt waren. Die Gesichter der Leute aus SOHO und dem West Village erschienen mir, verglichen mit meinen Schuhen, unangemessen sauber und naiv. Ich suchte bereits nach Worten, wie jetzt die Reporter der Hochwasserkatastrophe in Sachsen. Wieder ist von Krieg die Rede und davon, daß nichts mehr so ist, wie es war. Wahrscheinlich würde ich den Elbereportern heute sehr trocken vorkommen.
Ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, dorthin zu fahren. Ich bin nicht erlöst, nur ein bißchen müde.
Ich habe immer eine Weile gebraucht, um den Leuten den Titel dieses Buches zu erklären. Es wird nur durch mich zusammengehalten. Es berührt die beiden wichtigsten journalistischen Ereignisse meines Lebens. Beim ersten war ich noch kein Reporter, beim zweiten wollte ich keiner mehr sein. Einmal schien ich ganz dicht dran zu sein, einmal ganz weit weg. Aber letztlich gab es kaum einen Unterschied. Ich mußte nirgendwo hinfahren, ich war da. Beide Male stolperte ich ein paar Momente durch den Sturm, bevor ich mich auf den sicheren Boden des Beobachters rettete.
Ich bin Reporter. Ich mache keine Geschichte, ich hänge mich immer nur ran. Ich lebe von Helden, so kann ich alt werden. Für die Helden aber ist das schwerer. Die Menschen rennen weiter, es gibt soviel zu tun.
Pablo Ortiz ist tot. Mein Schwager wohnt heute in Steglitz. Er war ein unfreiwilliger Held. Auch er hat die Konsequenzen unterschätzt. Er hat mitgeholfen, die Welt abzuschaffen, in der er König war. Für ein paar Augenblicke hatten seine ganz persönlichen Interessen weltpolitische Relevanz. Dann ging das Licht um ihn wieder aus. Mein Schwager und Pablo Ortiz waren für einen Moment Teil der riesigen, wimmelnden Bilder, die mich ratlos machen. Gäbe es heute noch große historische Panoramabilder, würde man auf ihnen Pablo Ortiz und meinen Schwager finden. Sie haben mitgemacht. Sie wußten nicht, was passiert, aber sie haben gehandelt. Das ist alles, was sie gemein haben.
Und die 89 in meinem Kopf.
Sie sind so zufällig in dieses Buch geraten, wie die anderen Helden.
Achtzehn Wagen
Mein Schwager gelangt in den Westen
Sein erster Wagen hieß Saporoshez. Das war ein sowjetischer Kleinwagen. Wenn es eine Rangfolge für Autos in der DDR gab, dann stand der Saporoshez sicher ganz unten. Es konnte eigentlich nur noch bergauf gehen.
»Ich habe den Sapo für 5000 Mark auf’m Dorf gekauft. Irgendwo hinter Pankow. Bis dahin wußte ich noch nicht mal, daß es einen Saporoshez gibt. Ich war heiß auf ein Auto, ich hatte gerade meine Fahrerlaubnis gemacht. Da war ich 20. Ich habe ’ne Anzeige in die Zeitung gesetzt, und als die rauskam, hatte ich den Sapo schon. Ich habe auf die Annonce so schöne Angebote bekommen, und ich hatte die schärfste Schüssel gekauft. Das Ding war völlig verrostet, es sah aus wie ein Tarnfahrzeug. Ich war in jeder Verkehrskontrolle drin. Das Auto hat soviel Öl geschluckt wie Benzin. Ich hatte den Kofferraum voller Ölflaschen. Der Sapo regnete Öl, die Leute, die hinter mir fuhren, mußten die Scheibenwischer anmachen. Ich weiß auch nicht, warum ich den gekauft habe. Ich konnte nie warten. So war es eigentlich immer.«
Der Wagen stand unten neben den anderen Wagen in der kleinen Straße im Prenzlauer Berg. Wenn er losfuhr, hörten das alle. Aber der Wagen fuhr nicht oft. Er lag meistens drunter. Er war ein großer Mann, der Saporoshez klein.
Er wurde im Dezember 1964 im Krankenhaus Friedrichshain geboren. Da war sein Vater schon nicht mehr da. Der hatte das Geld, das seine Frau für die Hochzeit gesammelt hatte, durchgebracht. Er war kein schlechter Mann, aber freitags, wenn es auf dem Bau Geld gab, kam er oft nicht nach Hause. Als das Hochzeitsgeld weg war, hat sie ihn rausgeworfen. Der Vater holte ihn manchmal ab, sie gingen auf den Rummel. Irgendwann kam er nicht mehr. Der Stiefvater war Lasterfahrer in einem Materiallager. Die Mutter füllte in der Brauerei »Bärensiegel« Flaschen ab oder wusch die Gärbehälter aus, dafür gab’s einmal im Monat einen Kasten Bier gratis. Später hat sie nachts in der Kaufhalle Regale eingeräumt. Dadurch hatten sie am Wochenende immer Rouladen, sie kam auch an H-Milch, Ketchup und Rosenthaler Kadarka ran. Das waren die Beziehungen, die sie hatten. Und natürlich kurz vor Silvester die Raketen und Knaller.
»Die anderen standen vor der Halle in der Schlange, manche haben sich ja schon nachts angestellt. Ich bin an allen vorbeigelaufen«, sagt er.
Sie waren vier Kinder. Anfangs wohnten sie in einer Zweizimmerwohnung in der Warschauer Straße, Erdgeschoß. Sie haben zu sechst in einem Zimmer geschlafen. Seine Eltern, seine drei Schwestern, er. Freitags wurde gebadet. 1975 zogen sie ins Hans-Loch-Viertel in eine Vierzimmerwohnung, 75 Quadratmeter. Das war eine soziale Errungenschaft. Sie waren kinderreich. So hieß das damals, und es klang nicht immer gut.
In seiner neuen Klasse waren noch zwei andere Schüler aus kinderreichen Familien. »Einer war so’n bißchen verschlampt, klingt komisch, aber er hat gerochen. Und die anderen waren fast kriminell. Wir hatten auch unseren Ruf. Mal abgesehen von meiner älteren Schwester waren wir nicht unbedingt gut in der Schule. Aber wir hatten einen Hund und irgendwann auch ein Auto. Das Auto hat geholfen. Ich werde nie vergessen, wie mein Vater mit dem Lada ankam. Es war das größte. Der Lada war zweifarbig. Wir waren kinderreich, aber wir hatten ein Auto. Ich war unglaublich stolz drauf.«
Der Stiefvater war groß und still, die Mutter eher das Gegenteil. Sie war die zentrale Figur und entwickelte auch die Familienphilosophie. Ein Beruf war nicht so wichtig, erklärte sie. Man könne auch ohne Beruf arbeiten, man müsse clever sein.
Vielleicht beruhigte ihn das. Seine Zensuren waren schlecht, er bekam zunächst keinen Ausbildungsplatz, nicht mal als Fleischerlehrling nahmen sie ihn. Keine Chance als Fernsehmechaniker, das wäre er gern geworden. Er bewarb sich immer zusammen mit seinem Klassenkumpel. Einmal klaute der während eines Bewerbungsgespräches dem Kaderleiter des Reichsbahnausbesserungswerkes Schöneweide einen Radiergummi. Danach war auch bei der Reichsbahn nichts mehr frei. Sie landeten beide beim Wasserbau. Seine Eltern freuten sich. Der Junge machte eine Lehre, er schaffte die 10. Klasse. Und clever war er auch noch. Er ging mit der Tochter eines Mathelehrers aus und besorgte sich so die Prüfungsaufgaben. Er ließ sie von dem Matheaß seiner Klasse lösen, aber nicht so gut. Er wollte eine Drei haben, eine Zwei hätte ihm niemand geglaubt. So bestand er die 10. Klasse.
Im vorläufig letzten Auto.
Beim Wasserbau war es anfangs aufregend, später dann nicht mehr.
»Wir waren jung, und die Leute auf den Wohnschiffen waren alte Säcke, die wollten immer nur Karten spielen und fernsehen. Ich wollte nicht mit denen auf dem Dorf rumhängen.«
Er wäre am liebsten gleich weitergezogen, er verspürte eine Unruhe, die ihn lange nicht losließ, eine Unzufriedenheit. Aber er machte die Lehre zu Ende und blieb zwei Jahre. Gedrängt von dem Mädchen, das er mit 17 kennenlernte. Sie war genauso alt wie er und wurde die Frau seines Lebens. Mit 19 heirateten sie. Es war eine lustige kleine Hochzeit. Seine Krawatte borgte er sich vom Arbeitskollegen seines Schwiegervaters. Sie flogen für ein paar Tage nach Prag. Weiter war er noch nie von zu Hause weg gewesen. Seine Familie fuhr nicht in den Urlaub, sie hatten einen Garten in Teltow. Womöglich wollte er deswegen nicht mit dem Zug nach Prag. Er wollte fliegen. Auf dem Weg zur Rollbahn öffnete er eine Flasche Rotkäppchensekt. Wie im Film. Im Herbst ’84 kam ihr Sohn zur Welt. Sie lebten zu dritt im 16 Quadratmeter großen Kinderzimmer der Frau.
Dann kündigte er doch.
Er wurde Maler. Er ging zu einer PGH und redete so lange auf den Vorsitzenden ein, bis der ihn nahm. Er verdiente nicht soviel, weil er keinen Abschluß hatte, aber war schnell und gut. Er schaffte sein Soll von 7–13 Uhr, danach ging er privat arbeiten, »pfuschen«, wie er es nennt. Er hat viel Geld verdient, in dieser Zeit kaufte er sich den Saporoshez. Sie zogen aus dem Kinderzimmer aus in eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Bötzow-Viertel. Irgendwann merkte sein Chef, daß er viel schneller war als die anderen.
»Du kannst nicht um eins abhauen. Die Jungen arbeiten für die Alten mit. Wenn Du mal alt bist, freut dich das auch«, sagte der Chef.
»So lange will ich nicht warten«, sagte er.
Er kündigte wieder. Er fing als Maler bei der Kommunalen Wohnungsverwaltung Prenzlauer Berg an. Er war sein eigener Herr und sehr zufrieden. Er arbeitete bis eins und ging danach pfuschen. Hier störte das keinen. Wenn er eine Anzeige für »private Malerarbeiten« in der Berliner Zeitung schaltete, hatte er für drei Monate zu tun.
»Ich hab damals 700 Mark für ein Zimmer genommen. Komplett mit Türen, Fenstern, Heizung, Putzen, Tapezieren. Ich hatte bald einen Namen. Das Problem war, so schnell du die Kohle hattest, so schnell warst du sie wieder los. Es war ja immer das Auto kaputt.«
Den Saporoshez hat er dann für 3500 Mark verkauft, nachdem er ihn noch lackiert hatte. Es war ein Verlustgeschäft, aber er brauchte Geld für den Trabant, den er entdeckt hatte. Es war ein 64er Baujahr, ein blau-weißer Kombi.
»Der Trabi war 24 Jahre alt. Genauso alt wie ich. Ich habe 8500 Mark für ihn bezahlt. Der Hammer kam aber noch. Als ich den Wagen am nächsten Tag in die Werkstatt brachte, behielten sie den gleich da. Der ist nicht verkehrstauglich, sagten die, der braucht neue Bremsen. Und als ich ihn dann wieder abholen wollte, sagten sie, daß der Motor kaputt war. Die Federn mußten auch raus.
Das hat insgesamt noch mal 6500 Mark gekostet. Mit dem Kaufpreis habe ich also 15000 Mark für einen 24 Jahre alten Trabant bezahlt. Glücklicherweise habe ich ja weiter gut Geld verdient.«
Das Geld hatte eigentlich keine Funktion mehr. Man tauschte. Alles stützte sich gegenseitig. Deswegen fiel es wenig später auch so schnell zusammen. 1988 zeigte er seinem Cousin aus dem Westen ein Haus im Prenzlauer Berg, das er malern mußte. Sein Cousin lief durch das Haus, taxierte die Flächen und sagte ihm, daß er im Westen dreimal soviel Geld für so einen Job bekommen würde. Westgeld.
Womöglich setzte das den ersten Stich.
»Es ging uns ja nicht schlecht. Aber wenn ich mir überlege, daß die auch die besseren Farben und Arbeitsgeräte hatten. Wir mußten ja immer aus Scheiße Gold machen. Ich dachte, ich werde da reich. Ich wußte doch nichts. Meinem Cousin schien es gut zu gehen. Und auch einem Kumpel, mit dem ich zur Schule gegangen bin. Dessen Vater war Invalidenrentner, der war für uns der absolute King. Wir saßen immer in der Passage rum, das war ’ne Kneipe in unserem Wohngebiet. Als wir so 16, 17 waren. Ab und zu kam der Vater rüber, der hatte ein USA-T-Shirt an und hat den totalen Chef gemacht. Mein Kumpel ist 1982 auf Familienzusammenführung rübergegangen. Sein Vater hat in einer Ein-Zimmer-Wohnung in Reinickendorf gewohnt, der war einsam. Der war ’ne ganz arme Sau. Aber das wußte ich damals natürlich alles nicht. Über so was hat ja auch keiner geredet. Als mein Kumpel dann im Westen war, habe ich mit ihm Nordhäuser Doppelkorn und Florena-Creme gegen Lindenberg-Platten getauscht. Zwei Flaschen Nordhäuser und drei Schachteln Florena waren eine Platte. Mein Kumpel hat eigentlich positiv über den Westen erzählt. Was sollte er auch sagen.«
Die Welt war klein, viel kleiner als heute. So traf er Anfang 1989 fast zwangsläufig Mike wieder, mit dem er beim Wasserbau gelernt hatte. Mike war ein Witzbold und ein Mädchenschwarm. Er fuhr einen Polski Fiat. Das war eine andere Klasse als der Trabant. Seine Frau nähte T-Shirts aus Lakenstoff, die sie auf Märkten verkauften. Mike hatte eine Altbauwohnung angemietet, in der er Turnhosen mit einem Puma-Zeichen bedruckte und lagerte. Eine Hose brachte die Monatsmiete rein. Es war ein richtiges Geschäft, illegal natürlich. Aber das hieß nicht viel. Mike ließ ihn nach und nach in seine Welt hineinschauen. Er hatte sich bisher für ziemlich clever gehalten. Jetzt ahnte er, daß er erst am Anfang stand mit seinem blau-weißen Trabant und dem Halbtagsjob als Maler. Er bewunderte Mike, der auch einen kleinen Sohn hatte. Die Frauen verstanden sich ebenfalls gut. Mike redete viel vom Abhauen.
Am Anfang hielt er sich noch zurück. So gut kannten sie sich ja nicht. Aber manchmal lag er abends mit seiner Frau im Bett, und sie stellten sich vor, wie es wäre dort drüben.
Er begann in Mikes Welt einzusickern.
Er fing an, für das Geschäft einzukaufen. Er besorgte große Stückzahlen der billigen, gestützten DDR-Sportkleidung. Im »Haus für Sport und Freizeit« am Frankfurter Tor war er Stammkunde. Er erfuhr, wenn die Lieferungen kamen. Manchmal kaufte er sie komplett auf. Den Verkäufern war es egal. Es war 1989, alles döste, niemand wunderte sich, was der große Mann mit 400 Turnhosen wollte. Wahrscheinlich waren sie froh, daß sie sie nicht mehr verkaufen mußten. In der Nacht druckten sie zusammen in der Altbauwohnung fremde Logos auf.
»Mike hat gedruckt, ich habe die Hose gehalten. Das war wie Geld drucken. So ’ne Hose haben wir für drei Mark eingekauft und für 20 verkauft. 300 Hosen pro Nacht haben wir gemacht.«
Als es warm wurde, fuhren sie mit den Sachen an die Ostsee. Zuerst kam Mike noch mit. Zuletzt fuhr er allein mit seiner Frau. Die Leute rissen ihnen die Sachen aus den Händen. Am besten gingen Turnhemden und Stirnbänder, auf die sie »Dirty Dancing« gedruckt hatten. Die Turnhemden, die im Laden 4,50 Mark kosteten, verkauften sie für 30 Mark. Die Stirnbänder schweißten sie in Plastikfolie ein.
»Das sah professionell aus. Die Leute waren wie verrückt. Wir hätten noch viel mehr verkaufen können. Wir haben die Stände direkt vorm Kino aufgebaut. Damals lief ja gerade ›Dirty Dancing‹ im Kino.«
Der Film lief im Sommer 1989 in der DDR. Er lieferte den Soundtrack der Revolution. Nicht Wolf Biermann oder »Herbst in Peking« spielten zum Umsturz auf. Es war Patrick Swayze. Das erklärt auch manches.
»Wir sind an so ’nem Wochenende mit 7000 Mark nach Hause gefahren. Ich habe davon 700 bekommen. Es war ja Mikes Idee. Ich habe mich so sauwohl gefühlt. 700 Mark haben andere in einem Monat verdient. Fürs Drucken habe ich noch mal 300 gekriegt. Ich hatte in der Woche 1000 Mark. Irgendwie hatte ich gar keine Lust mehr, in den Westen zu gehen. Ich habe Mike damals auch mal vorsichtig Andeutungen gemacht. Ich konnte mir nicht vorstellen, daß wir im Westen mit dem Geschäft so erfolgreich sein würden. Ich meine, wer kauft denn nachgemachte Puma-Hosen an der Ostsee, wenn er echte bei Karstadt kriegt. Aber Mike dachte, er würde auch im Westen erfolgreich sein. Der wollte die Welt einreißen. Er konnte nicht mehr loslassen.«
Er mußte mit.