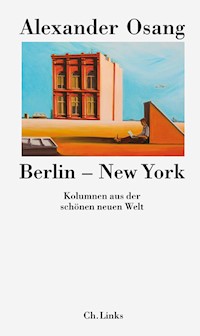
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Literarische Publizistik
- Sprache: Deutsch
Was verbindet den Washington Sniper, Raymond Chandler und Harald Juhnke? Leser der Kolumnen von Alexander Osang kennen die Antwort. Dass es im gleichen Text auch noch um das Verhältnis von Erde und Mond geht, wundert sie nicht. Osang denkt Dinge zusammen, die so niemand in Verbindung bringen würde. Er hat den Blick für die Skurrilitäten des Alltags, die ganz nebenbei Schlaglichter auf größere Zusammenhänge werfen. Die Macken seiner deutschen Landsleute werden, aus der Ferne betrachtet, liebenswert - oder noch unerträglicher. Der dreifache Kisch-Preisträger, der seit vier Jahren als »Spiegel«-Korrespondent in New York lebt, »beherrscht die Kunst, mit der Muschel das Meer zu erfassen, ganz gleich, ob er über Spiegeleier in Berlin-Prenzlauer Berg, eine Cocktailparty in der 42nd Street oder ein Motel in Kentucky schreibt« (BIZZ/Capital). Im neuen Kolumnen-Band sind die besten Texte der letzten drei Jahre versammelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Alexander Osang
Berlin – New York
Kolumnen aus der schönen neuen Welt
Die in diesem Buch versammelten Kolumnen aus dem Magazin der Berliner Zeitung sind zwischen September 2001 und Juni 2004 entstanden.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
1. Auflage als E-Book, Mai 2018entspricht der 1. Druckauflage vom September 2004© Christoph Links Verlag GmbHSchönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0www.christoph-links-verlag.de; [email protected]: KahaneDesign, Berlin,unter Verwendung eines Gemäldes von OL
eISBN 978-3-86284-423-4
Inhaltsverzeichnis
The World is not Enough
Manhattan
Casper
Totmacher
Unter Verdacht
Good Will Hunting
Dr. Dolittle
Quizshow
Forrest Gump
Speed
Der letzte Tycoon
Der Eismann
Cop Land
Zimmer mit Aussicht
Ein pikantes Geschenk
Im Reich der Sinne
Reds
Der Strohmann
I am Sam
Misfits
Das Fest
Die Stunde des Siegers
Home for the Holidays
Die Söhne der Großen Bärin
Denn sie wissen nicht, was sie tun
The Patriot
Der stille Amerikaner
In the Line of Fire
Good Bye, Lenin!
Die letzte Vorstellung
Der Untermieter
Der Feind in meinem Bett
Einer flog übers Kuckucksnest
Outbreak
Voll das Leben
Doktor Jekyll und Mister Hyde
Big
Naked Lunch
Trabi goes to Hollywood
Die Sunny Boys
The Perfect Storm
Tigerland
Matrix Reloaded
E. T.
Sweet November
Nachbarn
Ice Age
Manche mögen’s heiß
Menschen im Hotel
Leaving Las Vegas
Air Force One
Über den Autor
The World is not Enough
Ein Vorwort
Dieses Buch beginnt am 11. September 2001, dem Tag, an dem ich meine letzte Kolumne schrieb. Wenigstens dachte ich das damals. Ich nahm an, die Zeit für Kolumnen sei nun vorbei, und ich würde künftig Leitartikel schreiben müssen. Ich war in New York und hatte den Staub des World Trade Centers auf meinen Schultern. Die Welt sah auf diese Stadt. Alles schien so riesig, viel zu groß und zu schwer für die kleine, leichte Kolumne.
Ich schrieb in meiner letzten Kolumne: »Nichts wird mehr so sein, wie es war.« Ein Satz, der an diesem Tag oft gesprochen wurde. Heute will das natürlich keiner mehr wahrhaben, aber ich habe das wirklich gedacht. Als ich am Abend des 11. September zurück nach Brooklyn lief und in den kleinen Lebensmittelladen ging, neben dem ich am Morgen mein Auto geparkt hatte, hätte ich mir fast eine Schachtel Zigaretten gekauft. Ich hatte seit vier Jahren nicht mehr geraucht, aber vor acht Stunden war die Welt untergegangen, jetzt konnte ich eigentlich wieder anfangen. Wahrscheinlich begriff ich in diesem Moment, dass es doch weitergehen würde wie immer, denn ich kaufte mir statt Zigaretten zwei Äpfel und eine kleine Flasche Wasser.
Sieben Tage später schrieb ich dann auch wieder eine Kolumne. Und habe seitdem nicht damit aufgehört.
Natürlich war nichts mehr, wie es war, aber es blieb auch alles beim Alten.
Ich hatte Angst, mit der Subway zu fahren, und dachte eine Zeit lang ernsthaft daran, mir einen kleinen Fallschirm für die Aktentasche zu kaufen oder wenigstens eine Gasmaske. Ich habe auf dem Flug von Kuwait nach Frankfurt mal eine Stewardess darauf aufmerksam gemacht, dass mein Sitznachbar verdächtig lang auf der Toilette blieb, und musste bei der Einreise in New York zum ersten Mal in meinem Leben meine Fingerabdrücke hinterlassen. Bei Besuchen in Deutschland fragen mich Menschen jetzt nach der Lage im Nahen Osten. Jahrelang galt ich dort als Experte für die ostdeutsche Seele, inzwischen werde ich als Fachmann für amerikanische Außenpolitik eingeladen. Manchmal auch für beides zusammen. Kürzlich erreichte mich eine Anfrage für eine 3sat-Talkshow auf einem sächsischen Landschloss, wo ich zusammen mit Gesine Schwan, Daniel Cohn-Bendit und Hans-Dietrich Genscher über die Osterweiterung der EU diskutieren sollte. Es gibt nichts, von dem ich weniger Ahnung hätte. Ich war seit fünfzehn Jahren nicht in Tschechien, ich könnte nicht mal die neuen EU-Mitgliedsländer nennen. Aber die Redakteurin sagte, ich sei ein Topgast zum Thema Europa.
Warum?
Weil Sie in Amerika leben und aus dem Osten kommen, sagt sie.
Sowjetmacht plus Elektrizität ist Kommunismus, sagt Lenin. Ossi plus Nutella ist Nudossi, sagt Wiglaf Droste. USA plus Ostberliner ist Europäische Gemeinschaft, sagt 3sat.
Ein Jahr nach dem 11. September bin ich während der Fußball-Weltmeisterschaft drei Tage lang mit Franz Beckenbauer durch Japan gezogen. Beckenbauer hat fünf Jahre in New York gelebt, kann aber kaum fehlerfrei ein Gericht aus einer englischsprachigen Speisekarte bestellen. Er ist dennoch der internationalste Mensch, den ich jemals kennen gelernt habe. Beckenbauer empfindet die Welt, er analysiert sie nicht. Er war fast in allen Ländern Afrikas, er kann sich die Namen nicht merken, aber er fühlt, wo das Problem ist. Er nannte mich in Japan den »Halbchinesen vom Spiegel«, weil mein Name in seinen Ohren irgendwie asiatisch klang. »Halbkinese«, sagte Beckenbauer, und ich nahm es ihm nicht übel. Wahrscheinlich beschreibt mich das am besten.
Anderthalb Jahre nach dem 11. September bekam ich Hausverbot im UNO-Gebäude, weil ich mich dort mal mit abgelaufener Presseakkreditierung reingeschlichen hatte und anschließend solange mit einem dieser amerikanischen Wachpolizisten in UNO-Faschingsuniform diskutierte, dass er an seinem Pistolenhalfter nestelte. Ich habe verschiedene Anläufe unternommen, wieder in die Weltgemeinschaft aufgenommen zu werden. Ich habe mich entschuldigt, ich habe mich in aller Form entschuldigt, ich habe um Gnade gebettelt, aber es half nichts. Sie konnten den Krieg im Irak nicht verhindern, aber in meiner Frage bleibt die UNO hart. Während die Regierung meines Landes immer mehr an Stellenwert gewinnt, habe ich inzwischen bei den Vereinten Nationen ein Ansehen wie Kim Jong Il und Idi Amin.
Zwei Jahre nach dem 11. September fuhr ich in den Irak. Ich nahm keine schusssichere Weste mit, weil sie zu schwer war. Die Dame von der Hertz-Autovermietung in Kuwait City empfahl mir für die Reise ins Krisengebiet den größten Wagen ihrer Flotte, einen GM-Truck. Der amerikanische Fotograf, den ich in Basra traf, sagte, es sei selbstmörderisch, mit einem amerikanischen Geländewagen mit kuwaitischem Nummernschild in den Irak zu fahren. Ich stieg zu ihm und seinem Fahrer in einen 30 Jahre alten Nissan. Der Wagen hatte keine Klimaanlage, der Fahrer rauchte ununterbrochen und hatte auf jedem freien Platz einen gefüllten Reserve-Benzinkanister untergebracht. Ich kam mir vor wie Yves Montand in Lohn der Angst, aber der Fahrer dachte nicht an Explosionen. Er fürchtete nur die Dunkelheit. Wenn wir nicht vor Einbruch der Nacht zurück im Hotel seien, würden uns von Straßenräubern die Hände abgeschnitten, sagte er zwischen zwei Zigaretten immer wieder. Ich weiß nicht, ob das stimmte, aber manche Sachen muss ich nicht überprüfen. Der sicherste Platz im Irak schien also das Hotel in Basra zu sein, wo ich meinen GM-Truck untergestellt hatte. Der Mann an der Rezeption hatte eine Kalaschnikow unterm Tresen und hätte bei Zimmermangel ein paar Gäste erschießen können, ohne irgendwelche Konsequenzen befürchten zu müssen. Ich fühlte mich am wohlsten in der Gegenwart von britischen und amerikanischen Soldaten, vielleicht, weil sie hier so wenig verloren hatten wie ich. Sie waren meine Jungs, so falsch das jetzt klingen mag.
Ich bin nach dem 11. September viel in der Welt herumgefahren. Ich kann nicht sagen, dass ich große Zusammenhänge verstanden hätte. Ich habe festgestellt, dass sie in japanischen Hotels beheizbare Toilettenbrillen haben. In kubanischen Hotels habe ich mehr Amerikaner getroffen als sonst irgendwo auf der Welt, obwohl Amerikaner ja gar nicht nach Kuba reisen dürfen. Patty Smith hat mich gefragt, ob ich zusammen mit ihr an einer Aktion mitarbeiten möchte, bei der alle Menschen auf der Welt zur gleichen Zeit einen Schrei ausstoßen. Ich glaube, es war »Peace«. Wohl nicht »Fuck«.
Ich habe festgestellt, dass mein deutsches Handy in Kuwait, auf Guadeloupe, aber nicht im Irak und auf Kuba funktioniert, mein amerikanisches Handy geht auf den Bahamas, aber nicht im Monument Valley an der Grenze zwischen Arizona und Utah.
All diese Dinge passen nicht in Leitartikel, aber sie scheinen mir dennoch irgendwie Teil eines großen universellen Puzzles zu sein, das ich im Moment noch nicht zusammenbekomme.
Auch wenn man 50 Kolumnen zusammenfasst wie in diesem Buch, ergeben sie keinen übergreifenden Sinn. Das ist für einen Verleger natürlich schwer zu verkraften. Deswegen hat mein Verleger dieses Buch »Berlin – New York« genannt.
Ich habe eingeworfen, dass längst nicht alle Texte in Berlin und New York spielen, sondern auch in Pjöngjang, Eberswalde, Los Angeles, Havanna, Acapulco, Tokio und Kuwait City.
Mein Verleger sagte dann: »Es gibt jede Menge Orte zwischen New York und Berlin.«
Ich habe einen Moment überlegt, diese Diskussion weiterzuführen.
Wenn wir über den Atlantik gehen, passen Kuba, die Bahamas und Guadeloupe zwischen Berlin und New York. Gehen wir den Umweg über den Stillen Ozean, sind es ein paar mehr Länder. Wir hätten die Erdkugel hin und her drehen können wie Charlie Chaplin in Der große Diktator. Aber ich hatte keine Lust dazu. Es gab keinen Sinn.
Fast drei Jahre nach dem 11. September endet dieses Buch, am Tag, als Ronald Reagan starb.
Hätte ich vor 20 Jahren den FAZ-Fragebogen ausfüllen dürfen, hätte ich bei den Figuren, die ich historisch am meisten verachte, vielleicht Ronald Reagan statt Stalin hineingeschrieben. Jetzt ist er tot, und die ganze Welt liebt ihn. Auf einem der letzten Bilder, die ich von ihm im people-Magazin sah, sprang er auf einem weißen Pferd über ein Hindernis. Der Sternenkrieger ist der weiße Ritter. Michail Gorbatschow, vor 20 Jahren meine Hoffnung auf eine bessere Welt, rennt als bestellter Reagan-Grabredner durch Washington.
Manche Sachen werde ich nie verstehen.
Womöglich ist das die Klammer, die dieses Buch zusammenhält.
New York, im Juli 2004
Alexander Osang
Manhattan
Am Dienstagmorgen stand ich auf der Brooklyn Bridge, und die Zeit blieb stehen. Als sie wieder anfing zu laufen, war alles anders.
Ich lief von Brooklyn, wo ich lebe, nach Manhattan. Ich glaube, ich war der Einzige, der sich in diese Richtung bewegte, keine Ahnung, was ich dort wirklich suchte. Ich laufe immer erst mal los, weil ich weiß, dass sowieso tausend Gründe dagegensprechen. Die Brücke war voller Menschen, beide Türme brannten. Einige von den Leuten, die mir entgegenkamen, hatten bereits Staub auf ihren Anzügen, manche hielten sich Taschentücher vors Gesicht. Sie liefen zügig, aber nicht panisch. Sie unterhielten sich, sie fluchten. Es war schrecklich, aber ich glaube, die Welt war noch in den Fugen. Es sah immer noch so aus, als könne man alles reparieren.
Dann fiel der erste Turm des World Trade Centers zusammen.
Es war wie ein orangeroter Reißverschluss, der in der Mitte des Turmes aufgezogen wurde. Der Turm schien einen Moment ungläubig zu verharren wie ein angeschlagener Boxer, aber dann brach er doch zusammen, und es war nichts mehr da. Er war verschwunden. Er war einfach weg. Ich blieb stehen, auch die Leute, die mir entgegenkamen, blieben stehen. Sie schauten über ihre Schultern. Als sie wieder nach vorn schauten, hatten sie andere Gesichter. Sie weinten, sie schrien, sie rannten.
Ich hatte an diesem kurzen Morgen oft an einen Film gedacht. Der Tag hatte angefangen wie ein Katastrophenfilm, mit den lustigen bunten Morgenszenen in Brooklyn, mit gelben Schulbussen, fröhlichen Schülerlotsen, Männern mit Aktentaschen und einer kleinen schwarzen Wolke, die schnell wuchs. Ich denke mein ganzes Leben an Filme, wenn irgendwas Besonderes passiert. Aber in diesem Moment gingen mir die Filmbeispiele aus, ich stand auf der Brücke, und mir fiel kein Film mehr ein. Es gab nur noch früher und jetzt. Die Lücke, die der Turm riss, war riesig. Es würde nie mehr so sein wie früher.
Es war eine neue Zeit angebrochen.
Es gehörte zu den schönsten Momenten meines Lebens, von Brooklyn nach Manhattan zu fahren. Immer wieder könnte ich das tun. Es versöhnte mich mit der Stadt, wenn sie zu heiß war, zu laut und zu dreckig. Selbst die Subway kam auf dem Weg zu meiner Arbeit kurz hoch, um über die Manhattan Bridge zu poltern. Ich bekam gute Laune auf diesem kurzen hellen, gewaltigen Stück. Die Kraft dieser Stadt sieht man von hier am besten. Wenn wir nachts mit dem Taxi ins Theater fuhren, war ich so stolz, hier leben zu dürfen. Ich habe hier oft begriffen, warum New York so vielen Menschen Mut machte, ein neues Leben zu beginnen. Es war nicht umsonst das Erste, was sie sahen.
Es gab jetzt keine unschuldige Ankunft mehr.
Wir haben meinem Sohn die Stadt mit den beiden großen Türmen angepriesen, bevor wir hier vor zwei Jahren herzogen. Wir haben ihm Fotos gezeigt. Da darfst du wohnen. Du bist der König der Welt. An dem ersten Weihnachtsmorgen, den wir in New York verbrachten, als unsere Kinder ihre Freunde und ihre Großeltern vermissten, fuhren wir mit ihnen auf die Promenade nach Brooklyn Heights. Man kann von hier Manhattan am besten sehen. Wir wollten ihnen zeigen, dass sie auch was bekommen haben, etwas, für das es sich lohnt, so weit zu fahren. Es war ein eiskalter, klarer Morgen. Der Himmel war so hoch, wie er nur in New York ist. Von diesem Morgen an zeichnete mein Sohn die Skyline von Manhattan, es gibt Hunderte Zeichnungen von ihm mit den beiden Türmen. Es sind die Zeichnungen eines Kindes aus anderen Zeiten.
Mir fiel ein, dass ich nie oben auf der Plattform des World Trade Centers war. Es war vorbei.
Ich bin dann weitergegangen nach Manhattan, das schon ganz leer war, ganz weiß und ganz leise. Ein paar Minuten später brach der zweite Turm zusammen. Er hätte mich fast verschüttet, ich habe mit einem Dutzend Menschen in einem Keller gehockt wie im Krieg. Ich sah Leute bluten, jammern und schreien. Ich bin in eine Mondlandschaft zurückgekehrt. Es war furchtbar, aber der Moment auf der Brücke war der schlimmste Moment, weil er alles zeigte. Von da an ging es nicht mehr zurück.
Mein Bild ist kaputt.
Erst am Abend habe ich von Brooklyn Heights noch mal rübergeschaut auf Manhattan. Die stolze Insel rauchte, zahnlos wie eine alte Frau. Ich stand dort zwischen Menschen mit Atemmasken und Videokameras. Sie waren ruhig, aber am Leben.
Ich lief erst mal weiter.
Casper
Am vorigen Sonntag ging ich zur ersten Halloween-Party der Saison. Es war ein bisschen zu früh, aber das ist ja immer so.
Die Sonne schien, am Vormittag hatte ich bereits am traditionellen Spukspaziergang im Park teilgenommen. Leute aus unserem Viertel verkleiden sich als Gespenster, sie hocken zwischen Büschen. Einige sehen wirklich sehr erschreckend aus, weswegen freiwillige, unmaskierte Helfer am Eingang allen Kindern sagen, dass die Geister von ihnen ablassen, wenn sie deutlich die Finger kreuzen. Am furchtbarsten sahen jene Gespenster aus, die regungslos im Gras lagen, wie – man wagt es kaum auszusprechen – Opfer einer Biowaffenattacke. Manchen hingen falsche Schlangen aus dem Mund, ein Mädchen zappelte in einem Spinnennetz, eine alte Frau hielt ein totes Baby im Arm. Ältere Herren warteten wie halbtote Sexmonster im Unterholz. Sie schienen Spaß daran zu haben, man fragt sich, in welcher Nachbarschaft man eigentlich wohnt. Ich hatte die Finger in den Manteltaschen gekreuzt. Meine Tochter schrie hier und da. Glücklicherweise nahm auch unsere Freundin Deborah teil, sie führte eine Vampirgruppe an. Sie versuchte uns zu grüßen und für die anderen weiter ein ernst zu nehmender Vampir zu sein. Das ging nicht. Es gibt keine diplomatischen Gespenster, es gibt kein politisch korrektes Halloween.
Irgendwie beflügelte mich dieser Gedanke, als ich zwei Stunden später meinem Sohn für die erste Halloween-Party der Saison mit einer Faschingssprühdose die Haare rot färbte. Ich beschloss, mich auch ein bisschen aufzutakeln. Meine Frau schminkte sich gerade ihr Gesicht weiß. Als sie nach der grauen Hexenperücke suchte, griff ich mir den Schminkkasten. Meine Frau probierte verschiedene schwarze Kleider, ich entschied mich für den dunkelsten Lippenstift ihrer Sammlung und zog einen alten Anzug an.
Während meine Frau mir auf dem Balkon die Haare knallrot färbte, versicherte sie noch mal, dass bei Chris’ Halloween-Party im letzten Jahr alle verkleidet gewesen seien. Vielleicht wollte sie sich selbst Mut machen, denn am Ende sahen wir aus wie die Addams Family. Meine Frau bat mich, das Auto abzuholen, das nur eine Straße entfernt stand. Ich wurde nicht misstrauisch. Ich fuhr mit dem Wagen vor, meine Familie sprang hinein, als rette sie sich auf eine Insel. Es war eben die erste Party der Saison. Ich fühlte mich gut. Das änderte sich ein bisschen, als Chris die Tür aufmachte.
Der Gastgeber der Halloween-Party trug Kordhosen, ein kariertes Hemd und seine normale Brille. Er hatte nicht mal einen Hut auf. Nichts. Auch Beth, seine Frau, sah aus wie immer. Ein paar verkleidete Kinder schossen durchs Haus. Wir begegneten weiteren Erwachsenen in Jeans und T-Shirts. Sie sahen uns erstaunt an. Meine Frau verschwand kurz, um die Mäntel aufzuhängen, wie sie sagte. Als sie wiederkam, hatte sie auch ihre graue Hexenperücke abgelegt. Es war eine Kinderparty, aber ich war mehr verkleidet als alle anwesenden Kinder. Ich hätte die Wahl zum schönsten Kostüm gewonnen, ich war ein ehrgeiziger Erwachsener, der Siebenjährige beim Sackhüpfen schlagen will. Auch meine Frau sah mich jetzt belustigt an, sie wechselte die Seiten. Sie ging immer wieder mal raus und verlor jedes Mal mehr Schminke. Nur ich hockte mit brennender Frisur und schwarzen Lippen in der Küche, wo die Erwachsenen jetzt ernsthafte Gespräche begannen. Beth brachte Häppchen, meine Frau diskutierte mit einem lesbischen Paar über Schulpolitik, ich stand bei den Männern, ein Bier in der Hand, eine Tunte auf einem Harley-Davidson-Treffen. Chris holte die Fotos von »Ground Zero«, die er aus seinem Bürofenster gemacht hatte, er arbeitet direkt neben dem World Trade Center. Sie mussten evakuiert werden. Die Bilder sahen schrecklich aus. Er erzählte noch mal seine Geschichte vom 11. September und von einem befreundeten Polizisten, der immernoch um sein Leben kämpfte.
Es war, als wolle er mich demütigen. Aber vielleicht wusste er einfach nicht, dass ich auch noch da war. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass meine Frau und das lesbische Paar nun über mich redeten. Eine sagte, ich erinnere sie an David Bowie. Sie lachten, als rechneten sie nicht mehr damit, dass ich sie höre. Mein Sohn sah mich traurig an, so wie der kleine Junge in The Sixth Sense die Toten ansieht. Wahrscheinlich würden alle in meiner Nähe gleich Atemwolken ausstoßen. Ich war ein Geist.
Es hatte funktioniert.
Totmacher
Vor einem Monat lud man mich zu einer Talkshow zum Thema Tod ein. Die Talkshow wurde aus einem Ludwigsburger Barockschlösschen vom SWR aufgezeichnet. Der exakte Titel lautete »Tod und Sterben – Vom Umgang mit einem Tabu«. Es war mir nicht sofort klar, warum sie mich dazu einluden. Ein anderer Gast sollte die todkranke Regine Hildebrandt sein. Ich habe vor Jahren mal mit Regine Hildebrandt in einer Talkrunde gesessen, die ich total versaut habe. Ich konnte die erste Frage nicht richtig beantworten, danach wurde ich nie wieder was gefragt. Erst neulich hat mir Gregor Gysi erklärt, dass es gar nicht um die Fragen geht. Man müsse sich nur darauf konzentrieren, was man rüberbringen will. Ich wusste nicht so richtig, was ich zum Thema Tod rüberbringen wollte, aber ich hätte gerne wieder mal mit Regine Hildebrandt in einer Talkshow gesessen. Außerdem bezahlten sie den Flug aus New York, und Barockschlösschen klang auch ganz vielversprechend.
Ich sagte schnell zu.
Ein paar Tage später rief mich eine Redakteurin der Talkshow an. Sie müsste etwa zwanzig Minuten mit mir sprechen, um festzustellen, ob ich für die Sendung geeignet sei. Sie stelle jetzt mal das Telefon auf Mithören. Es waren offenbar noch andere Leute im Raum, irgendwo in Stuttgart am Nachmittag. Ich saß in New York am Morgen und schaute auf einen bunten Laubbaum. Ich hatte zwanzig Minuten, um ein paar ARD-Redakteure davon zu überzeugen, dass ich ein guter Gast zum Thema Tod war.
Ich habe ihnen vom 11. September in New York erzählt und davon, wie drei Tage später die Schuldirektorin in die Klasse meines Sohnes kam, um den Kindern mitzuteilen, dass ihre Klassenkameradin Chloe jetzt keinen Vater mehr hat. Ich habe von einer jungen Witwe aus der Upper East Side erzählt, die mir immer wieder die letzte Nachricht vorspielte, die ihr Mann aus dem brennenden Nordturm auf ihren Anrufbeantworter sprach. Sie saß auf dem Sofa, spulte zurück, dann hörte man ihren Mann schreien, dass er sie liebe und überall Feuer sei. Dann spulte sie wieder zurück. Sie war im fünften Monat schwanger, von dem Mann auf dem kleinen Tonband. Irgendwann fiel mir auch das Interview ein, dass ich vor fünfeinhalb Jahren mit der sterbenden Sängerin Tamara Danz geführt hatte. Ich erzählte den Redakteuren in Stuttgart, wie wir den Tod ausgeklammert hatten, obwohl er der Anlass des Interviews war.
Ich redete eine Stunde lang über den Tod. Ich war ein überraschend guter Kandidat für ihre Show.
Am Ende sagte die Redakteurin, dass sie sich jetzt zur Beratung zurückzögen. In 14 Tagen würde mich dann noch der Moderator der Show anrufen, um mit mir zu reden. Dann würden sie ein endgültiges Urteil fällen.
In den zwei Wochen, die mir noch blieben, habe ich mit zwölf Leuten geredet, die aus dem Nordturm fliehen konnten. Manche haben Kollegen verloren, manche Familienmitglieder. Ich war auf zwei Beerdigungen. Ich bereitete mich auf eine Talkshowrolle vor.





























