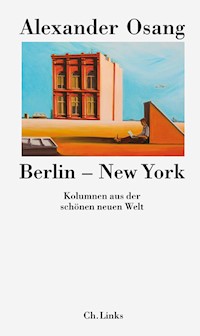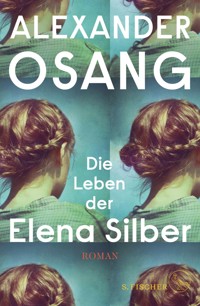8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Andreas Hermann, Anfang 40, hat die erste Hälfte seines Lebens im Osten Deutschlands verbracht. Nach der Wende beruflich vielfach gescheitert, lebt er in einer winzigen Wohnung in Berlin, Prenzlauer Berg, und arbeitet als Ein-Euro-Jobber an einem Kulturprogramm zum 20. Jahrestag des Mauerfalls. Ausgerechnet mit einer Gruppe arbeitsloser Intellektueller soll er die Ereignisse des Jahres 1989 nachspielen. Andreas Hermanns Beschäftigungsagentur grenzt an eine Siedlung weißer Townhäuser, die am Königstor für wohlhabende Bewohner errichtet wurde. Dort lebt Ulrike Beerenstein, die in einem der vielen neuen Ladenbüros der Stadt arbeitet. Jeden Morgen beobachtet sie Andreas Hermann von ihrem Fenster aus. Als ihr Mann zu einer Dienstreise aufbricht, beginnen sie eine Affäre: Andreas Hermann betritt das weiße Townhouse wie eine neue Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Alexander Osang
»Königstorkinder«
Roman
Über dieses Buch
Andreas Hermann, Anfang 40, hat die erste Hälfte seines Lebens im Osten Deutschlands verbracht. Nach der Wende beruflich vielfach gescheitert, lebt er in einer winzigen Wohnung in Berlin, Prenzlauer Berg, und arbeitet als Ein-Euro-Jobber an einem Kulturprogramm zum 20. Jahrestag des Mauerfalls. Ausgerechnet mit einer Gruppe arbeitsloser Intellektueller soll er die Ereignisse des Jahres 1989 nachspielen.
Andreas Hermanns Beschäftigungsagentur grenzt an eine Siedlung weißer Townhäuser, die am Königstor für wohlhabende Bewohner errichtet wurde. Dort lebt Ulrike Beerenstein, die in einem der vielen neuen Ladenbüros der Stadt arbeitet. Jeden Morgen beobachtet sie Andreas Hermann von ihrem Fenster aus. Als ihr Mann zu einer Dienstreise aufbricht, beginnen sie eine Affäre: Andreas Hermann betritt das weiße Townhouse wie eine neue Welt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Coverabbildung: Andreas Labes
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2010
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401066-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Für einen alten Freund
If I were the [...]
Die Sonne scheint auf [...]
Traumfabrik
Mars«, sagt der Arzt. [...]
Märchenbrunnen
Ich nehme an, das [...]
Flaschengeister
Sie haben sie nicht [...]
Totentanz
Der Arzt lächelt, so [...]
Mäusejagd
Für einen alten Freund
If I were the man you wanted,
I would not be the man that I am
Lyle Lovett
Die Sonne scheint auf die hohe Stirn des Arztes, der vor der Einstiegsluke des Raumschiffes steht. Draußen vor dem Charité-Hochhaus stampfen und kreischen Baugeräte. Das ist die schlimmste Kombination in der Stadt, Sonne und Baulärm. Es hört nie auf, es dreht sich immer weiter. Überall Bilder, Risse, Figuren, aber kein System, kein Muster. Kein Zipfel, kein Anfang, wo man in die Geschichte schlüpfen könnte wie in ein Bett. Bett. Meine Lider werden schwer, aber ich muss noch einen Moment wach bleiben.
Dieses eine Projekt noch, dieses eine Projekt. Dann habe ich Ruhe. So geht das natürlich schon seit Jahren, aber diesmal werde ich wirklich nur stillliegen. Nur liegen. Sie wollen hier herausfinden, was mit unseren Körpern passiert, wenn wir ins All fliegen. Zum Mars. Sie nennen es Marsflugexperiment, aber natürlich ist es ein Projekt. Es dauert drei Monate, wie fast alle meine Projekte. Es scheint die Dosis zu sein, auf die sie sich geeinigt haben. Die Infusion, die ich brauche. Und ich brauche sie. Schlaflabor, das klingt wie das Paradies. Es geht nur um den Körper, nicht um den Kopf. Ich bin ihr Mann, auch wenn sie das noch nicht wissen. Ich bin ihr Mann.
Der Arzt, der zwischen mir und dem Marsflug steht, ist bestimmt zehn Jahre jünger als ich. So läuft das jetzt. Menschen, die nicht einmal eingeschult waren, als ich in die zehnte Klasse gegangen bin, stellen die Weichen für mein Leben. Dahin geht die Reise am Ende natürlich immer. Rentner werden von Leuten herumkommandiert, die mit der Trommel um den Weihnachtsbaum liefen, als sie bereits Häuser bauten. Die noch Quark im Schaufenster waren, als sie schon ihre Doktorarbeiten geschrieben haben.
Der Patientenstuhl liegt etwas tiefer als der von meinem Arzt, wahrscheinlich um seine Autorität zu erhöhen. Der Mann hat zwar weitaus weniger Haare auf dem Kopf als ich, aber damit kann man sich nicht ewig trösten.
»Die Leberwerte«, sagt er und reibt mit einem behaarten Finger auf dem Blatt mit den Laborergebnissen herum. Ein Teufelsfinger ist das, wahrscheinlich steht ein Pferdefuß unterm Schreibtisch. Quark im Schaufenster, so wurde das doch damals genannt. Quark im Schaufenster. Die Trommel und der Weihnachtsbaum, ehrlich mal.
Der verdammte Lärm da draußen macht mich noch wahnsinnig. Wenn sich wenigstens eine Wolke vor die Sonne schieben würde.
»Der GGT -Wert hier, der ist höher, als er sein sollte«, sagt der Arzt. Er hat einen Akzent, schwäbisch oder sächsisch, ich kann das nicht genau unterscheiden, aber es ist auch egal. Es ist seine Welt, nicht meine, das ist alles, was im Moment zählt.
» GGT -Wert«, sage ich. An meinem Hemd kleben noch ein paar Ascheflocken. Ich wage nicht, sie wegzureiben.
»Ein sensibler Wert«, sagt der Arzt.
»Sensibel bin ich auch«, sage ich und deute ein Lächeln an.
»Schon klar, schon klar«, sagt der Arzt zerstreut. »Es könnte sein, dass Sie eine Erkältung hatten oder vielleicht ein, zwei Glas Bier zu viel am Abend vorm Blutabnehmen. Oder Wein … Wein. Für eine Gelbsucht sind die Werte eigentlich zu gering. Nehmen Sie Drogen?«
»Was für Drogen?«
»Das weiß ich doch nicht.«
»Sagen wir, es war eine Erkältung«, sage ich. Mir fallen die vielen Fluctine ein, die mir Dr.Brock verschrieben hat, aber damit will ich jetzt nicht anfangen, so kurz vorm Ziel. Noch ein Doktor würde diesen hier nur verunsichern, zu viele Köche verderben den Brei. So sagt man doch. Die Asche auf meinem Hemd irritiert mich, sie lenkt mich von meiner Weltraummission ab, das ist nicht gut.
»Und dann sind Sie ja auch schon 42 … 42«, sagt der Arzt, und dann noch mal: »42«, als wolle er mich quälen. Aber er will nur älter und ernsthafter wirken, als er ist, glaube ich. Er erinnert mich an meinen Chefredakteur Horst, der sich auch immer wiederholte. Erst: Die tschechischen Genossen, die tschechischen Genossen, die tschechischen Genossen sind unsere Freunde. Und später: Wir verlieren Auflage. Auflage. Auflage. Horst war 60, vielleicht 70, was weiß ich. Irgendwann fängt man eben an, jeden zweiten Satz mit einem »nicht wahr« zu beenden, zu große Brillen aufzusetzen, die Hosen überm Bauch zu tragen und sich ständig zu wiederholen.
»Leider«, sage ich und habe ein weiteres »leider« auf den Lippen, und dann noch eins, eine unendliche Leiderkette hängt an meinem Hals und zieht mich nach unten.
»Eigentlich sollten sich ja Kandidaten zwischen 25 und 40 für das Experiment bewerben«, sagt der Arzt.
»Schon klar, aber was passiert mit all den alten, erfahrenen Menschen? Müssen die auf der Erde bleiben, wenn wir losfliegen?«, frage ich.
Der Arzt schaut ernst, wahrscheinlich zählt er mich in diesem Moment schon dazu, zum Heer der älteren, erfahrenen Menschen, das es nicht mehr schafft bis zum Mars. Ich hab das selbst ins Spiel gebracht, sicher, aber so war das nicht gemeint. Ich bin doch noch ein Junge, ich suche doch noch, ich will mich nur ein bisschen ausruhen.
»Ich könnte Ihr Kapitän sein«, sage ich.
»Kapitän«, sagt der Arzt und reibt weiter auf meinen Leberwerten herum, vermutlich hat er diesen Flug nie so konkret vor Augen gehabt. Ich schon.
»Ja, alt genug wär ich.«
»Captain Kirk, was?«, sagt er, und seine Miene hellt sich plötzlich auf. »Sie machen uns unseren Commander Kirk.«
Ich nicke. Er ist doch eher Schwabe als Sachse, glaube ich, so wie er Commander Kirk ausspricht, das klingt eindeutig schwäbisch, und es passt auch besser. Wahrscheinlich wohnt er ganz bei mir in der Nähe, Vorderhaus allerdings und auch weiter oben oder unten, Dachgeschoss oder Beletage, je nachdem, was ihm wichtiger ist, Blick oder Deckenhöhe. Zwei-, dreimal im Jahr kommen seine Eltern, Steppjacken, gutes, festes Schuhwerk, sorglose Haut im Gesicht, und er erklärt ihnen den Prenzlauer Berg, die Möglichkeiten, das Unberührte, die Vielfältigkeit. Die Eltern tragen karierte Mützen und Schals, dezent kariert, Braun- und Rottöne, ihre GGT -Werte sind in Ordnung, ein Glas Rotwein am Abend, höchstens zwei, aber guter.
»Jaja«, sagt der Arzt und wird schnell wieder ernst, weil er hier nicht der Clown ist, sondern der Doktor.
Er trägt eine randlose Brille, deren linkes Glas verschmiert ist. Sie erinnert mich an die Brille von Mareike Kleinschmidt aus meiner zweiten Klasse, ihr linkes Glas war immer mit weißer Folie abgeklebt, vermutlich weil Mareike schielte. Das machen sie sicher heute auch nicht mehr, dieses Abkleben. Schielewipp, der Käse kippt, sagten wir. Schlimm genug. Mareike Kleinschmidt ist weggezogen, als wir in die dritte Klasse kamen. Keine Ahnung, was danach aus ihr wurde, vielleicht ist sie tot. Für mich fängt sicher auch bald die Lesebrillenzeit an.
»Und warum wollen Sie an dem Experiment teilnehmen?«, fragt der Arzt.
Ich schaue in die sonnenbestrahlten Schlieren auf dem linken Brillenglas meines Gegenübers wie in die Milchstraße. Hätte ich Angst dort draußen im All, in der Dunkelheit, der Kälte, der Stille?
»Ja?«, fragt der Arzt.
»Ich möchte dieser Welt entfliehen«, sage ich und weiß natürlich sofort, dass das klingt wie aus einem Schlagertext, aber scheiß drauf. Es stimmt ja. Ich werde in die Unendlichkeit fallen wie in eine weiches Bett. Ich werde lächelnd zusehen, wie sich die Erde unter mir im All auflöst und mit ihr dieses verdammte Berlin, das nie aufhört sich zu drehen. Überall Baustellen, Straße auf, Straße zu, Straße auf, ohne erkennbaren Grund. Wunden, die nie heilen. Ich habe ein Leben lang in die Stadt geschaut wie in ein Hamsterrad und bin dabei immer langsamer geworden. Einfach liegen bleiben, das will ich. All die Helmfrisuren, die eckigen Brillen, die Trainingsjacken, die gerade noch altmodisch waren und in diesem Moment wahrscheinlich schon wieder altmodisch sind, die bescheuerten Ostmopeds, die ich vor zwanzig Jahren nicht mal mit dem Arsch angeguckt hätte, ist doch wahr. Die Bars, die zumachen, bevor ich überhaupt von ihnen gehört habe. Dinge, auf die sich Menschen hinter meinem Rücken einigen, Hertha BSC . All das werde ich hinter mir lassen im All, ich werde so viel Spielraum haben wie nie, unendlich viel Spielraum.
Ich würde die Asche auf meinem Hemd gern loswerden, ohne sie abzuklopfen.
»Der Welt entfliehen … entfliehen«, sagt der Arzt. »Entfliehen. Aber warum?«
»Eine lange Geschichte.«
»Ich habe Zeit«, sagt der Arzt, nimmt seine verschmierte Brille ab, legt sie auf den Zettel mit meinen Blutwerten, reibt sich die Augen und lässt sich in seinen Stuhl zurückfallen, als sei er bereit für eine Geschichte, wie lang auch immer sie ist. Vielleicht fliegt er ja mit. Wenn ich Captain Kirk bin, ist er vielleicht Pille auf unserem Flug durchs All, Pille, der Borddoktor.
Samstagnachmittage in den verdammten 70 ern. Enterprise, Daktari, Tarzan, denke ich, aber es gibt nur einen Fernseher, auf dem mein Vater die bescheuerte Sportschau sehen will, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, es geht immer weiter. Immer weiter.
Ich frage mich, wie lang die Geschichte wirklich ist. Ich hatte in meinem Leben oft Probleme, einen Anfang zu finden, den richtigen Ausschnitt zu wählen. Ich habe Schwierigkeiten, das Wesentliche im Chaos der Erscheinungen zu erkennen, das Allgemeine aus dem Meer des Einzelnen zu fischen, wie Professor Kranepuhl immer gesagt hat, mein Lehrer in dialektischem und historischem Materialismus, DhM. Ich glaub bis heute, dass ich es deswegen nie geschafft habe, mich aus dem Alltag herauszuwühlen. Kranepuhl hatte recht, ein Mann, der einen Vollbart trug, aber nach Rasierwasser roch und mal eine Vorlesung mit offener Hose hielt, anderthalb Stunden lang Hegel mit offener Hose. Ich gehe im Einzelnen verloren, ich ertrinke in der Flut der Erscheinungen.
Aber nicht jetzt, nicht jetzt bitte. Die Asche auf meinem Arm macht mich völlig fertig, ich will sie loswerden, darf mich aber nicht von ihr trennen. Sie gehört zu meiner Geschichte, ich brauche sie noch, später. Asche zu Asche, so sagt man doch.
Auf der Stirnglatze des Arztes fängt sich die weiße Berliner Sonne. Hoffentlich erkenne ich dieses eine Mal, wo das Wesentliche liegt und wo das Allgemeine, hoffentlich. Es ist wohl kein Zufall, dass die Maschinen dort draußen für einen Moment schweigen. Wenn sie denn schweigen, vielleicht verliere ich auch nur das Bewusstsein.
»Können Sie die Jalousien schließen, bitte«, frage ich den Arzt.
»Sicher«, sagt er, nimmt eine kleine, graue Fernbedienung von seinem Schreibtisch und lässt damit die Lamellen zu einer Wand zusammensurren. Ich bin erschöpft. Es ist die letzte Geschichte vorm Einschlafen.
Traumfabrik
Andreas Hermann war eine Zigarettenlänge zu früh da, um die Wohnung des toten Professors leer zu räumen, und genauso hatte er es gern. Es gab ihm Spielraum.
Er klappte das kleine, mit schwarzem Leder bespannte Zigarettenetui auf, das er sich vor fünfzehn Jahren in London gekauft hatte, wo er für einen Job bei Eurosport vorgesprochen hatte, und entnahm ihm die zweite Zigarette des Tages. Er steckte sie sich mit dem schmalen, mattschwarzen Zippofeuerzeug an – ein Geschenk von Bernhard zum 35. Geburtstag – und sah die Rietzestraße hinunter. Es war dienstagmorgens, kurz vor sieben, es war nicht viel los auf der Rietzestraße. Zwei Häuser weiter stand eine alte Frau mit einem Hund vor einem Fenster im Parterre, aus dem eine andere alte Frau schaute, am Ende der Straße bewegte sich ein orangefarbener Müllwagen. Die Rietzestraße war nur kurz und bestand aus Häusern, die seine Mutter Hitlerbauten genannt hätte. Vierstöckige grüngraue Gebäude mit winzigen Fenstern, die ihn ein bisschen deprimierten. Es gab keine Bäume in der Rietzestraße, und so konnte man nicht sehen, dass der Mai begonnen hatte. Es gab auch keine Geschäfte. Als er hierher gelaufen war, hatte er im Erdgeschoss eines der Häuser einen älteren Mann gesehen, der im Halbdunkel langsam auf einem Bürostuhl zwischen drei altmodischen Computermonitoren hin und her rollte wie der Keyboarder einer Bombastrockband. Der Mann war sicher an irgendeinem nutzlosen Projekt beteiligt wie er selbst. Andreas Hermann schnippte seine Kippe auf den Bürgersteig, als Kowalski, den alle nur Captain nannten, mit seinem alten Damenrad um die Ecke bog und Andreas Hermanns Spielraum beendete.
»Scheißkalt«, sagte Kowalski, und Andreas Hermann nickte, obwohl ihm eigentlich nicht besonders kalt war. Er glaubte auch nicht, dass Kowalski fror, so verschwitzt im Gesicht wie der war. Es war nur eine Bemerkung, um ein bisschen in Schwung zu kommen.
Kowalski stellte sein Damenrad an die Hauswand, schloss es an und kramte eine Schachtel F6 aus seiner Anoraktasche. Andreas Hermann klappte sein Etui auf, entnahm ihm die dritte Zigarette des Tages. Sie rauchten erst mal eine und warteten auf den Lieferwagen.
»Bücher, bis zum Abwinken«, sagte Kowalski.
»Wofür war der eigentlich Professor, Captain?«, fragte Andreas Hermann.
»Pfff«, machte Kowalski, was natürlich viel heißen konnte, vermutlich aber, dass er es auch nicht wusste.
»Den janzen Brecht hab ick mir gestern schon mal aussortiert«, sagte Kowalski, um wieder ein bisschen in die Offensive zu kommen. Er inspizierte die Wohnungen, die das Projekt »Stattumzug« leer räumte, immer im Voraus.
»Mit Brecht machst du nie einen Fehler«, sagte Andreas Hermann, nicht, weil er das meinte, sondern weil er Kowalski bei Laune halten wollte und damit sich selbst.
»Meine Rede«, sagte Kowalski und lächelte, als habe er in ihm einen Geistesverwandten gefunden, zwischen all den Idioten ihrer Projektagentur.
Und das genau war seine Rolle hier, dachte Andreas Herrmann. Er spielte den Geistesverwandten von Kowalski zwischen den Idioten der Projektagentur.
Kowalski war zehn Jahre lang Brotfahrer im Berliner Backwarenkombinat Bako gewesen, und dann noch mal fünf Jahre Dispatcher, was danach passiert war, hielt er im Ungefähren. Er hatte sich, vermutlich aus seinen Dispatcherjahren, eine gewisse Autorität bewahrt. Deshalb nannten sie ihn bei »Stattumzug« den Captain und auch, weil er gelegentlich einen Begriff aus einer Seeschlacht des Zweiten Weltkriegs einstreute. »Totale Torpedokrise«, sagte Kowalski oder auch »Unternehmen Paukenschlag, wa?« oder »Dit war jetzt ’n Kreisläufer, wie bei olle Jünther Priem«. Sie nannten ihn den Captain, aber er sah aus wie jemand, der hier in der Rietzestraße wohnen könnte. Er war Mitte fünfzig, hatte ein verschwollenes, gelbes Gesicht, einen kleinen Bauch, unter dem er das immergleiche Paar schwarze Wrangler trug und darüber einen dunkelblauen Anorak. Auf dem Kopf hatte Kowalski eine Helmut-Schmidt-Mütze, die er nie abnahm, auch nicht im Kabuff der »Stattumzug«-Besatzung, wo nun wirklich gut geheizt war.
Andreas Hermann lächelte zurück. Er wusste, dass sie die Brechtdiskussion nicht vertiefen würden und war froh darüber. Er hatte Brecht nie gemocht und auch nicht richtig verstanden, und wahrscheinlich hing das eine mit dem anderen zusammen. Paula war eine Brechtliebhaberin gewesen, und es war kein Zufall, dass sie in Wirklichkeit gar nicht Paula hieß, sondern Petra. Sie hatte sich den Namen zugelegt wie Brecht seine chinesischen Uniformen, dachte Andreas Hermann, sie waren Rechthaber gewesen alle beide, Brecht und Paula, Aufdreher und Besserwisser, seine Gedanken verquirlten sich. Brecht und Paula verspannten ihn nur, das konnte er jetzt ganz und gar nicht gebrauchen. Er schaute auf Kowalskis Anorak wie in einen dunklen, kühlen Waldsee. Bestimmt ging auch der Captain nicht mit einem Lyrikband von Brecht ins Bett. Brecht war nur ein Wort an diesem Maimorgen, an dem sich der Captain ein bisschen wärmte, bis Bernd und Olli mit dem Lieferwagen kamen. Neulich hatte Kowalski erwähnt, dass er »’n Sack voll alte Russen« sichergestellt hatte, »Puschkin und allet«, hatte er gesagt. Und jetzt eben Brecht, warum nicht.
»Iss aber noch jenug für dich da, Andi«, sagte Kowalski. »Schönet Regal och.«
»Super, Captain«, sagte Andreas Hermann, der kein Regal brauchte und auch kein Buch. Er las seit zehn Jahren keine Bücher mehr. Das, was er bis dahin gelesen hatte, das, woran er sich erinnerte, und das, was er täglich erlebte, füllte seinen Kopf bis zum Rand, und er hatte auch keinen Platz für Regale. In seiner winzigen Wohnung war nicht mal Raum für ein Bett. Er hatte das Hochbett des Vormieters übernommen. Er war 42 Jahre alt und schlief auf einem IKEA-Hochbett, an der Seite war noch der Aufkleber des Kindes, das vor seinem Vormieter in diesem Bett gelegen hatte. Ein Krokodil in einer gestreiften Hose, das man nicht mehr abbekam. 150 Euro Abstand hatte sein Vormieter für das Bett verlangt, das neu 175 gekostet hatte. Er kam aus Baden-Württemberg und hatte nicht gehandelt. Es gab sehr wenige Wohnungen im Prenzlauer Berg, die nur 260 Euro kosteten, und Andreas Hermann klammerte sich an diesem Bezirk fest wie an einem Schiffsmast, er wollte nicht in eines der Meere fallen, die dort draußen tobten, Hellersdorf oder Lichtenberg oder Moabit oder Tempelhof. All das wusste Kowalski natürlich nicht oder wollte es nicht wissen, vor zwei Wochen hatte er ihm mal einen Esstisch mit zwölf Stühlen angeboten.
»Stattumzug« war ein öffentliches Projekt, aber Kowalski hatte sich darin ein kleines, eigenes Projekt geschaffen, das keinen Namen trug. In einer Ecke des Ladenbüros, in dem die Gruppe ihre Entrümpelungen plante, hatte Kowalski einen Vorhang gespannt, hinter dem er die Sonderstücke seiner Inspektionen aufbewahrte. Manchmal kam ein Interessent vorbei und verschwand mit Kowalski hinterm Vorhang. Er hielt dort keine Wertsachen versteckt. Die Leute, deren Wohnungen »Stattumzug« leer räumte, waren eher so wie sie selbst.
Andreas Hermann fragte sich, was aus seinem Besitz es hinter Kowalskis Vorhang schaffen könnte. Für seine beiden Lieblingshemden von Paul Smith und agnès b. oder die Wildlederjacke von Givenchy hatte der Captain sicher kein Auge. Seine Pappmöbel würde er für Müll halten. Bestimmt interessierten ihn das Londoner Zigarettenetui, das Zippofeuerzeug und die schmale Digitalkamera, die sich Andreas Hermann vor zwei oder drei Jahren mal in einer seiner hellen, emsigen Phasen angeschafft hatte, als er dachte, der FC Bayern München würde seine Daumenkinoidee kaufen. Der FC Bayern hatte sich dann nie gemeldet, vermutlich wurde damals gleich ein Öffentlichkeitsarbeiter damit beauftragt, Andreas Hermanns Plan zu verwirklichen, und in diesem Moment wurden gerade Zehntausende Daumenkinos mit den schönsten Toren des FC Bayern München hergestellt. Ein Riesengewinn, geschöpft aus seiner Idee, aber auch daran wollte er nicht denken, weil ihn Gedanken an seine Erfindungen genau wie die an Paula oder an Brecht in die Tiefe zogen, aus der er erst vor zweieinhalb Monaten aufgetaucht war, als der Frühling begann und die »Einschleichzeit der Fluctine« endete, wie es Dr.Brock vom Potsdamer Platz nannte.
Andreas Hermann war eigentlich ganz zufrieden, jetzt, da der Tag noch nicht richtig begonnen hatte. Alles lag vor ihnen oder doch vieles, dort oben in der Wohnung des toten Professors und auch sonst. Es war Frühling, und es war morgens. Die Welt war überschaubar, wenn man sie von der Rietzestraße aus betrachtete. Er schnippte seine Kippe auf den Fußweg, fast genau in dem Moment, als der »Stattumzug«-Lieferwagen mit Olli und Bernd um die Ecke bog.
Der Professor hatte im ersten Stock gewohnt. Sie klingelten, eine alte, dicke Frau in einer braunen Strickjacke öffnete die Tür. Die Witwe, dachte Andreas Hermann, aber die Wohnung sah eigentlich nicht so aus, als hätten dort zwei Menschen reingepasst. Es gab eine winzige Diele, von der aus man alles überblicken konnte. Eine kleine Küche, ein fensterloses Klo, ein Wohnzimmer mit Couch, Couchtisch und Schrankwand sowie ein Zimmer, in dem ein schmales Bett stand und ein Schreibtisch, den seine Mutter gutes, altes Hellerau genannt hätte. Die »Stattumzug«-Crew lief ins Wohnzimmer, Andreas Hermann blieb einen Moment im Flur stehen und folgte dann der Frau in das Schlafzimmer, weil da einfach mehr Platz war.
»Ick hol bloß ein paar Diplomarbeiten«, sagte sie.
»Ach so«, sagte Andreas Hermann.
»Auf der Beerdigung waren ein paar seiner Studenten, und die haben sich für die Arbeiten interessiert«, sagte sie.
»Klar«, sagte er und sah der Frau zu, die ein paar sperrige graue Pappordner, die sich auf dem Schreibtisch stapelten, in eine Plastetüte stopfte.
Hellerau hin und her, der Schreibtisch sah gut aus. Es war ein schmaler Schreibtisch mit schlanken Beinen, der vielleicht unter sein Hochbett passte. Es war nicht so, dass er einen Schreibtisch gebraucht hätte, aber der hier sah wirklich gut aus. Er sah nicht so nach Arbeit aus. Er würde seiner Mutter gefallen, dachte Andreas Hermann, auch wenn das nicht so wichtig war. Seine Mutter kam nicht nach Berlin, aus politischen und privaten Gründen, wie sie behauptete, und weil es in Berlin früher immer H-Milch gegeben hatte, in Neustrelitz aber nur selten.
»Wann war denn die Beerdigung?«, fragte er.
»Na, gestern«, sagte die Frau.
»Richtig«, sagte er. Es war ihm ein bisschen peinlich, in der Wohnung eines Mannes herumzustehen, der gerade erst begraben worden war.
»Sind Sie eine Verwandte?«, fragte er.
»Nee, nee. Eine Nachbarin. Ich hab mich ein bisschen um ihn gekümmert, zum Schluss, als es ihm so schlechtging. Ich kenn’ ihn ja schon seit dreißig Jahren, nee, fünfunddreißig, Wahnsinn«, sagte sie.
»Ach so«, sagte Andreas Hermann wieder.
»Nicht wat Sie denken«, sagte die Frau, obwohl er eigentlich gar nichts gedacht hatte. »Der Professor stand mehr auf Männer. Sein Freund wohnt zwei Aufgänge weiter, aber der hatte im vorigen Jahr nen schweren Schlaganfall.«
Die Frau hatte jetzt etwa vier Aktendeckel in der Tüte, mehr gingen nicht rein, dachte Andreas Hermann, aber sie versuchte es trotzdem, und so fiel eine der Mappen auf den Fußboden. Er hob sie auf, klopfte sie ab und schlug den Pappdeckel zurück. Die blassblaue, leicht ausfransende Schrift erinnerte ihn an die Vordrucke seiner Schulzeit, die oft nach Alkohol gerochen hatten. Er musste sich regelrecht zwingen, nicht an dem alten Papier zu schnüffeln. Die Arbeit war aus dem Jahr 1983. Der Titel lautete: »Das Rechtssystem der Vereinigten Staaten von Amerika.« Wahrscheinlich wurde bereits auf der ersten Seite Lenin mit Foucault verknüpft. Er klappte die Mappe wieder zu und gab sie der Frau, die erneut versuchte, sie in die Tüte zu stopfen.
»Er hat Recht unterrichtet«, sagte er.
»Bei Humboldts«, sagte sie.
»Klar«, sagte Andreas Hermann und bekam eine Gänsehaut, wie immer, wenn jemand »Humboldts« sagte oder »Prenzlberg« oder »Meckpomm«. Die Mappe passte definitiv nicht in die Tüte. Die Frau legte sie zurück, stellte die Tüte auf den Boden und sah sich um.
»So viele Sachen.«
»Ja«, sagte Andreas Hermann, obwohl er fand, dass es eigentlich gar nicht so viel war. Er hätte gedacht, ein Rechtsprofessor würde mehr zurücklassen. Aber andererseits war er ja ein DDR-Rechtsprofessor gewesen, und das DDR-Recht gab es nicht mehr, wenn es es jemals gegeben hatte. Vielleicht hatte der Professor das meiste weggeworfen, als die Wende kam, dachte Andreas Hermann. Es war total niederschmetternd alles. Die Straße, die Wohnung, der Mann, der nichts zurückließ, für das sich jemand interessierte, außer ein paar Diplomarbeiten über das Rechtssystem der USA, in denen garantiert nur Unsinn stand.
Andreas Hermann verspürte das Bedürfnis, irgendetwas aus diesem Leben zu retten. Er nahm ein Buch in die Hand, es war braungrün und hieß: »Das Verwaltungsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band 2«. Es war ziemlich dick und sah nicht so aus, als habe der Professor oft darin geblättert, er hatte es sicher nur gekauft, um irgendwie mitzuhalten. Andreas Hermann wog es in der Hand, legte es wieder weg und nahm sich ein hellblaues Buch, das ihm bekannt vorkam. Es hieß »Der Gaukler« und war von Harry Thürk, einem ostdeutschen Thrillerautor, an den er sich vage erinnerte. Das Buch sah ziemlich zerlesen aus, aber das verstärkte nur noch sein Gefühl, dass nichts mehr übrig blieb von so einem Leben. Er stellte sich vor, wie der alte, kranke Mann zuletzt an diesem Fenster im ersten Stock gesessen hatte, vor dem nie was passierte, und einen Schinken aus dem Kalten Krieg las, in dem die Welt noch einfach und überschaubar gewesen war.
»Wie alt ist er denn geworden, der Professor?«, fragte er.
»Na sechsundsiebzig«, sagte die Frau, und dann polterte es im Nebenzimmer und Kowalski schrie: »Verdammte Scheiße, Mensch!«
Er legte das Buch zurück und lief mit der Frau ins Wohnzimmer, wo Kowalski schwankend in einem Haufen aus Brettern und Büchern stand. Er hielt sich den Kopf, der ungeschützt wirkte, nackt beinah. Offenbar war die Schrankwand über Kowalski zusammengebrochen und hatte auch die Helmut-Schmidt-Mütze mitgerissen.
Links und rechts des Bretterhaufens standen Olli und Bernd mit unschuldigen Gesichtern.
Eine Stunde später stand Andreas Hermann neben seinem neuen Schreibtisch auf dem Bürgersteig der Kopenhagener Straße und sah sich nach jemandem um, der ihm helfen konnte, das Ding hoch in seine Wohnung zu tragen. Olli und Bernd hatten gesagt, sie müssten den Captain »schnell zurück zur Firma bringen, weil er Behandlung braucht«. Kowalski hatte mit einem feuchten Handtuch des toten Professors um den Kopf und seiner Helmut-Schmidt-Mütze im Schoß wie ein sterbender König zwischen ihnen in der Fahrerkabine gesessen. Andreas Hermann hätte gern gefragt, was sie mit »Firma« meinten und wie sie ihn in der Buchte von »Stattumzug« behandeln wollten, hatte es dann aber gelassen. Manche Diskussionen brachten einfach nichts.
Die Kopenhagener Straße war hier oben, nach dem Knick, wie leergefegt. Es war noch ein bisschen früh, vielleicht auch schon ein bisschen spät, je nachdem, dachte Andreas Hermann, setzte sich auf die Kante seines Schreibtischs und klappte sein Zigarettenetui auf.
Nach zwei Zügen entdeckte er im Pflaster des Bürgersteiges eine Figur, die das schräg einfallende Vormittagslicht auf eine verwaschene, weiße Farbspur malte. Ein startender Reiher, dachte Andreas Hermann, der häufig solche Figuren entdeckte, im Mauerwerk, auf dem Asphalt, im Gestrüpp, auf Bauplanen oder in Pfützen, diese hier war besonders schön. Er legte die Zigarette auf die Kante des Schreibtischs, holte seine Digitalkamera aus der Jackentasche und kniete sich auf den Bürgersteig, um den Reiher zu fotografieren. Es dauerte eine Weile, denn im Display der Kamera verlor sich die Form des aufsteigenden Vogels erst mal. Als Andreas Hermann wieder aufstand, halbwegs zufrieden mit dem Bild, war die Zigarette fast heruntergebrannt. Er nahm sie vorsichtig auf und sah den kleinen braunen Streifen, den sie auf der Arbeitsplatte seines Schreibtischs hinterlassen hatte, der damit nun wirklich ein bisschen seiner war, dachte er und zog noch einmal an der Zigarette.
Eine Mutter mit einem Kind an der Hand lief an ihm vorbei, sie schaute ihn an, unsicher, interessiert, genervt, aggressiv, in dieser Reihenfolge. Drei Minuten später folgte ein Rentner, der ihn ansah, als sei er an allem schuld, inklusive Zweiter Weltkrieg. Das war der Querschnitt der Kopenhagener hinter dem Knick um diese Zeit, dachte Andreas Hermann. Schlechtgelaunte Rentner, gestresste Mütter, von denen war keine Hilfe zu erwarten. So wurde das nichts mit dem Schreibtisch. Er holte sein Handy heraus und rief Bernhard an, der am Helmholtzplatz wohnte, wieder eine ganz andere Welt, aber immer noch Prenzlauer Berg, keine fünf Minuten von hier entfernt, mit dem Auto. Bernhard arbeitete bei einer Filmfirma in Mitte, er war meistens bis mittags zu Hause.
»Hallo«, sagte Bernhard, und Andreas Hermann hörte Stimmengewirr und Verkehrsgeräusche im Hintergrund, offenbar war er doch schon unterwegs.
»Ich bin’s, Andreas«, sagte er.
»Andy«, sagte Bernhard in diesem jubelnden, aufgekratzen Ton, den Andreas Hermann auf den Tod nicht ausstehen konnte. Bernhards Andy klang wie das Andy in Andy Warhol. Sie hatten zusammen studiert, aber früher hatte Bernhard nicht so geredet. Damals war er für ihn noch Hermi gewesen, nicht Andy. Diese Filmfritzen hatten ihn total versaut.
»Ja«, sagte Andreas Hermann. »Ich stehe hier mit einem Schreibtisch vorm Haus und dachte, du kannst vielleicht mal schnell rüberkommen, um mir zu helfen, ihn hochzuschleppen.«
»Schnell mal rüberkommen«, sagte Bernhard und kicherte.
»So isses«, sagte Andreas Hermann.
»Ich bin in Cannes, Andy.«
Andreas Hermann hörte, wie viel Spaß es Bernhard machte, diesen Satz auszusprechen. Ich bin in Cannes, Andy. Wahrscheinlich standen irgendwelche Typen in schwarzen Rollkragenpullovern um ihn herum, dachte er, oder in weißen Hemden, oder was immer sie da gerade trugen, in Cannes.
»Na, dann geht’s wohl nicht«, sagte Andreas Hermann.
»Nee, Andy, nee, nee. Aber ich melde mich, wenn ich zurück bin, übermorgen.«
»Okay, Bernhard. Tschüs.«
»Tschüs, Andy, Tschüs, Tschüs, Tsch …«, sagte Bernhard, dann klappte Andreas Hermann sein Handy zu.
Er überlegte, ob er vielleicht neidisch war. Sie hatten immerhin zur selben Zeit ihr Studium abgebrochen. Aber Bernhard hatte es bis nach Cannes gebracht, und er stand hier mit einem Stück Sperrmüll auf der Kopenhagener rum, aber ehrlich gesagt, hätte Andreas Hermann im Moment nicht gewusst, was er in Cannes machen sollte. Er war vor achtzehn Jahren mal in Nîmes gewesen, wo ein Sack voll Ostjournalisten den neuen 3er BMW testen durfte. Er war damals Kinoredakteur, aber weil er ein bisschen Französisch sprach, hatte ihn sein Chefredakteur zum Autotest geschickt. Sie waren mit den Autos auf einer stillgelegten Formel 1-Strecke herumgefahren. Er war ziemlich rumgeholpert auf der Rennbahn, denn er hatte nie richtig Autofahren gelernt. Er hatte seine Fahrerlaubnis bei der Nationalen Volksarmee gemacht, auf einem uralten Ural, bei dem man beim Hoch- und Runterschalten zwischenkuppeln musste, was bei dem neuen BMW natürlich nicht nötig gewesen war. In seinem Bericht für den Nordkurier war die Formulierung »hakelige Kupplung« vorgekommen, die er mal in irgendeinem anderen Autotest gelesen hatte. Wenn er es sich recht überlegte, war das der Anfang vom Ende gewesen. Es gab keinen Neuanfang beim Nordkurier, jedenfalls nicht für ihn und höchstwahrscheinlich auch nicht für die anderen, und so hatte er gekündigt, wenn auch erst anderthalb Jahre später. Er wusste nicht genau, ob Nîmes in der Nähe von Cannes lag, aber es klang so. Nein, eigentlich musste er jetzt nicht unbedingt in Cannes sein.
Gerade als er sich eine weitere Zigarette anbrennen wollte, weil die letzte ja eigentlich nicht richtig gezählt hatte, kam Dennis aus dem Haus, der Junge, der seit zwei Monaten ihr Treppenhaus wischte. Dennis strahlte ihn an. Er wohnte in Hohenschönhausen und hielt Andreas Hermann aus irgendeinem Grund für einen Künstler, wahrscheinlich, weil er oft mit großformatigen Drucken seiner seltsamen Fotos durch die Gegend lief, die er sich auf dem neuen Laserdrucker der Agentur anfertigte, der eigentlich für die Intellektuellenprojekte angeschafft worden war. Aber im Grunde war auch seine Geisterfotografie eine Art Projekt, wenn auch kein öffentliches.
»Hi Dennis, sag mal, kannst du mir vielleicht helfen, den Schreibtisch nach oben zu tragen?«, fragte Andreas Hermann.
»Klar«, sagte Dennis.
In seiner Wohnung sah der Schreibtisch nicht mehr so zierlich aus wie im Schlafzimmer des Professors, was ihn ein bisschen überraschte, weil das Schlafzimmer des Professors nun auch nicht gerade groß gewesen war. Aber in seinem Zimmer wirkte der Tisch wuchtig, er schien auf dem Weg hierher gewachsen zu sein. Einen Moment lang wusste Andreas Hermann nicht, wie es weitergehen sollte. Er stand am vorderen Ende, halb in seinem Zimmer, Dennis wartete am hinteren Ende im Flur und schaute unsicher. Wahrscheinlich hatte er gedacht, Andreas Hermann, der Künstler, hause hier oben in einem geräumigen Atelier. Das war natürlich ziemlich unwahrscheinlich in einem Hinterhaus in der Kopenhagener Straße, aber Dennis wischte ja nur den Flur und nicht die Wohnungen, außerdem war er aus Hohenschönhausen. Wahrscheinlich brach in diesem Moment sein Bild von der geheimnisvollen Prenzlauer-Berg-Boheme zusammen.
»Danke, Denny, wir lassen ihn erst mal hier stehen«, sagte Andreas Hermann, als habe er irgendeinen Plan.
»Okay dann, Andreas«, sagte Dennis und zog sich vorsichtig zurück. Die Wohnungstür konnte er nicht schließen, die wurde durch den Schreibtisch blockiert. Andreas Hermann nickte dem Jungen so würdevoll zu, wie es ihm, eingeklemmt in seinem Wohnzimmer, möglich war. Als Dennis’ Schritte im Treppenhaus verklungen waren, ruckelte er den Schreibtisch noch ein bisschen weiter in sein Zimmer hinein, so weit, bis wenigstens die Wohnungstür wieder frei war. Dann schaute er auf die Uhr. Es war kurz nach zehn, wenn er jetzt zurück in die Agentur laufen würde, wäre er gerade vor der Pause da. Er könnte eigentlich auch gleich zum Café Fröhlich gehen, wo sie normalerweise zum Mittag waren. Andererseits war nicht klar, ob die anderen ohne ihn zum »Fröhlich« gehen würden. Er dachte einen Moment nach, dann zwängte er sich an dem Schreibtisch des toten Professors vorbei und machte sich auf den Weg zur Agentur.
Das Gebäude, in dem ihre Projektagentur »contact« untergebracht war, gehörte zu einer ehemaligen Hinterhoffabrik am Ende der Greifswalder Straße, dort, wo sie aufs Königstor stieß. Warum das Königstor Königstor hieß, wusste Andreas Hermann nicht. Es war kein Tor zu sehen, kein Königsdenkmal, nichts, nur ein chinesisches Restaurant, in dem nie jemand saß. Er hatte sich immer mal vorgenommen, im Internet nachzuschauen oder jemanden zu fragen, woher der Name kam, aber es hatte sich nie ergeben und eigentlich war es ihm auch egal. Der Fabrikhof lag wie eine Insel zwischen Mietskasernen und einer Siedlung aus weißen Townhäusern, die »Prenzlauer Gärten« hieß, obwohl gar keine Gärten zu sehen waren, nur die weiße Wand der Reihenhäuser, von deren Balkons manchmal Menschen in den Hof ihres Projektzentrums »contact« schauten wie auf ein fremdes Land.
In den Hofgebäuden gab es eine verwaiste Werbeagentur, ein Musikstudio und eine Autowerkstatt, die sich, wenn Andreas Hermann nicht ganz falsch lag, am Rande der Legalität bewegte. Die Autos, die hier versorgt wurden, hatten oft relativ exotische Nummernschilder, neulich stand da ein brauner Porsche Carrera mit irischem Kennzeichen. Außerdem war auf dem Hof Kowalskis »Stattumzug«-Mannschaft untergebracht, die zur Projektagentur »contact« gehörte. Im Namenerfinden waren sie alle ziemlich gut, die Stadtplaner, die Townhausbauer und auch die Fritzen vom Arbeitsamt, das ja auch nicht mehr Arbeitsamt hieß, sondern Jobcenter, dachte Andreas Hermann. Von den ganzen mit Milchglasfolie beklebten Ladenbüros, die an jeder Ecke des Prenzlauer Bergs aufmachten und »Nachrichtendienst«, »Schreibfabrik«, »Onion«, »Druckerkolonne«, »Planbar« und so weiter hießen, gar nicht zu reden, manchmal hatte er den Eindruck, dass die Hälfte der Arbeitszeit des modernen Menschen fürs Namenerfinden draufging. Er konnte das schon verstehen, prinzipiell. Wenn man nicht genau wusste, wie es weiterging, schrieb man erst mal ein Wort hin, das war ein Anfang. Viele Erfindungen begannen mit einem Wort, dafür hatte Andreas Hermann Verständnis, er war im Herzen ein Erfinder, wenn auch kein besonders erfolgreicher.
Er wusste nicht genau, wer sich den Namen »Stattumzug« ausgedacht hatte, aber er fand, dass er, sicher ungewollt, sehr exakt beschrieb, was sie hier trieben. Nichts. Ihre Projektagentur hätte auch »Statt Arbeit« heißen können. Die Agentur war für Arbeitslose das, was Methadon für Heroinabhängige war, dachte er, andererseits hatte er weder Erfahrungen mit Heroin noch mit Methadon, und so würde er den schönen Vergleich für sich behalten müssen.
»Stattumzug« hatte ein kleines Büro und einen Raum, in dem die Sachen ausgestellt waren, die sie aus den Wohnungen holten. Der Plan war, dass sich sozial Bedürftige unter Vorlage ihrer Papiere hier kostenlos Möbel, Geschirr, Lampen, Bücher und so weiter abholen durften. Dinge, die länger als eine Woche in dem Lager herumstanden, wurden auf den Müll gebracht. Die einzigen Kunden, die Andreas Hermann jemals in dem Lagerraum angetroffen hatte, waren irgendwelche Kumpels der »Stattumzug«-Crew oder Leute aus dem Projektzentrum, allerdings sahen die alle ziemlich bedürftig aus, und so ging die Sache wohl in Ordnung.
Er steckte kurz den Kopf ins Büro, wo Marianne, Ingrid, Olli und Bernd in ihrem Zigarettenqualm an einem Tisch saßen, der über und über mit Papieren bedeckt war. Am Kopf des Tisches, im Präsidium gewissermaßen, saß Kowalski, ein großes Pflaster auf der Stirn, die Helmut-Schmidt-Mütze trug er im Nacken wie ein angetrunkener Unteroffizier.
»Alles klar, Captain?«, rief Andreas Hermann in den Raum.
»Wat denn?«, fragte Kowalski zurück, obwohl er natürlich genau wusste, was gemeint war. Der schroffe Ton war Teil seiner Inszenierung, als Captain, als Autorität. Ohne das wäre er nur ein Mann gewesen, der in der Rietzestraße wohnen könnte. Kowalski erinnerte ihn an Berlin, die ganze Stadt holte sich ihre Autorität aus ihrer gespielten schlechten Laune.
»Der Kopf, meine ich«, sagte Andreas Hermann und tippte sich an die Stirn.
»Ach dit«, sagte Kowalski. »Mach dir mal keene Sorgen, meen Kleener. Mich haut so schnell nischt um. Ick werde so alt wie Karl Dönitz.«
»Karl Dönitz?«, fragte Olli.
»Oberbefehlshaber der deutschen Kriegsmarine«, sagte Kowalski. »Großadmiral zum Schluss.«
»Und wie alt ist der jeworden?«, fragte Ingrid.
»Neunundachtzig«, sagte Kowalski. »Verstorben am 24. Dezember 1980.«
»Dit iss ja Heilichabend«, sagte Olli.
»Wie hast’n dit wieder rausjekricht, du Superhirn«, sagte Ingrid.
Dann wandten sie sich wieder den Papierbergen zu, die vor ihnen auf dem Tisch lagen. Wahrscheinlich wollten sie mit dem Geraschel der Projektagenturleitung und sich selbst beweisen, dass sie genug zu tun hatten, dachte Andreas Hermann. Er trat auf den Hof und überlegte, ob er sich noch eine Zigarette anbrennen sollte, das wäre dann die sechste oder siebte heute gewesen. Er drehte sich zwanzig Zigaretten pro Tag vor, nie mehr. Er klappte das Etui auf, um nachzuzählen, da fing oben, im dritten Stock des Verwaltungsgebäudes, Regina zu singen an, und das verdarb ihm die Zigarettenruhe. Sie sang das Lied vom kleinen Trompeter, ihr Lied.
Regina gehörte seit sieben Tagen zu seinem Projekt. Sie war fünfundvierzig und hatte vor zwanzig Jahren mal eine private Schauspielausbildung in Charlottenburg absolviert, bei einer alten Dame, deren Namen sie oft erwähnte, obwohl ihn niemand aus der Gruppe kannte oder vielleicht gerade deshalb. Anfang der 90er hatte sie eine Obstverkäuferin in der Arztserie »Praxis Bülowbogen« gespielt, zwei Folgen lang, dann war sie durch einen Türken ersetzt worden und hatte sich um ihren Sohn gekümmert, der inzwischen siebzehn war. Sie trug eine Männerfrisur, Männersachen und bewegte sich wie ein Mann, vielleicht wollte sie andeuten, dass sie vielseitig einsetzbar war. Cathrin Huschke, die »contact«-Projektleiterin, hatte sie eingestellt, weil ihre Haltung stimmte, wie sie sagte, und da hatte sie wohl recht. Regina brüllte über den Hof wie ein Stabsfeldwebel. Sie sang nicht, sie schrie die Worte heraus, und dann verstummte sie plötzlich, unmittelbar nach: »Da kam eine feindliche Kugel, bei einem so fröhlichen Spiel.« Die Kugel stoppte im Flug, der kleine Trompeter lebte noch, gerade so.
Andreas Hermann klappte das Etui wieder zu und betrat das Bürogebäude, in dem die meisten Projektgruppen der Agentur »contact« untergebracht waren. Im ersten Stock befand sich die Tischlerei »holzbock«, im zweiten die Schlosserei »eisenstein«, alles Wortschöpfungen von Cathrin Huschke, auch was die Kleinschreibung anging, im dritten war die Kantine und eine »Qualitätsuhrmacherfirma« aus Ludwigsfelde, die nicht zur Agentur gehörte und wo auch nie jemand war. Es gab nur das Schild. Jedes Mal, wenn er daran vorbeilief, dachte Andreas Herrmann, dass hinter der Tür ein mumifizierter Uhrmacher aus Ludwigsfelde lag, den niemand vermisste, eine noch tickende Uhr in der Hand. Es roch nach Buletten im Treppenhaus, es roch immer nach Buletten, egal, was es zum Mittag gab. Im vierten Stock saß ein Projekt, das die durchschnittliche Bordsteinhöhe in Pankow ermittelte, ein Projekt, das Müllecken in Weißensee aufspürte, und eines, das darauf spezialisiert war, jene Kastanienblätter von öffentlichen Plätzen zu sammeln, die von der Miniermotte befallen waren. Aber wirklich nur die mottenzerfressenen, alle anderen Blätter mussten sie für die hauptamtlichen Parkarbeiter liegen lassen. Im fünften Stock befand sich die Kommandobrücke. Hier entstanden die Projektideen, hier saß Cathrin Huschke, die Agenturchefin, die nach ihrem Nervenzusammenbruch als Sport- und Geografielehrerin an einer Hellersdorfer Schule ins Arbeitslosengeschäft gewechselt war. Außerdem gab es da oben eine Kaffeeküche und die beiden Intellektuellenprojekte, wie Cathrin Huschke sie gern nannte.
Es war ihre Idee gewesen, »Hartz IV-Empfängern mit gesellschafts- oder kulturwissenschaftlichen Studienabschlüssen unter dem Dach der ›contact‹-Projektagentur eine sinnvolle Perspektive zu geben«. So stand es im Finanzierungsantrag, den sie ihm beim Einstellungsgespräch vor zwei Monaten gezeigt hatte. Andreas Hermann hatte Stolz in ihren Augen gesehen, Erfinderstolz. Sie hatte neue Menschen geformt, sie hatte die Bürgersteigvermesser geschaffen, die Mülleckenaufspürer, die Kastanienblattsammler und auch ihn, den Schauspieler Andreas Hermann.
Es gab zwei Intellektuellenprojekte bei »contact«. Eine fünfköpfige Gruppe war seit einem Jahr damit beschäftigt, eine Dokumentation über die Geschichte des Weinanbaus in Berlin zu erarbeiten, die in weiteren anderthalb Jahren an irgendeinem öffentlichen Platz ausgestellt werden sollte, der noch nicht feststand. Andreas Hermann bezweifelte, dass sie den Platz jemals fanden, wahrscheinlich suchten sie ihn nicht mal, und warum sollten sie auch. Das oberste Prinzip ihrer Arbeit war, dass sie keinen Gewinn erzielte. Sie musste zusätzlich und ehrenamtlich sein, auch das wusste er aus Cathrin Huschkes Konzept, keine Konkurrenz zur richtigen Arbeitswelt.
Seine Projektgruppe bestand aus sieben Charlottenburger Schauspielern und Musikern sowie aus Volker Kosch und ihm. Kosch war der letzte Kulturattaché der DDR-Botschaft in Nigeria gewesen, hatte später Versicherungen verkauft, dann Fernreisen und am Ende gar nichts mehr. Er behauptete, ein bisschen Gitarre spielen zu können, aber gehört hatte Andreas Hermann das nie. Er selbst war ein abgebrochener Journalistikstudent, der seit zehn Jahren keinen Text mehr veröffentlicht hatte, und spielte kein Instrument. Er hatte fünf Computerlehrgänge gemacht, einen Feinmechanikerlehrgang und einen Kurs, in dem ihm beigebracht werden sollte, wie man sich richtig bewirbt. Dies war sein erstes Projekt. Dass die anderen aus Charlottenburg kamen, hatte irgendeinen bürokratischen Hintergrund, den er nie ganz verstanden hatte, vielleicht wollten sie die Wiedervereinigung der Stadt vorantreiben, auch hier unten, bei ihnen.
Sie führten Kulturprogramme in Altersheimen und Krankenhäusern auf, das aktuelle Programm hieß »Traumfabrik«. Es war ein Potpourri aus amerikanischen und deutschen Filmschlagern der 30er und 40er Jahre, mit denen man gut zu den alten und kranken Menschen vordringen konnte, wie Cathrin Huschke behauptete. Das nächste Programm würde sich mit dem Mauerfall beschäftigen. Dafür waren er und Kosch eingestellt worden, auch wenn das nie so gesagt worden war. Ursprünglich hatte Andreas Hermann für das Weinausstellungsprojekt vorgesprochen, aber dann hatte das Gespräch die Richtung gewechselt, und er hatte regelrecht gespürt, wie in Cathrin Huschke die Idee wuchs, ihn fürs Mauerprogramm zu besetzen. Ihm war es egal, womit er seine Zeit totschlug, aber natürlich hatte er vom historischen Mauerfall mehr Ahnung als vom historischen Weinanbau, und so war er am Ende ganz zufrieden gewesen, bei den Schauspielern und Sängern aus Charlottenburg gelandet zu sein. Cathrin Huschke hatte ihm später hinter vorgehaltener Hand gestanden, dass er eigentlich auch in Charlottenburg wohnen sollte, was er angenehm absurd fand, als Gedanke.
Im Flur der fünften Etage begegnete er Cathrin Huschke und Marek Tomaczewski, die ein Bild betrachteten, das sie gerade aufgehängt hatten. Tomaczewski stammte aus Polen. Er arbeitete als Gestalter im Weinausstellungsprojekt, obwohl er von Beruf Dreher war. Er hatte keine Ahnung von Grafikprogrammen, aber er malte. Er hatte mit Aquarellen angefangen, aber nachdem sich seine deutsche Frau von ihm getrennt hatte, war er zu Öl gewechselt, zuletzt waren seine Bilder immer dunkler geworden. Man konnte seinen Leidensprozess auf dem Flur der fünften Etage nachvollziehen, dessen Wände mit seinen Werken zugehängt worden waren. Cathrin Huschke hatte die Idee gehabt, die Bilder auszustellen. Sie reagierte auf jede Art von Kreativität unter ihren Hartz IV-Schützlingen, als habe sie Leben auf dem Mars entdeckt. Tomaczewski war ein 50-jähriger Hobbymaler mit riesigen Schlosserhänden und sie eine ehemalige Sport- und Erdkundelehrerin, aber die beiden standen vor dem Bild wie zwei Kuratoren des Hamburger Bahnhofs. Es zeigte eine schwarze Schlange, der irgendetwas aus dem Maul hing.
»Schön«, sagte Andreas Hermann.
Tomaczewski sah ihn aus blutunterlaufenen Augen an.
»Sie haben Besuch«, sagte Cathrin Huschke und schaute in Richtung des Probenraums.
»Ach, wen denn?«, fragte Andreas Hermann, worauf sie nur nickte, was sie immer tat, wenn sie nicht weiter wusste.
Er sah die Frau, die sein Leben verändern sollte, nur von hinten, spürte aber gleich, dass irgendetwas nicht stimmte. Sie passte nicht in den Probenraum, in dem es entweder zu kalt war oder stank, manchmal auch beides. Es war eine ungewohnte Energie im Raum. Andreas Hermann konnte noch nicht genau sagen, ob es sich um positive oder negative Energie handelte, aber es war eindeutig zu viel für ihn, und er vermutete, dass es diese Energie gewesen war, die Regina zum Schweigen gebracht hatte. Die Frau trug ein blaues Sommerkleid und eine dünne und sehr kurze graue Strickjacke, die aussah, als habe sie sie sich erst in allerletzter Sekunde übergeworfen. Ihre Füße steckten in Badelatschen. Die Haare hatte sie mit einer dicken Spange nach oben gesteckt. Sie wirkte flüchtig, aber nicht so, als habe sie sich verlaufen. Sie war genau da, wo sie sein wollte. Alle Muskeln, die er von hier aus sehen konnte, schienen gespannt, sie hatte kräftige Waden, einen langen Hals und breite, etwas abfallende Schultern, ihr Hintern stieß regelrecht unter der kurzen grauen Strickjacke hervor, rund und fest wie der Arsch einer Offiziersfrau, dachte Andreas Hermann.
Seine Kollegen aus dem Projekt schauten, als dächten sie über irgendeine Antwort auf eine komplizierte Frage nach, aber so schauten sie eigentlich immer. Er kannte nicht viele Schauspieler, aber die, die er kannte, schauten so, wenn sie sich außerhalb einer Rolle befanden. Leer und hilflos.
Was Andreas Hermann wirklich wunderte, war, dass sich die Frau im blauen Kleid nicht umdrehte, als er den Raum betrat, sie zuckte nicht mal, als er die Tür zuklappte. Sie verharrte in ihrer Pose wie eine Geräteturnerin, die nach einer erfolgreichen Übung auf das Urteil der Punktrichter wartete. Wenigstens bot er seinen Kollegen die Chance, wieder in ihren Rhythmus zu kommen, vor allem Volker Kosch. Kosch war der Regisseur ihres Kulturprogramms, auch wenn das nie so festgelegt worden war. Er war der Regisseur, seit er hier vor fünf Wochen angefangen hatte, vom ersten Tag an, und niemand hatte sich getraut, ihm zu widersprechen, nicht mal Florian Martens, der schwule arbeitslose Theaterkritiker, der sich »Traumfabrik« ausgedacht hatte und mittlerweise in irgendeinem anderen Arbeitsbeschaffungsprojekt in Pankow untergekommen war.
»Wo kommst du denn jetzt her, Andreas?«, fragte Kosch.
»Vom Captain, Volker«, sagte Andreas Hermann.
»Vom Captain«, sagte Kosch. Er nickte, als beantworte das alle offenen Fragen und schrieb irgendetwas in das grüne Buch, das er ständig mit sich herumtrug. Auch die anderen schienen beruhigt, jetzt, da klar war, dass er vom Captain kam, nur Regina guckte immer noch völlig entgeistert, auch weil sie natürlich keine Ahnung hatte, wer der Captain war.
»Und was ist hier los?«, fragte Andreas Hermann, und da endlich drehte sich auch die Frau im blauen Kleid um und musterte ihn. Sie hatte ein entschiedenes Gesicht, ein bisschen zu entschieden für seinen Geschmack. Vielleicht sah es aber auch nur entschieden aus in dieser unentschiedenen Umgebung, dachte Andreas Hermann und nickte ihr zu. Sie antwortete mit einer hochgezogenen Augenbraue, das konnte alles bedeuten und beeindruckte ihn nicht. Er kannte dieses Augenbrauenhochgeziehe von Paula zur Genüge. Es machte ihn nur agressiv, und das war nun überhaupt nicht gut in diesem energiegeladenen Umfeld.
»Captain?«, sagte die Frau.
»Anderes Projekt«, sagte er.
»Projekt«, sagte sie. Ihre rechte Augenbraue verschwand beinahe unterm Haaransatz.
»Projekt«, sagte er, von ihm aus hätten sie ewig so weiterreden können, eine endlose Projektkette schmieden. Das wäre ehrlich gewesen und beruhigend.
»Frau Beerenburg wohnt dort drüben in den Prenzlauer Gärten«, sagte Kosch und zeigte aus dem Fenster. Alle sahen hinterher, als stünde auf der weißen Wand der Reihenhäuser irgendeine Antwort.
»Beerenstein«, sagte die Frau im blauen Kleid.
»Beerenstein, natürlich«, sagte Kosch. »Entschuldigung.«
Die anderen nickten. Anthony, Danuschka, Liliane Müller, Ramón und Leonid. Marin starrte auf sein Mischpult.
Alles Schafe, dachte Andreas Hermann. Das ganze Ensemble eine einzige Schafherde.
»Ja und was heißt das nun?«, fragte Andreas Hermann.
»Es ist ihr zu laut«, sagte Liliane Müller.
»Was ist ihr zu laut?«, fragte Andreas Hermann.
»Ich«, sagte Regina und sah für einen Moment sehr zerbrechlich aus unter ihrem burschikosen Panzer.
»Naja«, sagte die Frau im blauen Kleid und lockerte ihre Nackenmuskeln ein bisschen.
»Der Hof bietet natürlich Resonanzfläche«, sagte Kosch. »Insgesamt, als Hof.«
»Nee, nich insgesamt. Sie hat gesagt, der Trompeter treibe sie noch in den Wahnsinn«, sagte Liliane Müller, die an den Wochenenden in einem Zweimannkabarett in Wilmersdorf arbeitete und nie vergaß, darauf hinzuweisen. Das Trompeterlied war ihr Vorschlag gewesen, um Regina schnell einzugliedern. Es bildete im Grunde den ersten Baustein ihres neuen Programms zum Mauerfall. Es war Honeckers Lieblingslied, hatte Kosch gesagt, und Liliane hatte gelächelt, als hätte das ihren Vorschlag irgendwie bedeutsamer gemacht.