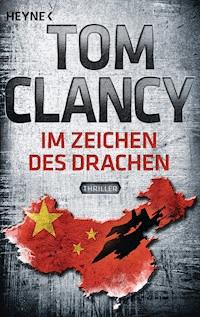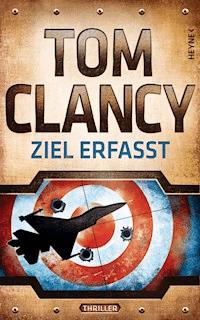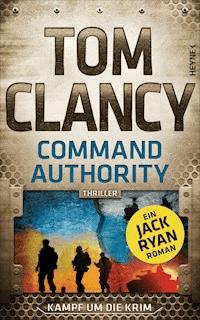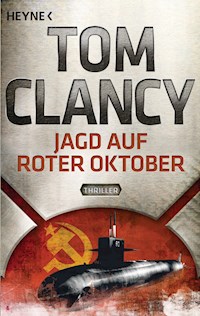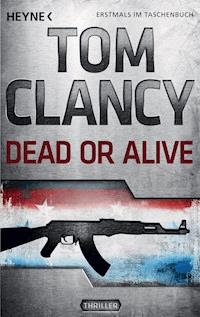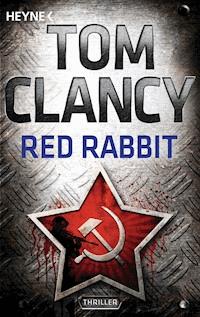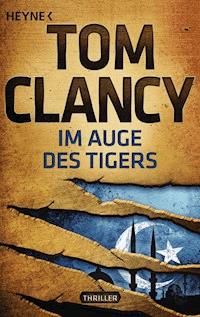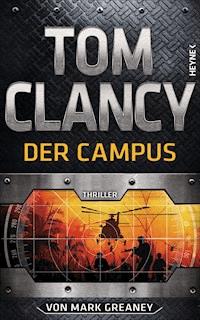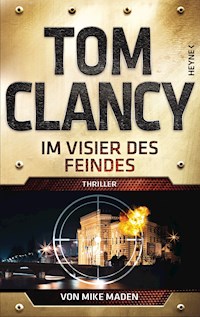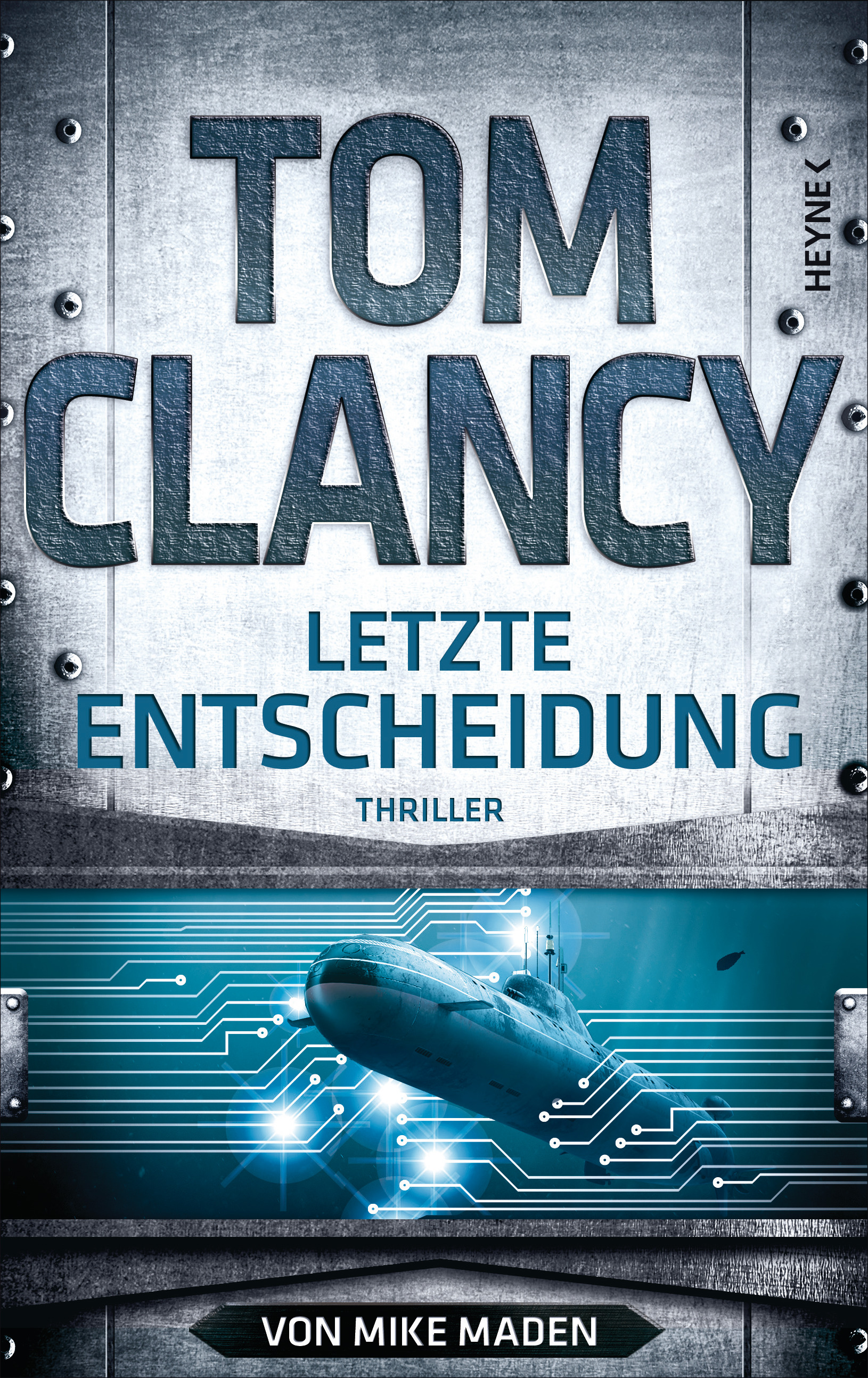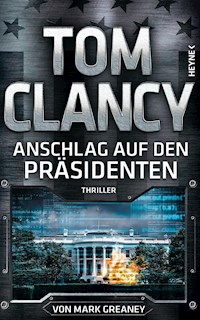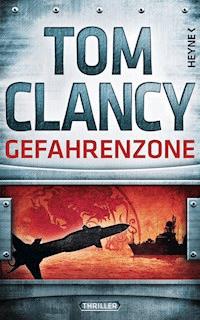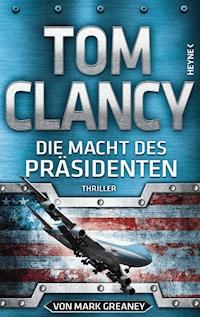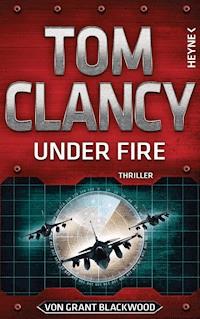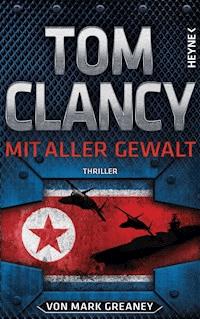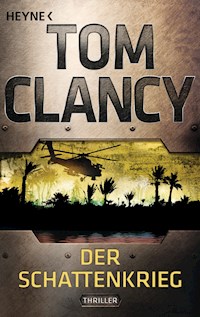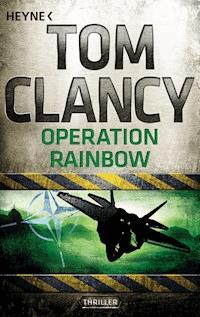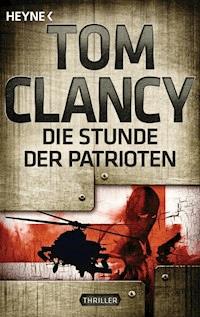9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: MAX MOORE
- Sprache: Deutsch
Internationale Intrigen, explosive Action – der neue große Tom Clancy
Seit Jahren tobt der Konflikt im Mittleren Osten. Nun sieht es so aus, dass sich der Kriegsschauplatz verlagert hat. Die Taliban bedienen sich für ihre Machenschaften eines mexikanischen Drogenkartells und tragen den Kampf ins Heimatland des Erzfeindes – in die Vereinigten Staaten von Amerika. Tom Clancy, der Meister des internationalen Politthrillers, stellt uns seinen neuen Helden vor: Ex-Navy-SEAL Max Moore. Und der steht allein – gegen alle Feinde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 953
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
TOMCLANCY
UND PETER TELEP
GEGEN ALLE FEINDE
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Michael Bayer
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Against All Enemiesbei G.P. Putnam's Sons, New York
Redaktion: Ulrich Mihr
Copyright © 2011 by Rubicon, Inc.
Copyright © 2012 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Satz: Leingärtner, Nabburg
ePub-ISBN 978-3-641-08582-7V003
www.heyne.de
Wir glauben, Al-Kaida sei übel, aber das sind Waisenknaben im Vergleich mit den Kartellen.
anonymer leitender FBI-Agent, El Paso, Texas
Jeder hat seinen Preis. Man muss nur herausfinden, wie hoch er ist.
Pablo Escobar
In Mexiko ist man dem Tod immer sehr nahe. Das gilt zwar für alle Menschen, denn er ist ein Teil des Lebens, aber in Mexiko begegnet man dem Tod in vielerlei Gestalt.
Gael García Bernal
Prolog
Rendezvous Foxtrott
02.15 Uhr, Arabisches Meer
8 km südlich der Indus-Mündung
Pakistanische Küste
Ein verdunkeltes Schiff muss immer und jederzeit ausweichen sowie allen anderen die Vorfahrt gewähren und sollte deshalb mit größter Vorsicht manövrieren, dachte Moore, als er vor dem Steuerhaus des OSA-1-Schnellboots Quwwat stand. Dieses war zwar in Pakistan selbst in der Werft von Karatschi gebaut worden, beruhte jedoch mit seinen vier HY-2-Boden-Boden-Raketen und seinen beiden 25-mm-Zwillings-Flak auf einem alten sowjetischen Bauplan. Drei Dieselmotoren und drei Schrauben trieben das 40 Meter lange Patrouillenboot mit 30 Knoten durch die Wellen, die unter einer dicht über dem Horizont stehenden Mondsichel silbern schimmerten. »Verdunkelt« bedeutete, dass weder die Topplaternen noch die Steuerbordlichter brannten. Die »Internationalen Kollisionsverhütungsregeln« (COLREGs) von 1972schrieben vor, dass die Quwwat in diesem Zustand bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Schiff unabhängig von den jeweiligen Umständen auf jeden Fall schuld sein würde.
Am frühen Abend war Moore bei einbrechender Dämmerung in Begleitung des Leutnants Syed Mallaah eine Pier in Karatschi hinuntergegangen. Ihnen folgten vier Soldaten, die zur Pakistan Special Service Group Navy (SSGN) gehörten, einer Spezialeinheit der pakistanischen Marine, die den SEALs der US-Navy ähnelte, ohne jedoch über deren, ähm, Fähigkeiten und Kampfkraft zu verfügen. An Bord der Quwwat hatte Moore auf einem Schnellrundgang bestanden, an dessen Ende er kurz dem Kapitän, Leutnant Maqsud Kayani, vorgestellt wurde, der jedoch gerade mit den Auslaufbefehlen beschäftigt war. Der Schnellboot-Kommandant konnte nicht viel älter als Moore sein, er schätzte ihn auf fünfunddreißig Jahre, womit aber die Ähnlichkeiten zwischen den beiden schon erschöpft waren. Moores breite Schultern standen in starkem Gegensatz zu Kayanis schmaler Radler-Statur, die seine Uniform kaum auszufüllen vermochte. Der Leutnant hatte eine Hakennase, und wenn er sich in der letzten Woche rasiert haben sollte, so war das zumindest nicht mehr zu erkennen. Trotz seines etwas rauen Aussehens genoss er die höchste Aufmerksamkeit und den Respekt seiner 28-köpfigen Mannschaft. Wenn er etwas anordnete, wurde es sofort ausgeführt. Schließlich drückte Kayani Moore kräftig die Hand und sagte: »Willkommen an Bord, Mr. Fredrickson.«
»Vielen Dank, Leutnant. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen.«
»Keine Ursache.«
Sie unterhielten sich auf Urdu, der pakistanischen Nationalsprache, die Moore leichter erlernt hatte als Dari, Paschtu oder Arabisch. Diesen pakistanischen Marinesoldaten hatte man ihn als den Amerikaner »Greg Fredrickson« angekündigt, obwohl es ihm sein leicht dunkler Teint, sein dichter Bart und sein im Moment zu einem Pferdeschwanz zusammengebundenes langes, schwarzes Haar erlaubten, sich als Afghane, Pakistani oder Araber auszugeben, wenn er dies wünschte.
Leutnant Kayani fuhr fort: »Keine Angst, Sir. Ich plane, unseren Bestimmungsort pünktlich, wenn nicht sogar etwas früher zu erreichen. Der Name dieses Boots bedeutet Schlagkraft oder Leistungsfähigkeit, und das trifft es ganz genau.«
»Hervorragend.«
Point Foxtrot, der vorgesehene Treffpunkt, lag 5 Kilometer vor der pakistanischen Küste und gerade außerhalb des Indus-Deltas. Dort würden sie vom indischen Patrouillenboot Agray einen Gefangenen übernehmen. Die indische Regierung hatte sich bereit erklärt, einen erst kürzlich verhafteten Taliban-Kommandeur namens Akhter Adam auszuliefern. Nach indischen Angaben war dieser Mann ein »hochrangiges Ziel« mit genauen Kenntnissen über die Operationen der Taliban-Truppen im Südabschnitt der afghanisch-pakistanischen Grenze. Die Inder glaubten, Adam habe vor seiner Festnahme seine eigenen Leute nicht mehr alarmieren können. Für diese war er einfach seit 24 Stunden verschwunden. Trotzdem drängte die Zeit. Beide Regierungen wollten sicherstellen, dass die Taliban niemals erfuhren, in wessen Hände Adam gefallen war. Aus diesem Grund waren an dieser Übergabe auf See keine amerikanischen Soldaten oder militärischen Einheiten der US-Navy beteiligt – außer einem gewissen CIA-Agenten für paramilitärische Operationen namens Maxwell Steven Moore.
Freilich hatte Moore gewisse Bedenken, diesen Einsatz mit einem Sicherheitsteam der SSGN durchführen zu müssen, das von einem jungen, unerfahrenen Leutnant geführt wurde. Bei der Vorbesprechung hatte man ihm jedoch versichert, dass Mallaah, ein Einheimischer aus der ganz in der Nähe liegenden Stadt Thatta in der Sindh-Provinz, absolut loyal, hoch angesehen und für seine Zuverlässigkeit bekannt sei. Für Moore mussten Loyalität, Vertrauen und Respekt zwar erst einmal verdient werden, aber es würde sich bald herausstellen, ob der Leutnant der Aufgabe gewachsen war. Immerhin war Mallaahs Job ziemlich wichtig: Er musste die Übergabe überwachen und für den Schutz Moores und des Gefangenen sorgen.
Wenn Akhter Adam sicher an Bord war, wollte Moore bereits auf der Rückfahrt in den Hafen von Karatschi mit seinem Verhör beginnen. In dieser Zeit wollte er klären, ob der Kommandeur tatsächlich ein »hochrangiges Ziel« war, das die Aufmerksamkeit der CIA verdiente, oder jemand, den man den Pakistani zu einer kleinen Kurzweil überlassen konnte.
Auf der Backbordseite durchdrangen drei schnelle weiße Lichtblitze die Dunkelheit, die vom Turshian-Mouth-Leuchtturm stammten, der den Eingang zum Indus bewachte. Die Sequenz wiederholte sich alle zwanzig Sekunden. Etwas weiter östlich bemerkte Moore auf der Steuerbordseite den einzelnen weißen Lichtblitz des Kajhar-Creek-Leuchtfeuers, der alle zwölf Sekunden aufleuchtete. Das Drehlinsenfeuer des vielumkämpften Kajhar-Creek-(oder Sir-Creek-)Leuchtturms kam exakt von der indisch-pakistanischen Grenze. Moore hatte sich bei der Einsatzbesprechung die Navigationskarten gründlich angesehen und sich vor allem Namen und Lage der Leuchttürme und ihre spezifischen Leuchtsequenzen genau eingeprägt. Solche alten SEAL-Gewohnheiten saßen eben sehr tief.
Da der Mond um 2.20 Uhr unterging und der Himmel zur Hälfte bewölkt war, erwartete Moore, dass es während des Treffens um 3.00 Uhr stockdunkel sein würde. Auch die Inder würden ihr Schiff völlig abdunkeln. Notfalls würden ihnen die Leuchtfeuer von Kajhar Creek und Turshian Mouth eine genaue Positionsbestimmung ermöglichen.
Leutnant Kayani hielt tatsächlich Wort. Als sie genau um 2.50 Uhr Point Foxtrot erreichten, ging Moore zur anderen Seite des Steuerhauses hinüber, wo an Backbord das einzige vorhandene Nachtsichtgerät angebracht war. Kayani war bereits dort und versuchte, etwas in der stockfinsteren Nacht auszumachen. In der Zwischenzeit hatten sich Mallaah und sein Team mittschiffs auf dem Hauptdeck aufgestellt, um den Gefangenen an Bord zu holen, sobald das indische Schiff längsseits gehen würde.
Als er Moore kommen hörte, überließ Kayani ihm das Nachtsichtgerät. Trotz der aufziehenden Wolken lieferte das Sternenlicht immer noch genug Photonen, um das indische Patrouillenboot der Pauk-Klasse in ein unheimliches grünes Zwielicht zu tauchen. Sogar die Zahl 36 am Rumpf war zu erkennen. Die von Steuerbord heranrauschende Agray war mit ihren 500 Tonnen doppelt so schwer wie die Quwwat. Sie war mit acht GRAIL-Boden-Luft-Raketen und zwei RBU-1200-ASW-Raketenwerfern auf der Steuerbordseite ausgerüstet. Jedes aus fünf Werferrohren bestehende System konnte Täuschkörper sowie ASW-Raketen auf Bodenziele oder zur U-Boot-Bekämpfung abfeuern. Die Quwwat wirkte neben ihr geradezu winzig.
Die Agray driftete jetzt langsam an Steuerbord entlang und bereitete sich auf die endgültige Annäherung vor. Moore entdeckte ihren Namen, der mit schwarzen Buchstaben quer über das Heck gemalt war, das aus dem Gischtnebel auftauchte. Als er dann einen Blick durch die Steuerhaus-Tür auf die Backbordseite warf, bemerkte er einen »kurz-lang, kurz-lang«-Lichtblitz. Er versuchte sich daran zu erinnern, welcher Leuchtturm diese Lichtfolge verwendete. Inzwischen hatte die Agray ihr Anlegemanöver fast beendet, und Kayani lehnte sich über die Steuerbord-Reling, um das Ausbringen der Fender zu überwachen, die eventuelle Schäden am Schiffsrumpf möglichst klein halten oder ganz verhindern sollten, die beim Kontakt der beiden Schiffe durch den Seegang entstehen konnten.
Da, wieder diese Lichtblitze: kurz-lang, kurz-lang.
Von wegen Leuchtturm …, dachte Moore. ALPHA-ALPHA bedeutete im internationalen Morsecode so etwa: »Wer zum Teufel sind Sie?«
Moore überlief es eiskalt. »Leutnant, wir bekommen ein ALPHA-ALPHA auf der Backbordseite. Sie fordern uns auf beizudrehen!«
Kayani stürzte zur Backbord-Reling hinüber. Moore stellte sich direkt hinter ihn. Wie oft hatte man sie wohl schon aufgefordert, sich zu identifizieren? Sie befanden sich zwar immer noch in pakistanischen Küstengewässern, aber wie genau sahen die pakistanischen Marine-Einsatzregeln aus?
Plötzlich explodierte über ihren Köpfen eine Leuchtrakete. Deren Licht ließ tiefe Schatten über die Decks der beiden Patrouillenboote huschen. Moore spähte angestrengt auf die See hinaus. Was er dann erblickte, erschien ihm wie ein Albtraum. Etwa 1000 Meter von ihnen entfernt durchbrach ein U-Boot mit einem riesigen schwarzen Turm die Fluten. Seine schwarzen Decks wurden immer wieder überspült, während es seinen Bug genau auf sie richtete. Der Kommandant hatte sich zum Auftauchen entschlossen, um die vermeintlichen Eindringlinge aufzubringen. Da sie nicht geantwortet hatten, hatte er ein Leuchtgeschoss abgefeuert, um sein Ziel visuell genau ausmachen zu können.
Kayani führte den Feldstecher, der ihm um den Hals hing, an die Augen und stellte ihn scharf. »Es ist die Shushhuk! Sie ist eines unserer Boote! Sie sollte jedoch daheim an der Pier liegen.«
Moores Brust zog sich zusammen. Was zum Teufel hatte ein U-Boot der pakistanischen Marine an ihrem Treffpunkt zu suchen?
Er drehte sich zur Agray um. Inzwischen stand der Taliban-Gefangene bestimmt schon zur Übergabe bereit auf ihrem Deck. Laut Plan sollte der an den Händen gefesselte Adam einen schwarzen Overall und einen Turban tragen und von zwei schwer bewaffneten MARCOS, Elitesoldaten des indischen Marinekommandos, bewacht werden. Moore wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem U-Boot zu …
Und da sah er es: eine phosphoreszierende Linie bewegte sich durch das Wasser an ihrem eigenen Heck vorbei auf die Agray zu.
Er deutete mit dem Finger darauf und rief: »TORPEDO!«
Im nächsten Augenblick packte Moore Kayani von hinten und stieß ihn über die Reling ins Wasser. Als er selbst hineinsprang, traf der Torpedo die Agray. Das Donnern und Blitzen der folgenden Explosion war so surreal wie schockierend nahe. Mehrere Wellen von Metalltrümmern schwirrten durch die Luft, prallten vom Rumpf der Quwwat ab und peitschten wie eiserne Regengüsse in das umliegende Wasser.
Moores Augen weiteten sich, als die dampfende, zischende See auf sie zukam, die jetzt von den glühend heißen Metallsplittern aus dem Rumpf, den Decks und dem Torpedo erhitzt wurde, die bei jeder weiteren Explosion von der Agray aufstiegen. Als er ins Wasser eintauchte, wobei er fast auf einem scharf gezackten Stück Stahl gelandet wäre, explodierten die GRAIL-Boden-Luft-Gefechtsköpfe der Agray und sämtliche ASW-Raketen auf ihrem Vorderdeck in einem riesigen Feuerball.
Moore wurde unter das Wasser gedrückt, wobei seine Schuhe mit etwas unter ihm kollidierten. Er schwamm zur Oberfläche zurück und schaute sich um, ob er den Leutnant entdecken konnte. Da war er, gar nicht weit entfernt.
Plötzlich schlugen drei ASW-Raketen der Agray in die Gehäuse der Silkworm-Raketen an Bord der Quwwat ein. Die nachfolgenden Detonationen waren so laut und hell, dass Moore untertauchte, um sich zu schützen. Dann schwamm er zum Leutnant hinüber, der in Rückenlage auf dem Wasser trieb und anscheinend bewusstlos war. Auf der linken Seite seines Kopfes war ein tiefer Schnitt zu erkennen, der immer noch heftig blutete. Er hatte sich wohl an einem scharfen Trümmerstück verletzt, als er auf dem Wasser aufkam. Moore tauchte an der Schulter des Mannes wieder auf und spritzte Salzwasser auf die Wunde, während ihn Kayani mit leerem Blick anstarrte. »Leutnant! Aufwachen! Schnell!«
30 Meter von ihnen entfernt trieb brennender Diesel-treibstoff auf der Meeresoberfläche. Der Gestank war so entsetzlich, dass Moore das Gesicht verzog. Gleichzeitig spürte er zum ersten Mal fast körperlich das tiefe Brummen der Dieselmotoren – das U-Boot. Er hatte keine Eile und würde sich den Wracks auf keinen Fall nähern, bevor die Flammen erloschen waren.
Offensichtlich trieben auch noch andere Männer im Wasser. Obwohl sie kaum zu erkennen waren, hörte man zwischen den einzelnen Explosionen ihre Rufe. Ganz in der Nähe erklang jetzt ein erstickter Schrei. Moore suchte mit den Augen die Umgebung nach dem Taliban-Gefangenen ab, aber der doppelte Donnerschlag einer weiteren Detonation brachte ihn erneut zum Abtauchen. Als er sich, zurück an der Oberfläche, umdrehte, wies die Quwwat bereits eine bedenkliche Schlagseite nach Backbord auf und drohte jeden Augenblick zu sinken. Der Bug der Agray war sogar schon völlig überspült. Überall wüteten Feuer, und schwarzer Rauch stieg auf. Immer noch ging mit scharfem Knall und dumpfem Wummern Munition hoch. Die Luft war von einem beißenden Dunst erfüllt, der nach brennendem Gummi und Kunststoff roch.
Obwohl er die Feuerhitze bereits deutlich im Gesicht spürte, zwang sich Moore, ruhig zu bleiben. Er zog die Schuhe aus, knotete die Schnürsenkel zusammen und hängte sie sich um den Hals. Bis zum Ufer sind es fünf Kilometer … allerdings hatte er keine Ahnung, in welcher Richtung dieses Ufer lag. Wohin auch immer er blickte, mit Ausnahme der lodernden Flammen war es stockdunkel. Jedes Mal, wenn er auf die Feuersbrunst schaute, war danach seine Nachtsicht für einige Zeit gleich null.
Lichtblitz – Lichtblitz – Lichtblitz. Einen Augenblick. Er versuchte, sich zu erinnern. Er begann zu zählen … eins eintausend, zwei eintausend … bei neunzehn wurde er durch drei weitere kurze Lichtblitze belohnt. Jetzt wusste er, wo der Turshian-Mouth-Leuchtturm lag.
Moore zog Kayani an sich heran, um ihn zu stabilisieren. Der Leutnant, der immer wieder das Bewusstsein verlor, schaute Moore jetzt groß an. Als er jedoch das Feuer vor ihnen bemerkte, geriet er in Panik. Er streckte die Hand aus und packte Moore mit aller Kraft am Kopf. Offensichtlich wusste er gar nicht genau, was er da tat, wie es bei Menschen unter Schock ja oft der Fall ist. Moore musste allerdings sofort darauf reagieren, sonst hätte ihn der rasende Leutnant leicht ertränkt.
Moore presste also seine Handflächen mit ausgestreckten Fingern an Kayanis Hüften, wobei er diesem die Daumen fest in die Seite presste. Danach drückte er Kayani in eine horizontale Lage zurück. Durch den Hebeleffekt gelang es ihm, den Griff des Mannes zu lösen. Als Moore seinen Kopf wieder frei bewegen konnte, schrie er: »Ganz ruhig! Ich lasse Sie nicht im Stich! Tief durchatmen!« Dann packte er ihn am Kragen. »Ab jetzt ziehe ich Sie. Lassen Sie sich einfach auf dem Rücken treiben.«
Moore wählte den Seitenschwimmstil, wie ihn die Kampfschwimmer benutzten, wenn sie im Einsatz Lasten hinter sich herziehen mussten. Mit dem Leutnant im Schlepptau schwamm er um die brennenden Trümmer herum. Dabei kamen sie manchmal den hell lodernden Diesellachen bedrohlich nahe. Moores Ohren begannen infolge der ständigen Donnerschläge und der wie ein ständiges lautes Fauchen klingenden Geräusche der Brände allmählich zu schmerzen.
Kayani blieb ruhig, bis sie auf die Leichen einiger seiner Männer stießen, die reglos im Wasser trieben. Er rief laut ihre Namen, und Moore verdoppelte seine Anstrengungen, um möglichst schnell von ihnen wegzukommen. Trotzdem wurde das Meer immer grausiger. Immer wieder schwammen einzelne Gliedmaßen, hier ein Arm, dort ein Bein, an ihnen vorbei. Vor ihnen tauchte etwas Dunkles auf. Auf dem Wasser trieb ein Turban. Der Turban des Gefangenen. Moore hielt an und schaute nach rechts und nach links, bis er eine leblose Gestalt ausmachte, die auf den Wellen dümpelte. Er schwamm hinüber und drehte den Körper auf die Seite, bis er das bärtige Gesicht, den schwarzen Overall und den schrecklichen Schnitt quer über die Kehle erkennen konnte, der dessen Halsschlagader durchtrennt hatte. Es war ihr Mann. Moore biss die Zähne zusammen und packte Kayani wieder fest am Kragen. Bevor er weiterschwamm, schaute er in Richtung des Unterseeboots. Es war bereits verschwunden.
In seiner Zeit bei den SEALs konnte Moore auf offener See ohne Flossen eine Strecke von 3,2 Kilometer in weniger als 70 Minuten schwimmen. Mit einem anderen Mann im Schlepptau war das natürlich nicht möglich, aber er war entschlossen, auch diese Aufgabe zu meistern.
Er konzentrierte sich auf den Leuchtturm, atmete ruhig und stieß sich methodisch und regelmäßig mit den Beinen vorwärts. Seine Bewegungen waren bedachtsam und flüssig, er vergeudete keine Energie. Jeder Arm- und Beinschwung lenkte die Kraft dorthin, wo sie gebraucht wurde. Immer wieder hob er kurz den Kopf über Wasser, machte einen tiefen Atemzug, um danach seinen Weg mit der Präzision einer Maschine fortzusetzen.
Plötzlich hörte er hinter sich jemand rufen. Als er anhielt und sich umdrehte, entdeckte er eine kleine Gruppe von vielleicht 10 bis 15 Männern, die ihn mit aller Macht zu erreichen versuchten.
»Folgt mir einfach!«, rief er ihnen zu. »Folgt mir.«
Jetzt versuchte er nicht nur, Kayani zu retten. Er musste die übrigen Überlebenden motivieren, mit ihm zusammen das Ufer zu erreichen. Dies waren zwar Marinesoldaten, die ein hartes Schwimmtraining absolviert hatten. Trotzdem waren 5 Kilometer auf offener See eine entsetzlich lange Strecke, vor allem wenn man sie mit Verletzungen zurücklegen musste. Deshalb durften sie ihn auf keinen Fall aus den Augen verlieren.
In seinem Schwimmarm und seinen Beinen sammelte sich immer mehr Milchsäure an. Der Muskelkater wurde von Meter zu Meter schlimmer. Er schraubte seine Geschwindigkeit etwas zurück und schüttelte die Beine und den überbeanspruchten Arm, atmete noch einmal tief durch und befahl sich selbst: Ich werde nicht aufgeben. Niemals.
Von nun an konzentrierte er sich auf diesen Gedanken. Er würde seine Gruppe anführen und alle diese Männer heil an Land bringen – selbst wenn ihn dies das Leben kosten sollte. Er geleitete sie durch die steigenden und fallenden Wogen, ein Schwimmstoß und ein Beinschwung nach dem anderen, auch wenn ihm diese zunehmend schwerer fielen. Er lauschte den Stimmen aus seiner Vergangenheit, den Stimmen seiner Ausbilder und ersten Vorgesetzten, die ihr Leben der Aufgabe gewidmet hatten, bei ihm und vielen anderen den Kampfgeist zu wecken, der tief in ihrem Herzen geschlummert hatte.
Fast 90 Minuten später hörte er zum ersten Mal die Uferbrandung. Jedes Mal, wenn ihn die Wellen emportrugen, sah er, dass sich zahlreiche Taschenlampen am Strand entlangbewegten. Wo es Taschenlampen gab, musste es auch Menschen geben. Sie waren ans Ufer geeilt, um die Brände und Explosionen draußen auf dem Meer zu beobachten. Jetzt würden sie wohl bald auch ihn bemerken. Moores Geheimoperation würde bald kein Geheimnis mehr sein. Er fluchte und warf einen Blick nach hinten. Die Gruppe der Überlebenden war mindestens 50 Meter zurückgefallen. Sie hatten mit Moores strammem Tempo nicht mithalten können. Jetzt konnte er sie kaum noch sehen.
Als seine nackten Füße den sandigen Boden berührten, war Moore völlig fertig und ließ alles, was er noch bei sich hatte, in der Arabischen See zurück. Kayani kam immer noch nur kurz zu Bewusstsein, als ihn Moore durch die Brandung schleppte und auf den Strand zog, wo sich sogleich fünf oder sechs Dorfbewohner um die beiden scharten. »Ruft Hilfe herbei!«, brachte er gerade noch heraus.
In der Entfernung schlugen immer noch Flammen hoch. Es wirkte wie ein Hitzegewitter, das ein Negativbild der Wolken hervorrief. Die Silhouetten der beiden Schiffe waren jedoch verschwunden, nur der Rest des auf dem Wasser schwimmenden Treibstoffs brannte weiterhin ab.
Moore zog sein Handy heraus, aber es hatte den Geist aufgegeben. Wenn er das nächste Mal Gefahr lief, von einem U-Boot angegriffen zu werden, wollte er sich zuvor eine wasserdichte Version zulegen. Er bat einen der Dörfler, einen milchbärtigen Jungen im Oberschulalter, ihm sein Mobiltelefon zu leihen.
»Ich habe gesehen, wie die Schiffe explodiert sind«, stieß der Junge atemlos hervor.
»Ich auch«, blaffte ihn Moore an, um dann jedoch freundlicher hinzuzufügen: »Danke für das Handy.«
»Geben Sie es mir«, rief Kayani vom Strand herüber. Seine Stimme klang zwar noch recht brüchig, aber er schien jetzt doch wieder klar im Kopf zu sein. »Mein Onkel ist Oberst in der Armee. Er schickt uns innerhalb einer Stunde einen Hubschrauber. Das ist der schnellste Weg, um hier wegzukommen.«
»Hier, nehmen Sie es«, sagte Moore. Er hatte die Karten genau gelesen und wusste deshalb, dass es mit dem Auto bis zum nächsten Krankenhaus Stunden dauern würde. Als Treffpunkt der beiden Schiffe hatte man ja ganz bewusst einen Punkt vor einer dünn besiedelten ländlichen Küste ausgewählt.
Kayani erreichte seinen Onkel. Dieser versprach ihm, sofort einen Helikopter loszuschicken. Danach rief Kayani seinen Kommandeur an und bat ihn, eine Rettungsoperation der Küstenwache anzufordern, die nach weiteren Schiffbrüchigen suchen sollte. Allerdings verfügte die pakistanische Küstenwacht nicht über Rettungshubschrauber, und ihre in China gebauten Korvetten und Patrouillenboote würden erst am Spätvormittag eintreffen. Moore fing erneut an, die Brandung zu beobachten. Jede anrollende Welle suchte er mit den Augen nach eventuellen Überlebenden ab.
Fünf Minuten. Zehn. Nichts. Keine einzige Seele. Er musste an das Blut und die abgerissenen Körperteile denken, auf die sie im Wasser immer wieder gestoßen waren. Die hatten inzwischen bestimmt alle Haie der näheren und weiteren Umgebung angelockt. Die wohl überwiegend verwundeten Schwimmer hatten deren Angriffen wahrscheinlich nicht viel entgegenzusetzen.
Nach einer halben Stunde entdeckte Moore den ersten leblosen Körper, der wie ein Stück Treibholz auf den Wellen dümpelte und schließlich an Land gespült wurde. Viele andere würden folgen.
Erst nach über einer Stunde näherte sich von Nordwesten ein Mi-17-Helikopter. Das Dröhnen seiner beiden Turbinen und das laute Sirren der Rotoren wurden von den Hügeln der Umgebung wie ein Echo zurückgeworfen. Der Hubschrauber war von den Sowjets speziell für ihren Krieg in Afghanistan entwickelt worden und schließlich sogar zu einem Symbol dieses Konflikts geworden, als diese Goliathe der Lüfte von den afghanischen Davids immer häufiger vom Himmel geholt wurden. Die pakistanische Armee verfügte über fast hundertdieser Mi-17. Moore hatte sich dieses eigentlich recht triviale Detail deshalb gemerkt, weil er schon öfter als Passagier in einem Mi-17 mitgeflogen war. Einmal hatte sich dabei der Pilot laut über diesen »Schrotthaufen« beklagt, der bei jedem zweiten Einsatz den Geist aufgeben würde. Auch die anderen fast hundert Exemplare der pakistanischen Armee seien in keinem besseren Zustand.
Leicht beunruhigt bestieg Moore den Hubschrauber, der ihn und Kayani jedoch schnell und sicher in das Sindh-Government-Krankenhaus in Liaquatabad Town, einem Vorort von Karatschi, beförderte. Unterwegs verabreichten die Sanitäter dem pakistanischen Leutnant so starke Schmerzmittel, dass sich dessen verzerrte Gesichtszüge zusehends entspannten. Als sie landeten, ging gerade die Sonne auf.
Etwa eine Stunde später fuhr Moore mit dem Aufzug in den ersten Stock des Krankenhauses hinauf, um Kayani in seinem Krankenzimmer zu besuchen. Den Leutnant würde ab jetzt eine hübsche Kampfnarbe zieren, was es ihm bestimmt leichter machen würde, schöne junge Frauen ins Bett zu bekommen … Beide Männer waren stark dehydriert, weswegen der Pakistani jetzt auch am Tropf hing.
»Wie geht es Ihnen?«
Kayani hob mit Mühe den Arm und griff an seinen Kopfverband. »Ich habe immer noch Kopfschmerzen.«
»Das geht vorbei.«
»Allein hätte ich es nicht zurückgeschafft.«
Moore nickte. »Es hatte Sie ganz schön erwischt, und Sie haben ziemlich viel Blut verloren.«
»Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ein schlichtes Dankeschön genügt wohl nicht.«
Moore nahm einen tiefen Schluck aus der Wasserflasche, die ihm eine Krankenschwester gereicht hatte. »Hey, geschenkt, das war doch selbstverständlich.« Eine Bewegung auf dem Gang erregte Moores Aufmerksamkeit. Es war Douglas Stone, ein CIA-Kollege, der jetzt über seinen grau melierten Bart strich und ihn über den Rand seiner Brille hinweg fixierte. »Ich muss gehen«, sagte Moore.
»Mr. Fredrickson, warten Sie einen Moment.«
Moore runzelte die Stirn.
»Kann ich Sie irgendwie erreichen?«
»Sicher, warum?«
Kayani blickte Stone an und spitzte den Mund.
»Oh, er ist okay. Ein guter Freund.«
Der Leutnant zögerte noch ein paar Sekunden und sagte dann: »Ich möchte Ihnen danken … irgendwie.«
Moore riss von einem kleinen Block auf dem Nachttischchen ein Blatt Papier ab, kritzelte darauf eine E-Mail-Adresse und reichte den Zettel dem Leutnant.
Dieser umklammerte den Zettel mit der Faust. »Ich melde mich.«
Moore zog die Schultern hoch. »Okay.«
Auf dem Gang warf er Stone einen scharfen Blick zu und zischte ihn an: »Also, Doug, erzähl mal … was zum Teufel ist da draußen passiert?«
»Ich weiß, ich weiß.« Stone wählte seinen üblichen beruhigenden Ton. Dieses Mal kam er jedoch bei Moore damit nicht durch.
»Wir haben den Indern ausdrücklich versichert, dass es bei der Übergabe keinerlei Probleme geben würde. Sie mussten ja in pakistanisches Hoheitsgewässer einfahren. Deshalb waren sie äußerst besorgt.«
»Uns hat man gesagt, dass die Pakistani alles arrangieren würden.«
»Und wer hat dann Scheiße gebaut?«
»Angeblich hat der U-Boot-Kommandant nie den Befehl erhalten, in diesem Zeitraum im Hafen zu bleiben. Jemand hat das wohl vergessen. Er war dann auf seiner üblichen Patrouillenfahrt und dachte, er habe eine indische Geheimoperation entdeckt. Er gibt an, dass er die Schiffe mehrmals vergeblich aufgefordert habe, sich zu identifizieren.«
Moore kicherte. »Na ja, nach ihm Ausschau gehalten haben wir tatsächlich nicht – und als wir ihn dann sahen, war es bereits zu spät.«
»Der Kommandant hat auch noch berichtet, er habe an Bord der Inder Gefangene gesehen, die er für Pakistani gehalten habe.«
»Er war also bereit, auf seine eigenen Leute zu schießen?«
»Schon möglich.«
Moore blieb abrupt stehen, wirbelte herum und starrte seinen Kollegen an. »Der einzige Gefangene, den sie hatten, war unser Taliban-Typ.«
»Schon gut, Max, ich weiß, was du gerade hinter dir hast.«
»Schwimm fünf Kilometer mit mir durchs offene Meer, dann weißt du es wirklich.«
Stone nahm seine Brille ab und rieb sich die Augen. »Sieh mal, es könnte schlimmer sein. Wir könnten jetzt auch unsere Botschafter in Delhi sein und uns überlegen müssen, wie wir uns so bei den Indern entschuldigen, dass sie keine Atombombe auf Islamabad werfen.«
»Das wäre nett – denn dort muss ich als Nächstes hin.«
1
Entscheidungen
Marriott-Hotel
Islamabad, Pakistan
Drei Wochen später
Leutnant Maqsud Kayani wollte sich bei Moore für seine Rettung bedanken, indem er ihn mit seinem Onkel, dem pakistanischen Armeeoberst Saadat Khodai, bekannt machte. Nach seiner Ankunft in Islamabad fand Moore eine E-Mail mit diesem Vorschlag in seiner Mailbox. Kayani teilte ihm vor dem ersten Treffen sogar mit, dass sein Onkel, der ihre Rettung mit dem Hubschrauber organisiert hatte, wegen eines ethischen Dilemmas in letzter Zeit unter Depressionen leide. Die E-Mail enthüllte zwar nicht die genaue Natur dieser seelischen Krise, aber Kayani betonte, dass eine solche Begegnung sowohl für seinen Onkel wie auch für Moore ausgesprochen nützlich sein könnte.
Dem ersten Treffen folgten dann viele weitere und lange Gespräche. Moore dämmerte es allmählich, dass Khodai die Namen einiger hoher Armeeoffiziere kannte, die heimlich die Taliban aktiv unterstützten. Daraufhin trank er viele Liter Tee mit dem Oberst und versuchte ihn dazu zu bringen, ihm alles zu erzählen, was er über die Infiltration der Taliban und deren Aktivitäten in den Stammesgebieten im Nordwesten des Landes wusste. Dabei interessierte er sich vor allem für die Region, die als Waziristan bekannt ist. Der Oberst zögerte jedoch lange, mit diesen Informationen herauszurücken. Für ihn war das wohl ein schwerer Tabubruch. Moore wurde immer frustrierter, wenngleich er Khodai auch gut verstehen konnte.
Der Oberst machte sich nicht nur Sorgen um mögliche Gefahren für seine Familie. Er musste auch gegen seine tiefsitzende persönliche Überzeugung ankämpfen, niemals etwas Negatives über seine Offizierskameraden zu sagen oder diese auf irgendeine andere Art und Weise zu verraten, selbst wenn sie ihren Treueid gegenüber Pakistan und seiner geliebten Armee gebrochen hatten. Seine Gespräche mit Moore brachten ihn jedoch allmählich dazu, an seiner Haltung zu zweifeln. Wenn nicht diesem Mann, wem sollte er dann erzählen, was er wusste?
Eines Abends rief er Moore an und teilte ihm mit, dass er jetzt zu einer Aussage bereit sei. Moore holte ihn in seinem Haus ab und fuhr ihn in das Hotel, wo bereits zwei weitere CIA-Agenten auf die beiden warteten. Auf dem Gästeparkplatz des Marriott stellte er das Auto ab.
Khodai war gerade fünfzig geworden, und sein dichtes, kurz geschnittenes Haar war bereits voller grauer Strähnen. Seine Augen wirkten müde und klein. Sein vorstehendes Kinn zierte ein schneeweißer Dreitagebart. Er trug Zivilkleidung, eine schlichte Hose und ein Oberhemd ohne Krawatte. Nur die Militärstiefel verrieten seinen Beruf. Sein BlackBerry steckte fest in einem Lederetui, das er jetzt nervös zwischen seinem Daumen und Mittelfinger drehte.
Als Moore gerade die Autotür öffnen wollte, hob Khodai die Hand. »Warten Sie. Ich habe zwar gesagt, dass ich bereit bin, aber vielleicht brauche ich doch noch etwas Zeit.«
Der Oberst hatte sein Englisch in der Highschool gelernt und danach die Universität des Punjab in Lahore besucht, wo er ein Ingenieurexamen abgelegt hatte. Trotz seines schweren Akzents verfügte er über einen eindrucksvollen englischen Wortschatz. Sein Tonfall war absolut souverän und beherrschend. Moore konnte gut nachvollziehen, warum er so schnell aufgestiegen war und Karriere gemacht hatte. Wenn er sprach, zog er automatisch die Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf sich. Moore entspannte sich, ließ den Türgriff los und sagte: »Sie sind dazu bereit. Und Sie werden sich zuletzt auch selbst vergeben.«
»Glauben Sie das wirklich?«
Moore wischte sich eine verirrte Haarsträhne aus dem Auge, seufzte und antwortete: »Ich wünsche es mir wenigstens.«
Sein Gegenüber grinste schwach. »Sie haben eine mindestens so schwere Last und Verantwortung zu tragen wie ich.«
»Wie kommen Sie denn darauf?«
»Ich erkenne einen Ex-Militär, wenn ich einen sehe. Und in Ihrem jetzigen Beruf haben Sie bestimmt eine Menge erlebt!«
»Kann sein. Aber Sie müssen sich die Frage stellen, welche Last schwerer wiegt? Etwas zu unternehmen oder nichts zu tun?«
»Sie sind noch ein sehr junger Mann, aber offensichtlich ziemlich weise für Ihr Alter.«
»Ich kann Ihre Bedenken gut verstehen.«
Khodai hob die Augenbrauen. »Habe ich Ihr Versprechen, dass man meine Angehörigen schützen und ihnen nichts passieren wird?«
»Darauf können Sie sich verlassen. Was Sie tun werden, wird viele Leben retten. Aber das wissen Sie ja selbst.«
»Natürlich. Aber ich bringe ja nicht nur mich und meine Karriere in Gefahr. Sowohl die Taliban als auch meine Offizierskollegen kennen keine Gnade. Sie sind absolut skrupellos. Ich habe immer noch die Sorge, dass selbst Ihre Freunde uns nicht helfen können – trotz all Ihrer Versicherungen.«
»Dann werde ich nicht weiter in Sie dringen. Es ist ganz allein Ihre Entscheidung. Wir wissen beide, was passieren wird, wenn Sie jetzt nicht dort hinaufgehen. Immerhin das können wir voraussagen.«
»Sie haben recht. Ich kann nicht länger still dasitzen und zusehen. Sie werden uns unser Handeln nicht mehr vorschreiben. Sie werden uns nicht unserer Ehre berauben. Niemals.«
»Nun, ich kann nur mein Angebot wiederholen, dass wir Ihre Familie in die Vereinigten Staaten bringen. Dort könnten wir sie viel besser beschützen.«
Der Oberst schüttelte den Kopf und rieb sich die Schläfen. »Ich kann ihr Leben nicht einfach so aus dem Lot bringen. Meine Söhne gehen beide noch auf die Oberschule. Meine Frau wurde gerade erst befördert. Sie arbeitet in dem Technikzentrum ganz hier in der Nähe. Pakistan ist unsere Heimat. Die werden wir auch niemals verlassen.«
»Dann helfen Sie uns, Ihre Heimat besser und sicherer zu machen.«
Khodai schaute Moore mit großen Augen an. »Was würden Sie an meiner Stelle tun?«
»Ich würde den Terroristen nicht den Sieg überlassen, indem ich nichts tue. Zweifellos ist das die schwerste Entscheidung Ihres Lebens. Ich weiß das. Ich nehme das auch nicht auf die leichte Schulter. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich Sie für das respektiere, was Sie jetzt tun werden. Das erfordert viel Mut. Sie sind ein Mann, der für Gerechtigkeit steht. Also, ja, wenn ich Sie wäre, würde ich diese Autotür öffnen und mit mir zu meinen Freunden hinaufgehen. Damit werden wir auch die Ehre der pakistanischen Armee retten.«
Khodai schloss die Augen und sein Atem wurde flach. »Sie klingen wie ein Politiker, Mr. Moore.«
»Mag sein, aber im Unterschied zu jenen glaube ich an das, was ich sage.«
Khodai musste ganz leicht grinsen. »Ich hätte eigentlich gedacht, dass Sie vor Ihrer Militärzeit ein privilegiertes Leben geführt haben.«
»Ganz und gar nicht.« Moore dachte einen Moment nach. »Sind Sie bereit, Oberst?«
Der pakistanische Offizier schloss die Augen. »Ja, bin ich.«
Sie stiegen aus und gingen quer über den Parkplatz zu dem von einer Markise gekrönten Haupteingang des Hotels hinüber. Moore ließ die Augen über die Straße und den Parkplatz wandern. Er schaute sogar zu den Dächern der umliegenden Gebäude empor, ohne jedoch etwas Verdächtiges zu bemerken. Sie gingen an den Taxifahrern vorbei, die sich an die Motorhaube ihrer Fahrzeuge lehnten und rauchten. Sie nickten den jungen Hotelpagen zu, die vor einem kleinen Pult und einem Wandkasten standen, in dem Dutzende von Schlüsseln hingen. Die Eingangswand war offensichtlich vor kurzer Zeit wegen befürchteter Bombenanschläge verstärkt worden. In einer Sicherheitsschleuse wurden sie auf Sprengstoff und Waffen geröntgt. Sie betraten die mit elfenbeinfarbenen, hell glänzenden Marmorplatten ausgelegte Lobby. Hinter dem kunstvoll verzierten Check-in-Schalter beschäftigte sich das dunkel gekleidete Empfangspersonal mit den Gästen. Ein bärtiger Mann in einem weißen Baumwollanzug spielte auf einem links von ihnen stehenden Stutzflügel eine sanfte Melodie. Am Schalter warteten einige Männer, die Moore für Geschäftsleute hielt. Sonst wirkte das Hotel ruhig und einladend. Er nickte Khodai kurz zu, und sie gingen zu den Aufzügen.
»Haben Sie Kinder?«, fragte Khodai, während sie auf den Lift warteten.
»Nein.«
»Hätten Sie gern welche?«
»Dazu müsste ich ein anderes Leben führen. Ich bin zu viel unterwegs. Das wäre Kindern gegenüber nicht fair. Warum fragen Sie?«
»Weil alles, was wir tun, eine bessere Welt für unsere Kinder schaffen soll.«
»Sie haben recht. Na ja, vielleicht später einmal.«
Khodai legte eine Hand auf Moores Schulter. »Opfern Sie sich nicht für Ihren Dienstherrn auf. Das werden Sie später bereuen. Werden Sie Vater, und die Welt sieht auf einmal ganz anders aus.«
Moore nickte. Er hätte Khodai gerne von den vielen Frauen erzählt, mit denen er über die Jahre zusammen gewesen war, und über all die Beziehungen, die seiner Karriere in der Navy und der CIA zum Opfer gefallen waren. Einige Leute behaupteten, die Scheidungsrate der SEALs betrage fast 90 Prozent. Wie viele Frauen wollten auch einen Mann, den sie kaum je zu Gesicht bekommen würden? Die Ehe wurde dann fast so etwas wie eine Affäre. Eine von Moores Ex-Freundinnen wäre das sogar ganz recht gewesen. Sie wollte einen anderen Mann heiraten, dabei jedoch die Beziehung zu ihm aufrechterhalten. Sie schätzte seinen Humor und die körperlichen Freuden, die er ihr bereitete und die ihr der andere Mann nicht bieten konnte. Dieser sollte sie dagegen finanziell unterhalten und als Gefühlskissen dienen. Mit einem Ehemann für das Alltagsleben und einem Navy-SEAL für die schönen Stunden hätte sie das Beste aus beiden Welten gehabt. Allerdings wollte Moore dieses Spiel dann doch nicht mitmachen. Zu seinem Unglück hatte er auch mit zu vielen Callgirls, Stripperinnen und verrückten betrunkenen Frauen das Lager geteilt, als dass er sie überhaupt noch zählen konnte. Allerdings war er in den letzten Jahren ruhiger geworden. In seinen Hotelbetten brauchte er normalerweise nur noch ein einziges Kissen. Seine Mutter lag ihm ständig in den Ohren, er solle sich endlich ein nettes Mädchen suchen und ein ruhigeres Leben führen. Er lachte dann nur und erklärte ihr, dass ein solches Leben für ihn unmöglich sei, weswegen er auch kein solches »nettes Mädchen« finden werde. Dann fragte sie ihn gewöhnlich: »Glaubst du nicht, dass du etwas zu selbstsüchtig bist?« Er akzeptierte diese Aussage. Er könne gut verstehen, dass sie Enkel wolle, aber sein Job verlange ihm viel zu viel ab. Er fürchte, dass ein ewig abwesender Vater viel schlimmer sei als überhaupt kein Vater.
Sie meinte darauf, er solle diesen Job eben an den Nagel hängen. Er entgegnete ihr, dass er nach all dem Kummer, den er ihr gemacht habe, endlich für sich einen Platz in dieser Welt gefunden habe. Den könne er nicht einfach so aufgeben. Niemals.
All das hätte er jetzt gerne Khodai mitgeteilt, denn sie schienen verwandte Seelen zu sein. Aber gerade jetzt erklang die Aufzugsglocke, und die Tür des Lifts öffnete sich. Sie gingen hinein. Als sich die Türen schlossen, schien der Oberst plötzlich noch blasser zu werden.
Schweigend fuhren sie in den vierten Stock hinauf. Als die Türen aufgingen, bemerkte Moore die Umrisse eines Mannes, der am anderen Ende des Ganges im Türrahmen des Treppenhauses stand. Es war ein Agent des pakistanischen Militärgeheimdiensts ISI. Dessen Gehörschutz erinnerte Moore an etwas. Er wollte sein Smartphone aus der Tasche holen, um den anderen CIA-Agenten mitzuteilen, dass sie sich jetzt ihrer Zimmertür näherten. Er musste jedoch feststellen, dass er es im Auto vergessen hatte. Er fluchte leise vor sich hin.
Er klopfte und rief: »Ich bin’s, Leute.«
Die Tür öffnete sich und Agentin Regina Harris bat ihn und Khodai herein. Drinnen wartete bereits ihr Kollege Douglas Stone.
»Ich habe mein Handy im Auto gelassen«, sagte Moore. »Ich bin gleich wieder zurück.«
Als Moore den Gang zurückging, bemerkte er neben den Aufzügen einen zweiten Agenten. Eine kluge Maßnahme. Auf diese Weise konnte der ISI die gesamten Zugänge zum vierten Stock überwachen. Der zweite Mann war ein kleiner Kerl mit großen braunen Augen, der nervös in sein Handy hineinsprach. Er trug ein blaues Anzughemd, braune Hosen und schwarze Sportschuhe. Seine Gesichtszüge erinnerten an eine Maus.
Als der Mann Moore erblickte, ließ er sein Telefon sinken und ging mit schnellen Schritten in Richtung Treppenhaus. Einen Moment lang stand Moore verdutzt da. Er ging noch ein paar Schritte weiter. Dann machte er schlagartig kehrt, um in ihr Hotelzimmer zurückzukehren.
In diesem Augenblick fegte eine Feuerwalze, gefolgt von einer Explosionswelle durch den Gang. Die herumfliegenden Trümmer stießen Moore zu Boden. Als Nächstes drang dichter Rauch aus dem Zimmer und erfüllte bald wie eine dunkle Wolke den ganzen Flur. Moore richtete sich auf Hände und Knie auf. Er fluchte laut, seine Augen brannten höllisch und der beißende Gestank der Bombe erschwerte ihm das Atmen. Seine Gedanken rasten. Er musste an die Bedenken des Obersts denken. Fast erschien es ihm, als ob sie in dieser Explosion Gestalt angenommen hätten. Moore wusste, dass seine Kollegen und Khodai von der gewaltigen Wucht des Sprengkörpers in Stücke gerissen worden waren. Diese Vorstellung brachte ihn wieder auf die Beine. Er begann, in Richtung des inzwischen vollkommen leeren Treppenhauses zu rennen, durch das dieser Bastard von Attentäter entkommen sein musste.
Die Jagd ließ ihm keine Zeit für irgendwelche Schuldgefühle, wofür Moore ausgesprochen dankbar war. Wenn er nur eine einzige Sekunde darüber nachgedacht hätte, dass er Khodai davon überzeugt hatte, er »tue hier das Richtige«, und dieser jetzt durch die mangelnden Sicherheitsmaßnahmen seines Teams sein Leben verloren hatte, wäre er vielleicht zusammengebrochen. Das war wahrscheinlich Moores größte Schwäche. In seinem Einsatzbericht hatte ihn ein Vorgesetzter einst als »äußerst gefühlsbetonten Mann« bezeichnet, »der sich immer sehr um seine Kameraden sorgt«. Dies erklärte auch, warum ihn ein ganz bestimmtes Gesicht aus seiner Navy-SEAL-Vergangenheit immer noch verfolgte. Khodais jäher Tod hatte ihn wieder einmal an diese schlimme Nacht erinnert.
Als er das Treppenhaus hinunterschaute, erblickte er weiter unten den Mann. Er sprang die Stufen hinab. Moore biss die Zähne zusammen und jagte ihm nach, wobei er mithilfe des Geländers drei oder vier Stufen auf einmal nahm. Gleichzeitig fluchte er, weil seine Pistole immer noch drunten im Auto lag. Man hatte ihnen zwar erlaubt, das Hotel als Treffpunkt zu benutzen, aber sowohl die Sicherheitsleute des Hotels als auch die örtliche Polizei hatten ihnen strikt verboten, ihre eigenen Waffen zu führen. Niemand durfte bewaffnet das Gebäude betreten. Alle Verhandlungen über diese Frage waren fruchtlos verlaufen. Natürlich verfügten Moore und seine Kollegen über einige Waffentypen, die man unbemerkt durch die Sicherheitsschleuse bringen konnte. Sie hatten sich jedoch entschieden, diese nicht einzuschmuggeln, um die bereits recht angespannten Beziehungen zu den Pakistani nicht noch weiter zu belasten. Moore konnte eigentlich davon ausgehen, dass der Mann nicht bewaffnet war, wenn er den Sicherheitskontrollpunkt des ISI passiert hatte. Allerdings war Moore ja auch davon ausgegangen, dass ihr Hotelzimmer ein sicherer Treffpunkt sei. Sie hatten sich für eines der vier leeren Zimmer im vierten Stock entschieden, das auf die Straße hinausging, sodass sie das Kommen und Gehen der Gäste und den Verkehr vor dem Hotel überwachen konnten. Wenn sich die Verkehrsmuster plötzlich änderten, konnte dies ein Hinweis darauf sein, dass bald etwas Unerwartetes passieren würde. Sie nannten das ein Frühwarnsystem für Clevere. Zwar hatte ihnen kein Bombenspürhund zur Verfügung gestanden, aber sie hatten das Zimmer überaus sorgfältig nach elektronischen Geräten abgesucht. Außerdem hatten sie sich dort ein paar Wochen lang immer wieder getroffen, ohne dass irgendetwas ihren Verdacht erregt hatte. Dass es diese Verbrecher geschafft hatten, Sprengstoff in diesem Zimmer zu deponieren, machte ihn wütend und zugleich unheimlich traurig. Auch Khodai selbst hatte ohne Probleme die Sicherheitsschleuse passiert, deshalb musste Moore annehmen, dass er nicht verkabelt war oder Sprengstoff am Leib trug … außer natürlich, wenn die Sicherheitsschranke selbst ein Schwindel gewesen war und die Leute dort für die Taliban arbeiteten …
Der kleine Kerl legte ein unheimliches Tempo vor und hatte inzwischen bereits das Erdgeschoss erreicht, wo er durch die Treppenhaustür hinausflitzte. Sechs Sekunden später kam auch Moore unten an.
In der Hauptlobby schaute er zuerst nach links und dann rechts einen langen Gang hinunter, der zum Whirlpool, zum Fitnessraum und weiter zum rückwärtigen Parkplatz führte, der an ein ziemlich großes Waldstück grenzte.
Inzwischen herrschte im Rest des Hotels das absolute Chaos. Überall heulten die Alarmsirenen, die Sicherheitsleute schrien, und das Hotelpersonal rannte ziellos herum, während die Explosionsdämpfe in die Klimaanlage einzudringen begannen und sich im ganzen Gebäude der beißende Geruch von Sprengstoff ausbreitete.
Plötzlich entdeckte Moore den Mann in der Nähe des Hinterausgangs. Als er ihm nachsetzte, drehte sich dieser kurz um und verschärfte danach sein Tempo. Die Verfolgungsjagd erregte jetzt die Aufmerksamkeit zweier Zimmermädchen, die aufgeregt auf die beiden zeigten und laut nach den Sicherheitsleuten riefen. Gut, dachte Moore.
Es gelang ihm, allmählich den Abstand zu verkürzen. Der Typ drückte jetzt mit beiden Händen die Hintertür auf und verschwand nach draußen. Drei Sekunden später folgte ihm Moore in die angenehme Kühle der Nacht. Vor sich erblickte er den Mann, der offensichtlich in den Teil des Parkplatzes rannte, auf dem auch Moores Auto stand. Dies war für ihn wohl am günstigsten, weil direkt dahinter das Wäldchen begann. Moore hoffte, jetzt vielleicht doch noch seine Pistole aus dem Wagen holen zu können.
Seine Wut verlieh ihm regelrecht Flügel. Er wollte diesen Kerl auf keinen Fall entkommen lassen. Dies war nicht länger ein Entschluss oder ein Ziel, sondern eine kalte, harte Tatsache. Moore spielte dessen Gefangennahme in seinem Geist schon einmal durch. Wie erwartet, verfügte seine Beute nicht über die gleiche körperliche Ausdauer wie er. Der Mann wurde langsamer, als er seine Laktatschwelle erreichte, während Moore immer noch einiges zu bieten hatte … Er hetzte hinter ihm her wie ein Wolf, bis er ihm nahe genug war, um einen Angriff zu starten. Er trat ihm von hinten in die linke Kniekehle. Der Kerl schrie laut auf und stürzte auf den Grasboden, kurz bevor sie die Asphaltfläche des Parkplatzes erreicht hatten.
Moore erinnerte sich an die uralten Kampfregeln des Thaiboxens: »Der Tritt verliert gegen den Schlag, der Schlag verliert gegen das Knie, das Knie verliert gegen den Ellbogen und der Ellbogen verliert gegen den Tritt.«
Nun, dieser Scheißkerl hatte gerade gegen Moores gezielten Fußtritt verloren. Jetzt packte ihn der CIA-Agent an den Handgelenken, zog diese nach hinten und kniete sich auf ihn, um ihn niederzuhalten.
»Nicht bewegen! Du bist erledigt!«, sagte Moore auf Urdu, der Sprache, die man in dieser Stadt am häufigsten benutzte.
Der Mann hob den Kopf und versuchte, sich gegen Moores harten Griff zu wehren. Plötzlich verengten sich seine Augen und sein Mund öffnete sich in einem Ausdruck von – was war es? Schrecken? Schock?
Irgendwo hinter ihnen ertönte ein Peitschenschlag. Ein bekanntes Peitschen. Ein schrecklich bekanntes …
Im selben Augenblick explodierte der Kopf des Mannes. Sein Blut tränkte Moore von oben bis unten. Dieser reagierte darauf ganz instinktiv und ohne Überlegung. Die Muskelerinnerung und sein Selbsterhaltungstrieb befahlen ihm, den Mann sofort loszulassen und sich seitlich abzurollen.
Er schnappte nach Luft und rollte weiter. Sein Körper hatte dieses Verhalten während seines jahrelangen SEAL-Trainings so sehr verinnerlicht, dass er jetzt ganz automatisch agierte und reagierte.
Jetzt waren zwei weitere Schüsse zu hören. Die Kugeln schlugen keine 15 Zentimeter von Moores Rumpf entfernt im Boden ein. Der CIA-Agent sprang blitzschnell auf und versuchte, seinen Wagen zu erreichen, der in 10 Meter Entfernung vor ihm parkte. Er kannte diese Schusswaffe. Es war ein russisches Dragunow-Scharfschützengewehr. Da war er sich sicher. Er hatte selbst bereits damit geschossen, gesehen, wie es andere abfeuerten, und war auch schon früher mit einem beschossen worden. Die Waffe hatte eine Standardreichweite von 800 Meter, die sich bis auf 1300 Meter erweitern konnte, wenn der Schütze Erfahrung und ein gutes Zielfernrohr hatte. Das leicht zu wechselnde 10-Schuss-Magazin ermöglichte es dem Benutzer dieses Gewehres, ganz schön lange durchzuhalten.
Ein weiterer Schuss schlug ein Loch in die Autotür auf der Fahrerseite, gerade als Moore seinen Schlüssel aus der Tasche holte, um den Wagen mit der Zentralverriegelung aufzuschließen. Er eilte auf die andere Fahrzeugseite hinüber, um sich aus der Schusslinie zu bringen. Dann öffnete er die Beifahrertür.
Der nächste Schuss ließ die Windschutzscheibe zerspringen. Moore holte vorsichtig aus dem Handschuhfach seine Glock 30, Kaliber .45, auf deren Seite stolz die Herkunftsbezeichnung AUSTRIA prangte. Er lugte vorsichtig hinter seinem Auto hervor und suchte mit den Augen den Waldrand und die umliegenden Gebäude ab. Da war er. Er kniete auf dem Dach des zweistöckigen Technikzentrums direkt neben dem Hotel.
Er trug eine schwarze Wollmütze, sein Gesicht war jedoch deutlich zu erkennen. Schwarzer Bart. Weit geöffnete Augen. Eine breite Nase. Und es war tatsächlich eine Dragunow, wie Moore fast befriedigt feststellte. Auch das Zielfernrohr und das große Magazin waren deutlich zu erkennen. Der Schütze hielt es immer noch im Anschlag, während er einen Ellbogen auf dem Dachsims abstützte.
Jetzt hatte er Moore entdeckt. Er feuerte in schneller Folge drei Schüsse ab, die Geschosse bohrten sich in die Autotür, während Moore zur Fahrerseite seines Wagens zurückrobbte.
Nach dem dritten Einschlag richtete sich Moore auf, umklammerte den Griff seiner Pistole mit der linken Faust und erwiderte das Feuer. Seine Kugeln schlugen nur einige Dezimeter neben der Stelle in das Betondach ein, wo der Scharfschütze in etwa 40 Meter Entfernung kniete. Natürlich lag dies außerhalb der sicheren Reichweite seiner Glock. Moore nahm jedoch an, dass der Mann gerade keine ballistischen Berechnungen anstellen würde. Immerhin musste er damit rechnen, dass ihn auch ein Querschläger treffen könnte.
In diesem Augenblick tauchten vier Sicherheitsleute des Hotels auf dem Parkplatz auf. Moore deutete auf das Technikzentrum und rief ihnen zu: »Er ist dort oben! Geht in Deckung!«
Einer der Männer stürmte auf Moore zu, während die drei anderen sich hinter geparkten Autos in Sicherheit brachten.
»Keine Bewegung!«, befahl der Sicherheitsmann – dann schoss ihm der Heckenschütze den Kopf weg.
Einer seiner Kollegen schrie ganz aufgeregt in sein Funkgerät.
Als Moore seine Aufmerksamkeit wieder dem Nachbargebäude zuwandte, konnte er gerade noch erkennen, wie der Schütze auf der Ostseite geradezu spinnengleich eine Feuerleiter hinunterkletterte.
Moore versuchte, ihn abzufangen. Der Weg wurde jedoch uneben, das Gras wurde von einem Kiesboden abgelöst. Danach folgte erneut eine Asphaltfläche. Ein schmaler Durchgang zwischen dem Technikzentrum und einer Reihe einstöckiger Bürogebäude führte in nordwestlicher Richtung zur Aga Khan Road, der Hauptstraße, an der auch der Hoteleingang lag. In der Gasse roch es nach süßem Schweinefleisch, da die Abluftventilatoren der Hotelküche dort hinausgingen. Moore knurrte der Magen, obwohl er im Augenblick bestimmt nicht ans Essen dachte.
Ohne langsamer zu werden, bog er am Ende des Durchgangs nach links ab, wobei er seine Glock ständig in Anschlag hielt. Keine 20 Meter vor ihm stand mit laufendem Motor ein Toyota HiAce-Kastenwagen, aus dessen offenem Rückfenster sich zwei bewaffnete Männer lehnten.
Der Heckenschütze rannte auf den Van zu, der langsam anfuhr, und sprang dann auf den Beifahrersitz, während die Männer in den Rückfenstern ihre Gewehre auf Moore richteten. Dieser brachte sich gerade noch rechtzeitig in einer kleinen Mauernische in Sicherheit. Keine zwei Sekunden später wurden die Backsteine über ihm durch das heftige Feuer aus ihren Sturmgewehren zerlegt. Zweimal versuchte er, seinen Kopf so weit vorzustrecken, dass er das Nummernschild des Toyota erkennen konnte, aber der Beschuss war einfach zu stark. Das Schießen hörte erst auf, als der Van auf die Hauptstraße eingebogen war. Als Moore um die Ecke schaute, war er verschwunden.
Moore eilte zu seinem Auto zurück, griff nach seinem Handy und versuchte mit zitternder Hand, eine Nummer zu wählen. Er gab jedoch den Versuch auf, als sich immer mehr Sicherheitsleute um ihn scharten und deren Chef dringend Aufklärung verlangte, was hier eigentlich vor sich ging.
Moore musste unbedingt dafür sorgen, dass Aufklärungssatelliten den Van aufspürten.
Er musste seinen Leuten mitteilen, was passiert war.
Alle waren tot.
Aber im Moment hatte er erst einmal genug damit zu tun, seinen Atem zu beruhigen.
Saidpur VillageIslamabad, PakistanDrei Stunden später
Von dem reizvoll in den Margalla-Hügeln oberhalb von Islamabad gelegenen Saidpur Village genoss man einen großartigen Ausblick auf die Stadt. Die Reiseleiter brachten ihre Touristen hier herauf, um sie dort etwas spüren zu lassen, was sie die »Seele Pakistans« nannten.
Wenn diese Stadt eine Seele haben sollte, dann war sie gerade stark verdunkelt worden. Vom Marriott-Hotel stiegen immer noch dichte Rauchwolken in die glasklare Sternennacht auf. Moore stand auf dem Balkon eines stattlichen Hauses in Saidpur, das den CIA-Agenten vor Ort als geheimer Stützpunkt diente, und fluchte wieder einmal leise vor sich hin. Die Explosion hatte die Nachbarräume des ganzen Stockwerks zerstört, sodass schließlich das Dach des gesamten Gebäudeteils eingestürzt war. Moore rekapitulierte die Ereignisse, bevor er sich nach Saidpur zurückzog. Er hatte zusammen mit drei von ihm alarmierten CIA-Agenten, einem speziellen Forensik-Team und zwei Kriminaltechnikern das Hotel und seine Umgebung genau untersucht. Sie hatten dabei darauf geachtet, die privaten Sicherheitsleute des Hotels, die örtliche Polizei und ein Team des pakistanischen Geheimdiensts an ihren Untersuchungen zu beteiligen. Gleichzeitig hatten sie den herbeigeeilten Reportern der Associated Press einen stetigen Strom von Desinformationen geliefert. CNN berichtete daraufhin in den Nachrichten, dass in dem Hotel eine Taliban-Bombe hochgegangen sei. Diese hätten auch bereits die Verantwortung dafür übernommen. Mit dem Anschlag wollten sie sich für die Tötung von Mitgliedern einer mit ihnen verbündeten sunnitischen Extremistengruppe namens Sipah-e-Sahaba rächen, die angeblich Schiiten umgebracht hatten. Auch ein pakistanischer Armeeoberst sei versehentlich diesem Attentat zum Opfer gefallen. Die Namen der beteiligten Gruppen waren schwer auszusprechen und die berichteten Umstände überaus vage. Moore war überzeugt, dass die Geschichte mit jedem Pressebericht komplizierter und unübersichtlicher werden würde. Seine Kollegen in diesem Raum hatten nichts bei sich gehabt, das sie als Amerikaner oder gar als Mitglieder der CIA identifiziert hätte.
Als er jetzt auf diesem Balkon über der Stadt stand, hörte er plötzlich eine Stimme sagen: »Ich kann ihr Leben nicht einfach so aus dem Lot bringen. Meine Söhne gehen beide noch auf die Oberschule. Meine Frau wurde gerade erst befördert. Sie arbeitet in dem Technikzentrum ganz hier in der Nähe. Pakistan ist unsere Heimat. Die werden wir auch niemals verlassen.«
Moore umklammerte das steinerne Geländer, lehnte sich darüber und übergab sich. Er stand nur da, mit seinem Kinn auf den Arm gestützt, und wartete, bis dieser Anfall von Übelkeit vorüberging. Seine Seele wollte sich anscheinend von alldem befreien, auch den schlimmen Erinnerungen aus seiner Vergangenheit, die dieser Vorfall wieder geweckt hatte. Dabei hatte er jahrelang versucht, sie zu verdrängen. Sie hatten ihn in zahllosen schlaflosen Nächten verfolgt. Immer wieder musste er dabei gegen den Drang ankämpfen, den einfachen Ausweg zu wählen und den Schmerz einfach in Alkohol zu ertränken … In letzter Zeit hatte er sich einzureden versucht, dass er dies alles endlich überwunden und verdaut hätte.
Und jetzt das. Er kannte seine Agentenkollegen erst seit ein paar Wochen und hatte nur einen professionellen Umgang mit ihnen gepflegt. Zwar bedauerte er auch ihren Tod zutiefst, aber es war Khodai, der Oberst in seinem ethischen Konflikt, um den er jetzt am tiefsten trauerte … Moore hatte ihn in den vergangenen Tagen recht gut kennengelernt, und sein Tod berührte ihn jetzt ganz besonders. Wie würde Khodais Neffe auf den Verlust seines Onkels reagieren? Der Leutnant hatte geglaubt, beiden Männern zu helfen, indem er sie miteinander bekannt machte. Er musste gewusst haben, dass Khodai sich durch seine Gespräche mit Moore in Gefahr brachte. Dass jemand ihn umbringen würde, hatte er jedoch bestimmt nicht gedacht.
Moore hatte versprochen, Khodai und seine Familie zu beschützen. Auch in dieser Hinsicht hatte er vollkommen versagt. Als die Polizei vor einer Stunde in Khodais Haus eintraf, fand sie seine Frau und Söhne tot vor. Sie waren erstochen worden, und der Agent, der auf sie aufpassen sollte, war verschwunden. Die Taliban hatten offensichtlich ihre Ohren überall, nichts in dieser Stadt schien ihnen zu entgehen. Moore und seine Leute hatten dagegen wohl keine Chance. Zwar sprach jetzt die Depression aus ihm, aber die Taliban waren ihnen tatsächlich immer einen Schritt voraus gewesen. So sehr er auch versucht hatte, sich als Einheimischen auszugeben, indem er sich einen Bart wachsen ließ, die örtliche Kleidung trug und möglichst nur noch die Landessprache benutzte, hatten sie doch herausgefunden, wer er war und was er vorhatte.
Er wischte sich den Mund ab und richtete sich wieder zu voller Größe auf. Noch einmal schaute er auf die Stadt und den aufsteigenden Rauch hinunter. Er schluckte hart, nahm all seinen Mut zusammen und flüsterte: »Es tut mir leid.«
Einige Stunden später sprach Moore über eine gesicherte Videoverbindung mit Greg O’Hara, dem stellvertretenden Direktor des National Clandestine Service, der CIA-Abteilung, die weltweit sämtliche Geheimdiensteinsätze vor Ort koordiniert. O’Hara war ein drahtiger Endfünfziger mit roten, an einigen Stellen bereits ergrauenden Haaren. Der stahlharte Blick seiner blauen Augen wurde durch seine Brille noch verstärkt. Er hatte eine Vorliebe für goldfarbene Krawatten, von denen er bestimmt mehr als hundert besaß. Moore gab ihm eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse. Sie vereinbarten ein weiteres Gespräch für den nächsten Morgen, wenn die anderen Teams ihre Untersuchungen abgeschlossen haben und zu vorläufigen Ergebnissen gelangt sein würden. Moores unmittelbarer Vorgesetzter, der Leiter der Special Activities Division, würde ebenfalls an dieser Videokonferenz teilnehmen.
Einer von Moores örtlichen Kontaktleuten, Israr Rana, ein Agent, den er in seinen letzten beiden Jahren in Afghanistan und Pakistan selbst rekrutiert hatte, traf jetzt im geheimen CIA-Stützpunkt ein. Rana war ein College-Student Mitte zwanzig mit einem scharfen Verstand, vogelartigen Gesichtszügen und einer Leidenschaft für das Cricket-Spiel. Sein Humor und sein jungenhafter Charme hatten der Agency schon viele interessante und wichtige Informationen verschafft. Dies und seine Abstammung – seine Familie hatte in den letzten Jahrhunderten große Soldaten und raffinierte, erfolgreiche Geschäftsleute hervorgebracht – machte ihn das zu einem fast perfekten Geheimdienstmann.
Moore ließ sich in einen Sessel fallen, während Rana neben dem Sofa stehen blieb. »Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.«
»Kein Problem, Money.«
Dies war Ranas Spitzname für Moore. Er war durchaus berechtigt, weil Rana für seine Dienste tatsächlich ziemlich gut bezahlt wurde.
»Ich muss unbedingt herausfinden, wo das Leck war. Haben wir es von Anfang an vermasselt? Waren es die Armee, die Taliban oder beide?«
Rana schüttelte den Kopf und verzog das Gesicht. »Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Ihnen darauf eine Antwort zu liefern. Aber jetzt sollte ich Ihnen erst einmal etwas zu trinken holen. Etwas, damit Sie einschlafen können.«
Moore winkte ab. »Ich werde heute Nacht kein Auge zumachen.«
Rana nickte. »Ich werde einige Erkundigungen einholen. Kann ich Ihren Computer benutzen?«
»Er steht dort drüben.«
Moore zog sich ins Schlafzimmer zurück. Nach einer Stunde stellte sich heraus, dass er unrecht gehabt hatte. Er versank in einen Schlaf der Erschöpfung. Er hatte das Gefühl, auf schwarzen Wellen zu treiben, bis ihn sein eigener Herzschlag, der ihm wie das rhythmische Klopfen eines Hubschrauberrotors erschien, jäh aufschrecken ließ. Mit kaltem Schweiß bedeckt, schaute er sich im Zimmer um, seufzte und ließ dann den Kopf wieder auf das Kissen fallen.
Eine halbe Stunde später saß er im Auto und fuhr zurück zum Tatort. Dort angekommen, ließ er den Blick aufmerksam über den zerstörten Gebäudeteil und das benachbarte Technikzentrum schweifen. Zusammen mit zwei örtlichen Polizisten ging er zu dem Zentrum hinüber, zu dem ihm ein Sicherheitsmann Zugang verschaffte. Gemeinsam stiegen sie aufs Dach, wo man bereits einige Zeit zuvor die Patronen des Heckenschützen geborgen hatte, um sie auf Fingerabdrücke zu untersuchen.
Das Problem, wie ihre Gegner den Sprengstoff in das Hotelzimmer schaffen konnten, hatte er seit Stunden in seinem Kopf hin und her gewälzt. Als er dann in einem Reich zwischen Bewusstsein und Traum schwebte, war er auf eine ganz einfache Lösung gekommen. Es war wie eine Offenbarung, eine Art höhere Eingebung. Jetzt musste er nur noch die Beweise dafür finden.
Vorsichtig ging er am Rand des Flachdachs entlang und ließ das Licht seiner Taschenlampe über den rußgeschwärzten Stahl und Beton gleiten … bis er es gefunden hatte.
Die dem National Clandestine Service unterstellte Special Activities Division (SAD) war eine paramilitärische Spezialeinheit, die im Ausland verdeckte Operationen durchführte, die bei einem Fehlschlag von den offiziellen amerikanischen Stellen geleugnet werden würden. Ihr Personal bestand vor allem aus ehemaligen Mitgliedern der militärischen Spezialeinheiten. Die Division war in drei Unterabteilungen aufgeteilt, die jeweils für Einsätze zu Wasser, zu Lande und in der Luft zuständig waren. Moore war wie die meisten Navy-SEALs zuerst Mitglied der »Maritime Branch« gewesen. Dann war er jedoch zur Abteilung für Landeinsätze versetzt worden und hatte einige Jahre in Irak und Afghanistan gearbeitet. Dort hatte er vor allem den Einsatz von Predator-Drohnen geleitet, die Hellfire-Raketen auf zahlreiche Taliban-Ziele gelenkt hatten. Moore hatte seiner Versetzung zur »Ground Branch« nicht widersprochen. Er wusste ja, dass man ihn bei Bedarf auch wieder mit einem Seeeinsatz beauftragen würde, wie es ja die missglückte Gefangenenübernahme von dem indischen Schiff gezeigt hatte. Vor Ort arbeiteten die einzelnen Abteilungen zu allen Zeiten eng zusammen, was angesichts des begrenzten Personals unerlässlich war.
Die SAD bestand insgesamt aus weniger als 200 Agenten, Piloten und anderen Spezialisten, die in Teams zusammenarbeiteten, die aus höchstens sechs Personen bestanden. Meist leitete dabei sogar nur ein einziger SAD-Agent eine sogenannte »schwarze« verdeckte Operation, wobei er von einem »Führungsoffizier« unterstützt und gelenkt wurde, der sich oft nicht selbst vor Ort in Gefahr begab. Zur gründlichen Ausbildung der SAD-Agenten gehörten Sabotageoperationen, Terrorismusbekämpfung, Geiselbefreiungen, die Auswertung von Bombenanschlägen und Entführungsaktionen sowie die Rückführung von Material und Personen.
Die SAD verdankte ihre Existenz dem Office of Strategic Services (OSS), dem ersten staatlichen US-Geheimdienst, der im Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, nur den Vereinigten Stabschefs unterstellt war und einen direkten Zugang zu Präsident Franklin D. Roosevelt hatte. Meistens arbeitete das OSS also unabhängig von militärischer Kontrolle, was ihn bei den einzelnen Armeebefehlshabern natürlich nicht sonderlich beliebt machte. So soll General MacArthur versucht haben, die Arbeit der OSS-Agenten in seinem Befehlsbereich möglichst zu unterbinden. Direkt nach dem Krieg wurde das OSS aufgelöst. Bereits 1947 wurde jedoch als seine Nachfolgeorganisation die CIA gegründet. Missionen, die auf keinen Fall mit den Vereinigten Staaten in Verbindung gebracht werden sollten, wurden ab jetzt von der paramilitärischen Abteilung der neuen CIA, der Special Activities Division, durchgeführt, die dadurch zu einem direkten Abkömmling des OSS wurde.
Der Leiter der SAD, David Slater, ein eisenharter Afroamerikaner und früheres Mitglied der Fernaufklärungseinheit der Marines mit zwanzig Jahren Erfahrung, nahm zusammen mit dem stellvertretenden Leiter des National Clandestine Service, O’Hara, an der morgendlichen Videokonferenz teil. Die beiden Männer starrten Moore aus seinem Tablet-Computer an, während er selbst in der Küche des geheimen CIA-Stützpunkts in Saidpur Village saß.
»Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass dieses Gespräch nicht schon gestern stattfinden konnte. Ich saß jedoch gerade in einem Flugzeug auf dem Weg zurück in die Vereinigten Staaten«, begann Slater die Unterredung.
»Kein Problem, Sir. Danke, dass Sie jetzt Zeit für mich haben.«
Danach wünschte O’Hara Moore einen guten Morgen.
»Bei allem Respekt, an diesem Morgen ist überhaupt nichts Gutes.«
»Wir haben volles Verständnis für Ihre Gefühle«, antwortete O’Hara. »Wir haben ein paar gute Leute und viele Jahre Geheimdienstwissen verloren.«