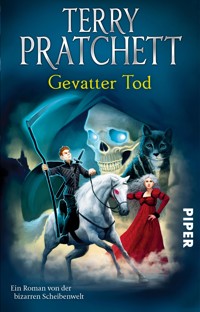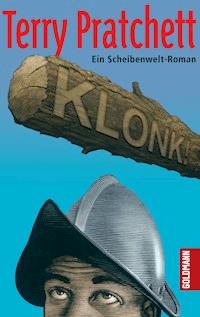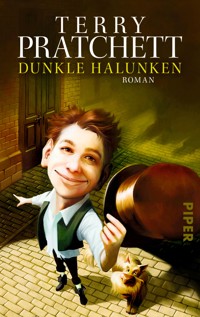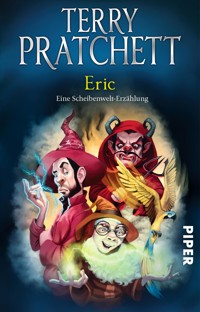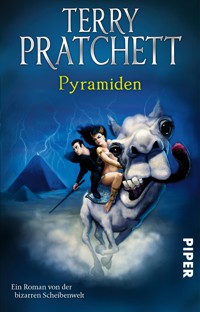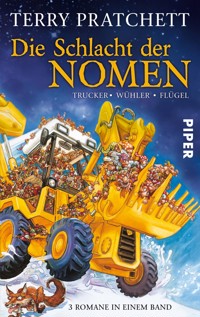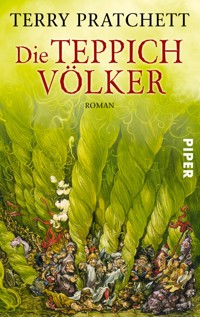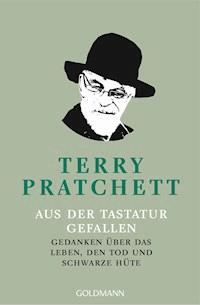
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese Anthologie versammelt die besten und unterhaltsamsten Essays, Artikel und Reden Terry Pratchetts. Hier findet man alles, was ihn im Lauf seines Lebens bewegt hat: Erinnerungen an seine Großmutter, Gedanken zu Gandalfs Liebesleben oder die Frage, welche Bücher, sein eigenes Werk inspiriert haben. Er spricht über seine Liebe zu Weihnachten, gibt Einblicke in seine Schulzeit oder verrät, zu welcher Tageszeit man am besten schreibt. Selbst die ernsten Themen, denen er sich widmet, sind stets durchdrungen vom Humor und der Lebensklugheit dieses wundervollen Autors.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Diese Anthologie versammelt die besten und unterhaltsamsten Essays, Artikel und Reden Terry Pratchetts. Hier findet man alles, was den großen Scheibenweltschöpfer im Lauf seines Lebens bewegt hat: Erinnerungen an seine Großmutter, Gedanken zu Gandalfs Liebesleben oder die Frage, welche Bücher sein eigenes Werk inspiriert haben. Er spricht über seine Liebe zu Weihnachten, gibt Einblicke in seine Schulzeit oder verrät, zu welcher Tageszeit man am besten schreibt. Selbst die ernsten Themen, denen er sich widmet, sind stets durchdrungen vom Humor und der Lebensklugheit dieses wundervollen Autors.
Weitere Informationen zu Terry Pratchett sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Terry Pratchett
Aus der Tastatur gefallen
Gedanken über das Leben, den Tod und schwarze Hüte
Aus dem Englischen neu übersetzt von Gerald Jung und Regina Rawlinson
Widmung
Nachdem das Buch, das Sie hier in der Hand halten, mein gesamtes Schriftstellerleben abdeckt, ist es nur recht und billig, es den guten Seelen zu widmen, die über viele, viele Jahre an meinem Werk mitgewirkt oder mir sonst auf die verschiedenste Weise hilfreich1 zur Seite gestanden haben.
Um nur einige wenige zu nennen: meine geschätzten Verleger und Verlegerinnen Colin Smythe, Larry Finlay, Marianne Velmans, Philippa Dickinson, Suzanne Bridson, Malcolm Edwards und Patrick Janson-Smith. Meine Obersten Hirtinnen der Wörter Katrina Whone, Sue Cook und Elizabeth Dobson. Meine werten Lektoren und Lektorinnen Simon Taylor, Di Pearson, Kirsten Armstrong, Jennifer Brehl und Anne Hoppe. Meine stets regen und kreglen Pressefrauen Sally Wray und Lynsey Dalladay. Den Herrn der Über-Fans Dr. Pat Harkin. Meine Freunde Neil Gaiman, Professor David Lloyd und den alten Halunken Mr Bernard Pearson. Den Geschäftsführer von Narrativia und noch größeren Halunken Rod Brown. Meine Schreibgenossen Steve Baxter, Jacqueline Simpson, Jack Cohen, Ian Stewart und meinen privaten Kartografen/Dramatiker/Strumpfhosenträger Stephen Briggs, den Mann der tausend Stimmen2. Meine Grafiker Paul Kidby, Josh Kidby und Stephen Player und meine bezaubernden Heinzelfrauen Sandra und Jo Kidby. Jason Anthony für Discworld Monthly, Elizabeth Alway für die Gilde der Fans und Jünger und Steve Dean für sein renommiertes Magazin Wizard’s Knob.
Besonders hervorheben muss ich auch das Oberhaupt der Diebesgilde, den Allesbeschaffer Josuah Boggis/Dave Ward3 und den Pub Queen’s Head wegen der Soleier und der vorzüglichen Kartoffel-Gemüse-Pfanne.
Und jeden, der jemals das Chaos einer Discworld Convention er- und überlebt hat, ob nun als Teilnehmer oder als Mitglied des Organisationsteams, doch vor allem den Gründer und verantwortlichen Leiter Paul Kruzycki.
Und überhaupt jeden, der mir auf meinem Weg geholfen und mir keine Steine in den selbigen gelegt hat, aber am allermeisten Rob, der still vor sich hin werkelt und ohne den …
Danke euch allen, die ihr da seid. Danke.
1 Oder doch zumindest wohlwollend – und fast immer begleitet von quälender Lustigkeit.
2 Solange sie alle walisisch sprechen.
3 Nicht Zutreffendes bitte streichen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort von Neil Gaiman
Der Störer mit dem Stift
Denkfortschritte
Palmtop
Das treffende Wort
Wie man Profiboxer wird
Brewer’s Boy
Paperback Writer
Ratgeber für Buchhändler
Null Problemo
Conventionelle Weisheiten
Von Herzen, mit Umweg über die Leiste
Die Scheibenwelt wird 21
Kevins
Irrwitzige Ideen
Anmerkungen eines erfolgreichen Fantasy-Autors: Immer schön realistisch bleiben!
Wessen Fantasy sind Sie?
Wieso Gandalf nie geheiratet hat
Die Wurzeln der Fantasy
Elfen waren Biester
Unter Drachen
Magische Welten
Kult-Klassiker
Neil Gaiman: Großer Meister der Zauberkunst
Dankesrede bei der Verleihung der 2001 Carnegie Medal
Rede anlässlich der Verleihung des Boston Globe-Horn Book Awards für Eine Insel
Eine Insel im Theater
Onkel Doktor
Ein paar Worte über Hüte
Ein weltfremder Träumer
Im Kaufhaus
Der Roundhead Wood in Forty Green
Ein Musterschüler
Oma Pratchett
Über Pornos und andere wundersame Geschichten
Brief an Vector
Lektüren eines Schriftstellers
Vorwort zu Roy Lewis’ Edward – Wie ich zum Menschen wurde
Der König und ich
Schätzchen, diese Bienen hatten ein Herz aus Gold
Hört sich echt fungi an, das muss der Chor der Morgendämmerung sein
Vorwort zum Roman The Leaky Establishment von David Langford
Was mir Weihnachten bedeutet
Weihnachten mit Aliens
2001 – Vision und Wirklichkeit
Der Gottesmoment
Ein waschechter schusseliger Professor
Samstags
Tage des Zorns
Was unsere Schulen leisten
Die Orang-Utans sterben
Der staatliche Gesundheitsdienst ist schwer angeschlagen
Ich mache mich nach und nach davon … und mir bleibt nichts anderes übrig, als dabei zuzusehen
Steuerwelt
Zeigt mir den Weg in den Himmel, wenn das letzte Kapitel ansteht
Die Richard-Dimbleby-Lecture: Dem Tod die Hand reichen
Endlich wahre Barmherzigkeit bei den Richtlinien für Sterbehilfe
Sterbehilfe: Die Regierung sollte uns das Recht geben, unser Leben zu beenden
Der Tod klopfte an, und wir ließen ihn ein
Eine Woche im Sterben von Terry Pratchett
Und zum Schluss …
Terry Pratchetts frei flottierende Fußnoten zum Leben
Vorwort von Neil Gaiman
Ich möchte Ihnen etwas über meinen Freund Terry Pratchett erzählen, und das ist nicht leicht. Ich werde Ihnen etwas erzählen, was Sie vielleicht noch nicht wissen.
So mancher, der einem leutseligen Mann mit Bart und Hut begegnet ist, bildet sich ein, er habe Sir Terry Pratchett kennengelernt. Doch da täuscht er sich gewaltig.
Auf einer Science-Fiction-Convention wird einem oft jemand zur Seite gestellt, der sich um einen kümmert und dafür sorgt, dass man von A nach B kommt, ohne sich zu verlaufen. Vor einigen Jahren habe ich mal einen Mann getroffen, der Terry irgendwann auf einer Convention in Texas betreut hat. Er bekam feuchte Augen, als er daran zurückdachte, wie er Terry aus dem Vortrags- in den Ausstellungssaal und wieder zurück begleitet hatte. »Was für ein lustiger alter Kauz Sir Terry doch ist«, sagte er.
Und ich dachte: Nein. Weit gefehlt.
Im Februar 1991 waren Terry und ich mit Ein gutes Omen, einem Buch, das wir zusammen geschrieben haben, auf Lesereise. Wir können Ihnen Dutzende Nicht-nur-witzige-sondern-auch-wahre-Geschichten von unseren Erlebnissen auf der Tour erzählen. Auf einige davon spielt Terry in diesem Buch an. Die folgende Geschichte ist wahr, aber keine, mit der wir gerne hausieren gehen.
Wir waren in San Francisco. Nachdem wir in einer Buchhandlung ein gutes Dutzend Exemplare unseres Romans signiert hatten, sah Terry sich unseren Terminplan an. Als Nächstes stand ein einstündiges Liveinterview bei einem Radiosender auf dem Programm. »Laut Stadtplan sind es bloß ein paar Blocks«, sagte Terry. »Und wir müssen erst in einer halben Stunde da sein. Wir gehen zu Fuß.«
Das begab sich vor langer, langer Zeit, liebe Kinder, als es noch kein GPS gab, keine Mobiltelefone, keine Taxi-Apps oder ähnlich nützliche Erfindungen, die uns blitzschnell verraten hätten, dass der Sender keineswegs nur ein paar Blocks, sondern mehrere Kilometer entfernt war und dass die gesamte Strecke bergauf und größtenteils durch einen Park verlief.
Unterwegs riefen wir von jeder Telefonzelle, an der wir vorbeikamen, im Sender an, um Bescheid zu geben, dass wir es bis zum Beginn der Livesendung leider nicht rechtzeitig schaffen würden und – Ehrenwort! – so schnell marschierten, wie wir nur konnten.
Ab und zu gab ich eine aufmunternde, optimistische Bemerkung von mir. Terry ging nicht darauf ein, sein Schweigen brachte deutlich zum Ausdruck, dass alles, was ich sagte, die Sache eher noch schlimmer machte. Währenddessen musste ich mir ständig die bissige Feststellung verkneifen, dass uns dieses Debakel erspart geblieben wäre, hätten wir uns einfach in der Buchhandlung ein Taxi rufen lassen. Wenn man eine Freundschaft nicht aufs Spiel setzen will, bleibt manches besser ungesagt – dazu zählte das, was mir auf der Zunge lag.
Schwitzend und schnaufend kamen wir mit ungefähr vierzig Minuten Verspätung zu unserem einstündigen Interview auf dem Berg am Ende der Welt an. Gerade ging eine Eilmeldung über den Sender: In der Stadt schoss ein Mann bei McDonald’s wild um sich. Nicht gerade der ideale Aufhänger für ein Gespräch über ein witziges Buch, in dem es um Tod und Weltuntergang geht.
Außerdem waren die Radioleute verständlicherweise sauer auf uns. Es macht keinen Spaß, improvisieren zu müssen, weil sich die Studiogäste verspäten. Ich glaube nicht, dass unsere fünfzehn Live-Minuten sehr witzig waren.
(Später erfuhr ich, dass Terry und ich von dem Sender in San Francisco für mehrere Jahre auf die schwarze Liste gesetzt wurden, weil Radiobosse es weder schnell vergessen noch leicht vergeben, wenn man ihren Moderator vierzig Minuten lang im luftleeren Raum hängen lässt.)
Wie auch immer. Als die Stunde vorbei war, hatten wir die Sache hinter uns. Wir fuhren mit dem Taxi ins Hotel zurück.
Terry wütete stumm vor sich hin: vor allem wohl gegen sich selbst, aber auch gegen die Welt, die ihm verschwiegen hatte, dass die Entfernung zwischen Buchhandlung und Radiosender viel größer war, als es auf dem Stadtplan den Anschein hatte. Weiß vor Wut saß er neben mir auf der Rückbank des Taxis, eine geballte Ladung Zorn, die jederzeit hochgehen konnte. Vorsichtig versuchte ich, beruhigend auf ihn einzuwirken, machte eine Bemerkung wie: Es sei doch zum Schluss noch gut ausgegangen, es sei keine absolute Katastrophe gewesen, er könne sich langsam wieder abregen.
Terry sah mich an. »Unterschätze mir diesen Zorn nicht«, sagte er. »Das war der Motor, der Ein gutes Omen angetrieben hat.«
Er hatte recht. Beim Schreiben war er ein Getriebener, der alle anderen mitriss.
In Terry Pratchetts Schreiben steckt ein tief sitzender Zorn, der ihn befeuert und die Scheibenwelt am Laufen hält: Zorn auf den Grundschuldirektor, für den, als Terry erst sechs war, schon feststand, dass der Junge zu dumm sei, um später den Übertritt auf eine höhere Schule zu schaffen. Zorn auf selbstgefällige Kritiker und auf Leute, die meinen, ernst wäre das Gegenteil von witzig. Zorn auf seine ersten amerikanischen Verlage, die sich nicht genug für den Erfolg seiner Bücher in den USA einsetzten.
Der Zorn, dieser Motor, der ihn antreibt, ist immer da. Wenn für Terry im Schlussteil dieses Buches der letzte Akt beginnt, als er erfährt, dass er an einer seltenen Frühform der Alzheimerkrankheit leidet, richtet sich der Zorn gegen andere Ziele: gegen sein Gehirn und seine Gene, aber vor allem gegen ein Land, das ihm und anderen Menschen mit ähnlich aussichtslosen Leiden verbietet, über den Zeitpunkt und die Art ihres Abtretens selbst zu entscheiden.
Mir kommt es so vor, als ob sich Terrys Zorn aus seinem tiefen Gerechtigkeitssinn speist.
In diesem Gerechtigkeitssinn wurzeln seine Arbeit und sein Schreiben, dieses Streben hat ihn aus der Schule heraus zum Journalismus und weiter in die Presseabteilung des Southwestern Electricity Board gebracht und schließlich einen der meistgeliebten und meistverkauften Schriftsteller der Welt aus ihm gemacht.
Terrys Sinn für Gerechtigkeit ist auch der Grund dafür, dass er sich in diesem Buch, während er vordergründig ganz andere Dinge behandelt, die Zeit nimmt, gewissenhaft jene zu würdigen, die ihn beeinflusst haben – zum Beispiel Alan Coren, den Pionier der humoristischen Kurzform, von dem Terry und ich uns im Laufe der Jahre so manches abgeguckt haben, oder auch den grandiosen Wälzer, die unerschöpfliche Fundgrube Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable, und seinen Herausgeber Reverend Ebenezer Cobham Brewer, den Mann mit dem glücklichen Händchen. Für eine Neuausgabe hat Terry sogar einmal ein höchst amüsantes Vorwort geschrieben, und wenn einer von uns ein Nachschlagewerk von Brewer entdeckte, das er noch nicht kannte, rief er aufgeregt den anderen an. (»Sag mal, hast du Brewers Dictionary of Miracles: Imitative, Realistic and Dogmatic schon im Regal?«)
Obwohl die für das vorliegende Buch ausgewählten Texte Terrys gesamtes schriftstellerisches Leben abdecken, vom Schuljungen bis zum Ritter im Reich der Literatur, sind sie aus einem Guss. Keiner von ihnen ist gealtert, vielleicht mit Ausnahme einiger Kommentare zu bestimmter Computer-Hardware. (Ich vermute, dass Terry Ihnen ganz genau sagen könnte, wo sein Atari Portfolio abgeblieben ist – wenn er ihn denn nicht längst für einen guten Zweck gespendet oder einem Museum gestiftet hat. Genauso, wie er bis auf den Penny genau wüsste, was ihn der handgelötete Zusatzspeicher gekostet hat, der die Kapazität des Atari auf die schwindelerregende Höhe von einem Megabyte emporschraubte.) Die Stimme in diesen Essays ist Terrys eigene: warmherzig, sachkundig, vernünftig, voll trockenem Humor. Bei flüchtigem, nicht allzu genauem Hinsehen könnte man ihn tatsächlich für einen lustigen alten Kauz halten.
Aber diese Lustigkeit ruht auf einem Fundament aus Zorn. Terry Pratchett wird nicht gelassen in die (gute?) Nacht gehen. Er tritt rasend ab, gegen Dummheit und Ungerechtigkeit wütend, gegen menschliche Torheit und Kurzsichtigkeit und natürlich auch, aber beileibe nicht nur, gegen den Tod des Lichts. Doch neben dem Zorn ist da auch die Liebe, Engel und Dämon, die Hand in Hand in den Sonnenuntergang gehen. Die Liebe zu uns Menschen in all unserer Fehlbarkeit, die Liebe zu geliebten Dingen, zu Geschichten und vor allem die Liebe zur menschlichen Würde.
Drücken wir es anders aus: Zorn ist Terrys Antrieb, doch seine Herzensbildung gibt ihm die Richtung vor. Sie sorgt dafür, dass er den Zorn aufseiten der Engel einsetzt. Besser gesagt, für uns alle, für die Orang-Utans.
Terry Pratchett ist kein lustiger alter Kauz. Nicht mal ansatzweise. Er ist viel, viel mehr.
Weil Terry nun viel zu früh ins Dunkel geht, fange auch ich an zu wüten: gegen die Ungerechtigkeit, die uns … was raubt? Noch zwanzig, dreißig Bücher? Regalmeter an Einfällen und Wortwitz, an alten und neuen Freunden, an Geschichten, in denen die Menschen das tun, was sie am allerbesten können, nämlich ihren Kopf anstrengen, um sich aus einer kniffligen Lage zu befreien, in die sie sich ohne Sinn und Verstand selbst hineinmanövriert haben? Noch ein, zwei Bücher wie dieses, mit journalistischen Texten, Agitprop und sogar dem einen oder anderen Vorwort? Aber in Wahrheit machen mich diese Verluste weniger zornig als wehmütig. Als jemand, der das Entstehen einiger Terry-Pratchett-Bücher aus nächster Nähe miterleben durfte, begreife ich, dass jedes davon ein kleines Wunder ist, und ich weiß, dass er uns reicher beschenkt hat, als wir es uns jemals erhoffen durften. Wir wollen nicht unverschämt sein, denn das gehört sich nicht.
Ich wüte, weil ich in naher Zukunft meinen Freund verlieren werde.
Und ich frage mich: »Was würde Terry mit diesem Zorn machen?«
Dann greife ich zum Stift und schreibe.
NGNew York, Juni 2014
Der Störer mit dem Stift
Über Buchläden, Drachen, Fanpost, Sandwiches, schriftstellerisches Handwerkszeug, verglimmenden Grimm und alles, was den Beruf des Profischreibers ausmacht.
Denkfortschritte
20/20 Magazine, Mai 1989
Ein kleiner Text über das Schreiben. Dem aufmerksamen Leser dürfte nicht entgehen, dass mir zu der Zeit schon Einfach Göttlich im Kopf herumging. Es handelt sich um eine ziemlich akkurate Beschreibung des beim Schreiben ablaufenden kreativen Prozesses …
Aufstehen, frühstücken, Computer anschmeißen, auf den Bildschirm starren.
Weiter auf den Bildschirm starren.
Immer noch auf den Bildschirm starren, dabei aber die Ohren spitzen, ob der Briefträger kommt. Mit ein bisschen Glück bringt er einen großen Sack Post, damit der Vormittag schön ausgefüllt ist. Das letzte Manuskript ist gerade an den Verlag rausgegangen. Nichts zu tun. Riesiges Vakuum in der Mitte der Welt.
Die Post kommt. Ein Brief auf Hollie-Hobbie-Papier mit der Bitte um ein Autogramm.
Na gut, na gut, dann recherchieren wir eben was. Für den nächsten Scheibenweltroman brauchen wir Informationen über Schildkröten. Irgendwie schwant mir, dass darin eine sprechende Schildkröte eine tragende Rolle spielen wird. Weiß selber nicht, warum; die Schildkröten sind einfach aus den Tiefen des Unterbewusstseins aufgetaucht. Wahrscheinlich ausgelöst durch das Erwachen der eigenen Schildkröten aus dem Winterschlaf, den sie gerade im Gewächshaus abschütteln.
Finde in einer Kiste im Gästezimmer ein Buch über Schildkröten.
Muss in nächster Zeit unbedingt neue Bücherregale schreinern lassen. (Da hatte nämlich einer die clevere Idee, die Regale in der Garage vorzufertigen … alle Teile präzise zugeschnitten, mit Geodreieck und allem Pipapo, grundiert, lackiert, dann die Bretter ins Haus geschleppt, mit echten Holzdübeln und Leim zusammengesetzt, Hunderte Bücher ordentlich in Reihen aufgestellt. Spannendes naturwissenschaftliches Experiment: Was macht Holz, das wochenlang in einer kalten, feuchten Garage gelegen hat, wenn es sich plötzlich in einem warmen, trockenen Zimmer wiederfindet? Um drei Uhr morgens bekam ich die Antwort: Jedes einzelne Teil schrumpft um 3 Millimeter.)
Eine interessante Fußnote in dem Schildkrötenbuch erinnert mich daran, dass die berühmteste Schildkröte der Weltgeschichte wohl die ist, die einem berühmten griechischen Philosophen auf den Kopf fiel. Wie hieß der Knabe noch gleich? Unter Schildkrötenwerfern kennt ihn jeder. Werde von dem unwiderstehlichen Drang übermannt, der Sache auf den Grund zu gehen, inklusive der Frage, was wohl die Schildkröte davon gehalten haben mag. Ich glaube, der Knabe hieß Zenon, bin mir aber sicher, der war’s nicht.
Bis ich herausgefunden habe, dass es Aischylos war, sind zwanzig Minuten rum. War kein Philosoph, war Tragödiendichter. Bei ihm gewann das frühe Drama einen hochreligiösen Sinn, es diente als Forum für die Lösung zutiefst moralischer Konflikte und brachte die Erhabenheit von Denken und Sprache zum Ausdruck. Ein pfeifendes Zischen und gute Nacht, Johanna. Interessehalber schlage ich auch noch Zenon nach. Ach so, das war der, von dem die Weisheit stammt, dass man, wenn man der Logik folgt, eine Schildkröte nicht fangen kann.
Das hätte er mal dem Aischylos sagen sollen.
Lese noch was über Gebetsmühlen und, warum auch immer, über William Blake. Zwischendurch ruft eine Frau an und will wissen, ob wir die Zahnarztpraxis sind.
Gleich kriege ich definitiv etwas getan. Der schöpferische Motor läuft schon warm.
Ich lege los und sichere erst mal jede Menge Zeug auf Diskette. Das ist das Schöne am Computer. In der schlechten alten Schreibmaschinenzeit konnte man, wenn die Kreativität mal lahmte, höchstens einen Bleistift spitzen oder mit einer Stecknadel den Typenhebel des E sauberprockeln. Aber seit es den Computer gibt, bieten sich unendlich viele Möglichkeiten zum Herumfriemeln. Man kann Makros austüfteln, die Echtzeituhr akkurat einstellen und was nicht sonst noch alles, aber auf jeden Fall ist es ehrliche Arbeit.
Vor Tastatur und Bildschirm zu sitzen ist Arbeit. Tausende Büros funktionieren nach genau diesem Prinzip.
Hätte zu gern gewusst, wieso der Adler die Schildkröte ausgerechnet auf den Dramatiker fallen gelassen hat. Bestimmt nicht, um sie aufzuknacken, wie das Buch behauptet. Adler sind doch nicht blöd. Warum sollte sich ein Adler in Griechenland, das nur aus Steinen besteht, mit minutiöser Genauigkeit ausgerechnet den nackten Schädel des Aischylos aussuchen? Und wie spricht man Aischylos überhaupt aus?
Aussprachewörterbuch in Kiste auf dem Speicher.
Leiter in der Garage.
Auto müsste mal wieder gewaschen werden.
Mittagessen.
Wirklich kein schlechtes Pensum für einen Vormittag.
Zurück an den Bildschirm.
Starre auf den Bildschirm.
Wieder ruft eine Frau an, will wissen, ob wir Eden sind. (Das paradiesische Motel ein paar Häuser weiter hat, von einer Ziffer abgesehen, die gleiche Telefonnummer wie wir).
Starre auf den Bildschirm.
Gerate ins Sinnieren. Vielleicht konnte der Adler gar nichts dafür, vielleicht war er im Einsatz und hatte schon zu viele Missionen geflogen. Natürlich, man wird aus der Adlerluftwaffe geschmissen, wenn man sich vor dem Abwurf einer Schildkröte erst noch Gedanken über unschuldige Philosophen macht. Platsch-22. Nein.
Starre auf den Bildschirm.
Nein. Völlig klar, das Ganze war auf dem Mist der Schildkröte gewachsen. Hatte es auf den Stückeschreiber abgesehen, vielleicht waren in seinem neuesten Stück die Schildkröten schlecht weggekommen, vielleicht war sie mit tempoistischen Witzen beleidigt worden, oder sie hatte gesehen, dass er eine Brille mit Schildpattgestell trug: Du dreckige Ratte, hast meinen Bruder auf dem Gewissen. Deswegen den Adler entführt, sich an die Beine des verzweifelten Vogels geklammert, wie die Schildkröte in dem alten Logo von Friends of the Earth, halblaut das Ziel durchgegeben, Vektor 19, biep-biep-biep, Geronimooooo …
Starre auf den Bildschirm.
Überlege, ob so ein Adler noch was anderes hat, woran sich eine Schildkröte festklammern könnte.
Lese die Biologie der Vögel nach, Enzyklopädie in der Kiste auf der Treppe. Mannomann.
Abendessen.
Starre auf den Bildschirm. Drehe und wende Ideen hin und her. Schildkröten, Glatze, Adler. Hm. Nein, ein Stückeschreiber kann’s nicht sein. Was für eine Sorte Mensch wäre einer Schildkröte auf den ersten Blick zuwider?
Mitternacht …
Starre auf den Bildschirm. Nehme schemenhaft wahr, dass die rechte Hand Tasten gedrückt und eine neue Datei angelegt hat. Atme langsam ein und aus.
Schreibe 1943 Wörter.
Ins Bett.
Und da dachte ich den ganzen Tag, ich kriege nichts zustande.
Palmtop
Independent, 9. Juli 1993
Ein tragbarer Computer? Dass ich nicht lache. Mein Olivetti hätte sich sehr gut als Schiffsanker gemacht. Vermutlich laufen die alten Kisten sogar noch – ich habe sie gut gepflegt. Obwohl ich eigentlich keine Verwendung mehr für sie habe, kann ich mich nicht überwinden, diese Technik-Fossilien wegzuwerfen.
Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten tragbaren Computer. Er wog 15 Pfund und hatte ein separates Netzteil, das in vieler Hinsicht an einen kleinen Backstein erinnerte. Das verdammte Ding hat mich fast umgebracht.
Der nächste war ein Leichtgewicht von 8 Pfund, doch auch er besaß einen (nicht ganz so großen) Backstein. Zumindest hielt ich ihn für ein Leichtgewicht, bis ich damit einmal quer durch einen Flughafen hetzen musste.
Allmählich ging mir ein Licht auf. Was ist denn das Entscheidende an einem tragbaren Computer, das A und O, der springende Punkt, des Pudels Kern? Dass man das Ding tragen kann. Was nützt einem ein Gerät, das nicht mal in einen Aktenkoffer passt, wenn man noch andere Sachen mitnehmen will? Auch ein Achtpfünder ist nicht tragbar. Er ist eine Zumutung.
Ich habe nie verstanden, warum in einer Produktbesprechung das Gewicht eines tragbaren Geräts nicht als Allererstes behandelt wird. Meistens findet man es im Kleingedruckten, ganz unten auf der Seite. Und warum? Weil sich die Kritiker von glänzenden Disketten und leuchtenden Bildschirmen hypnotisieren lassen. Ich finde, sie sollten so ein Teil mal einen Tag lang mit sich rumschleppen, weil sie in einer Künstlergarderobe, einem Hotel oder Taxi damit arbeiten müssen.
Ich bin mit Science-Fiction-Romanen großgeworden, in denen es von Typen nur so wimmelte, die einen Westentaschencomputer besaßen, der nicht nur sprechen, sondern auch noch den Terminkalender für sie führen und zudem ganze Planeten verwalten konnte. Diese Kerle haben sich nie einen Leistenbruch gehoben. Ich sah gar nicht ein, wieso ich mir einen zuziehen sollte. Was mich quälte, war das Gegenteil eines Zukunftsschocks. Ein Zukunftsdämpfer? Ich möchte keine Arme, die bis zu den Knien reichen, ich hätte bloß gern einen Computer, den ich mitnehmen kann.
So betrat ich die Welt des Palmtop.
Überall stolpert man über Fachbegriffe. Früher hatte man entweder einen großen Rechner, der auf dem Schreibtisch stand, oder einen (mehr oder weniger) tragbaren. Heute gibt es Ultraportables, Sub-Notebooks, Personal Digital Assistants, Palmtops und Pocketbooks, allesamt schwammig definiert nach Größe und Gewicht sowie nach Lust und Laune des Namensgebers. Kurz gesagt, sie sind klein und leicht.
Angesiedelt sind sie alle im Zwischenreich zwischen Laptops (den bereits erwähnten Tragbaren, wobei die meisten der neuen Geräte wesentlich mehr können als meine alten und nur noch um die sechs Pfund auf die Waage bringen – plus einen ziemlich kleinen Backstein) und Taschenrechnern.
Der Erste, den ich mir vor einigen Jährchen zugelegt habe, war der Atari Portfolio. Er wog etwa ein Pfund und besaß eine fest installierte Software, darunter als Köder für den Yuppie neben dem üblichen »elektronischen Filofax« ein einfaches Textverarbeitungsprogramm sowie einen Taschenrechner, eine Tabellenkalkulation und ein Telefonbuch. Die Textverarbeitung war okay; ich habe Hunderte von Seiten damit geschrieben, wenn auch nicht besonders schnell. Aber perfekt war sie nicht.
Die wichtigste Regel lautet: Auf das Gewicht kommt es an. Die zweitwichtigste: Welches Zubehör muss man zusätzlich kaufen?
Sir Clive Sinclair gelang es als Erstem, einen Computer zu einem Preis von unter 100 Pfund auf den Markt zu bringen, indem er den Computer neu definiert hat. Sein Gerät benötigte keinen eigenen Bildschirm, keinen internen Massenspeicher, keinen standardmäßigen Kommunikations-Port und auch keine für längeres Tippen ausgelegte Tastatur – solange man bereit war, es an einen Fernseher anzuschließen, Programme auf einem normalen Kassettenrekorder zu speichern und sehr, sehr langsam und vorsichtig zu schreiben. Mehr als 1 kB Speicherplatz benötigte es nicht. Also hatte es auch nicht mehr.
Seitdem habe ich mich immer vor Maschinen gehütet, die ohne Zusatzteile nicht mehr als ein nützliches Spielzeug sind. Den Portfolio musste man, wenn man halbwegs genügend Speicherplatz wollte, mit einem Add-on-Modul aufrüsten. Um drucken zu können, brauchte man ein verhältnismäßig großes Plug-in-Modul, dazu kam ein weiteres, wenn man eine serielle Schnittstelle wollte. Sonst kriegte man aus dem Ding nichts raus.
Theoretisch ließ man diese Teile zu Hause. Aber ich arbeite viel auf Reisen, und man wird sehr nervös, wenn man zwischendurch nichts ausdrucken oder auf einem anderen Gerät abspeichern kann.
Außerdem brockte man sich damit bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen Scherereien ein. Mit dem eigentlichen Rechner kamen die Security-Leute klar, aber die Kiste mit den rätselhaften Plastikstöpseln irritierte sie. »Dann zeigen Sie uns doch mal, wie das funktioniert«, sagten sie. »Aber gerne doch«, antwortete ich. »Dafür bräuchte ich bloß eine Steckdose und einen Laser-Drucker.«
Für meinen Geschmack kam in den Produktbeschreibungen der kleineren, leichteren Geräte viel zu oft das Wort »optional« vor. »Optional« bedeutet, man muss dafür bezahlen, dass die Kiste tut, was sie soll.
Nach zweijähriger Suche landete ich schließlich beim Olivetti Quaderno – auf dem ich jetzt auch diesen Artikel schreibe. Er hat mich ungefähr 600 Pfund gekostet und muss im vergangenen Jahr wohl als einer der ersten auf den Markt gekommen sein. (Pioniere werden bestraft. Mein Agent, der sich ein paar Monate später auch einen zugelegt hat, bekam ein externes Diskettenlaufwerk gratis obendrauf. Nachdem inzwischen Berichte über ein aufgerüstetes Modell die Runde machen, ist der Preis weiter in den Keller gegangen.) Der Olivetto Quaderno ist im Grunde der PC I, den ich mir 1987 gekauft habe, aber auf DIN-A5-Größe eingedampft, nur einen Zoll hoch und knapp über zwei Pfund schwer. Das kleine Netzteil und den Akku habe ich nicht gewogen – dass sie etwas wiegen, ist mir, ehrlich gesagt, nie aufgefallen. Auf jeden Fall passt er in meinen Aktenkoffer. Locker. Aber vor allem kann ich damit die gesamte Software benutzen, die ich über die Jahre unter Irrungen und Wirrungen zusammengetragen habe.
Es laufen darauf speicherresidente Programme wie SideKick und das unvergleichliche Info Select. Und WordPerfect 4.2 (die klassische Version). Das Display ist größer als ein Briefkastenschlitz, und ich muss mir keine Software aufs Auge drücken lassen, die jemand anderer für mich ausgesucht hat. Der Quaderno besitzt eine 20-Megabyte-Festplatte. Da passt ein ganzer Roman drauf, den man immer bei sich hat, wenn man daran arbeiten will. So wie jetzt gerade.
Ja, aber was ist mit der Tastatur?, höre ich Sie fragen. Sie ist auf jeden Fall um einiges besser als die sämtlicher vergleichbaren Geräte, die ich ausprobiert habe, und ich kann darauf blind tippen. Während beispielsweise die Tasten beim H-P 95LZ von Hewlett-Packard, den ich ansonsten durchaus brauchbar fand, nicht viel größer als bei einem Taschenrechner waren.
Oder es heißt: Und läuft er auch unter Windows? Jeder passionierte Windows-Nutzer würde das bestreiten. Windows verlangt einen hochauflösenden Bildschirm, einen 386er Prozessor, einen ziemlich großen Arbeitsspeicher und einen Nutzer mit Festanstellung, der den lieben langen Bürotag Zeit hat, mit den Farben herumzuspielen oder sich tolle neue Icons auszusuchen. Das muss ich nicht haben. Weil der Quad keine Hintergrundbeleuchtung hat, ist der Bildschirm relativ duster. Man muss also für ausreichend Licht sorgen.
Aber es gibt ihn – hier und heute. Er ist kein Spielzeug. Ich kann meine unfertigen Texte überallhin mitnehmen, genau wie meinen Terminkalender und die Tabellen, und zwar in Versionen, mit denen ich mich auskenne und die wie eine sanfte Welle zwischen dem Quad und dem Bürorechner hin und her schwappen. Sicher, der Bildschirm ist ein bisschen dunkel, aber er sieht aus wie der kleine Bruder der Monitore, mit denen ich vertraut bin. Wenn es sein müsste, könnte ich ständig mit ihm arbeiten.
Adieu Backsteine. Dieser Computer ist tatsächlich tragbar.
Auf dem Ayers Rock habe ich ihn dann doch nicht benutzt. Aber ich hätte es verdammt noch mal gekonnt.
Das treffende Wort
Beitrag für das Londoner LiteraturfestivalThe Word, 2000
O Mann, wie soll man da noch den Überblick behalten? Sobald man sich in Großbritannien als Autor den Ruf erworben hat, nicht allzu unfreundlich zu sein, wird man von den Zeitungen mit Anfragen bombardiert, ob man nicht ein »kurzes Textchen« für sie schreiben möchte. In Schriftstellerkreisen heißen solche Beiträge »Mein Lieblingslöffel«-Artikel. Irgendwo bildet sich irgendwer ein, so was wäre gute Publicity. Vor einigen Jahren wurde im Rahmen eines großen britischen Literaturfestivals unter großem medialen Getöse eine Umfrage nach dem Lieblingswort der Nation veranstaltet. Das Folgende ist meins.4
Es ist ein glücklicher Zufall, wenn ein lautmalerisches Wort auf eine Sache passt, die man eigentlich nicht hören kann. Schimmern, schillern, glitzern, glimmen – so und nicht anders würde das Licht klingen, wenn es könnte. Ein Glitzern ist scharf und schnell, es glitzert; und wenn eine ölige Oberfläche ein Geräusch machen würde, dann mit Sicherheit schillern. Wonne klingt nach einem weichen Baiser, das auf einem warmen Teller zergeht.
Aber ich entscheide mich für:
RAUNEN
… das mit »Rune« verwandt ist und mit »raunzen«, ein gedämpftes Geräusch. Das Gemurmel des Wassers, das Rauschen leisen Windes. Doch es schwingt auch Verschwörerisches, Geheimnisvolles darin mit. Man sieht Menschen vor sich, die sich einander verwundert zuwenden. Ja, Raunen ist das Geräusch, das man hört, nachdem das Schwert aus dem Felsen gezogen wurde und bevor der Jubel losbricht.
4 Was zum Lieblingswort der Nation gekürt wurde, weiß ich nicht mehr. Vermutlich »Beckham«.
Wie man Profiboxer wird
Vorwort zum Writers’ & Artists’ Yearbook 2006
Mein erstes W&AYB habe ich mir mit dreizehn oder vierzehn gekauft. Gebraucht. Sorry. Aber ich hatte mir gerade für zehn Shilling ein sehr gut erhaltenes (gebrauchtes) Exemplar von Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable geleistet, eine kostspielige Angelegenheit für einen Jungen mit begrenzten finanziellen Mitteln. Irgendwie dachte ich wohl, dass ich das Jahrbuch besitzen müsste, wenn ich Schriftsteller werden wollte, und dass sich das darin enthaltene Profiwissen anstrengungslos und wie von selbst auf mich übertragen würde.
Ich las es mit großer Ernsthaftigkeit.
Ob es nützlich war? Ja, doch – auch wenn ich als bekennender Science-Fiction-Fan die Materie schon ein bisschen kannte. Die meisten Autoren des Genres waren früher selbst Fans, und die meisten Fans wollen später Autor werden. Auf jeder größeren Science-Fiction-Convention (und zwar lange, bevor Literaturfestivals zum neuen Rock ’n’ Roll hochgejubelt wurden) traf man etablierte Schriftsteller, die, auf eigene Kosten angereist, einem ganzen Saal voller hoffnungsvoller Möchtegernautoren die Grundlagen des Gewerbes beibrachten. Das nennt man Räuberleiterhalten.
Ich schrieb alles mit. Zum Glück bin ich nie in die Verlegenheit geraten, den grandiosen Tipp eines renommierten Autors beherzigen zu müssen. Ich gebe ihn trotzdem weiter: »Verfolgen Sie die Fachpresse. Wenn ein Lektor in einen anderen Verlag wechselt, schicken Sie Ihr kostbares Manuskript unverzüglich an das Lektorat, aus dem er ausgeschieden ist, und legen einen an ihn adressierten Begleitbrief dazu. Beziehen Sie sich auf ein gemeinsames Projekt und schreiben Sie so etwas wie: ›Lieber X, vielen Dank für Ihr ermutigendes Schreiben. Über Ihr Interesse an meinem Buch habe ich mich sehr gefreut. Inzwischen sind sämtliche Änderungen, die Sie vorgeschlagen haben, eingearbeitet …‹ Natürlich ist das Schreiben nirgendwo aufzufinden. In einem Verlag findet man nie etwas wieder. Aber wenigstens könnte Ihr Brief das Lektorat so in Panik versetzen, dass tatsächlich jemand das Manuskript liest.«
Nachdem ich alle guten Ratschläge gehört und gelesen hatte, übergab ich das Manuskript meines ersten Romans einem Kleinverleger in meiner Heimatstadt, den ich von irgendwoher kannte und bei dem ich das Gefühl hatte, er wäre ein anständiger Kerl. Es hat ihm gefallen. Weil ich bis dahin vollkommen unbekannt war und er noch nie Belletristik verlegt hatte, sprang für uns beide nicht viel dabei heraus. Bei den nächsten beiden Büchern auch nicht. Der vierte Roman war der erste Titel der Scheibenwelt-Serie. Man kann nicht gerade behaupten, dass er sich wie warme Semmeln verkaufte, aber doch immerhin wie geschnitten Brot. Nach einigem Zögern brachte Transworld ihn als Taschenbuch heraus. Ein paar Jahre später machte ich meinen ehemaligen Verleger zu meinem Agenten, und das Leben wurde sehr, sehr ausgefüllt.
Ich hatte Glück. Unglaubliches Glück, wenn ich mir vorstelle, was alles hätte schiefgehen können. Aber wenn der schlappohrige Glücksspaniel an den Hosenaufschlägen schnuppert, hilft es, wenn man ein Halsband und eine Schnur einstecken hat. Beziehungsweise, wie in meinem Fall, einen Nachfolgeroman.
In Briefen, E-Mails und aus dem Publikum wird mir von Lesern immer wieder die gleiche Frage gestellt: »Haben Sie ein paar Tipps, wie man Schriftsteller wird?« Man spürt förmlich das Glitzern in ihren Augen, die Hoffnung, dass man dieses eine Mal das Visier hochschiebt und ihnen die Landkarte zum Heiligen Gral aushändigt oder, besser noch, die URL. Wenn ich dann anmerke, dass dabei auch Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung eine Rolle spielen, registriere ich einen Hauch von Verunsicherung, wenn nicht gar Empörung. (»Haben die dafür nicht im Verlag ihre Leute?«, lautete einmal die Gegenfrage.) Eine Empörung, die sich auch gegen das gemeine Universum richtet, das keine Rücksicht darauf nimmt, dass man einfach keine Zeit für so etwas hat.
Also gebe ich lieber Tipps, wie man Profiboxer wird. Natürlich kommt es auf die richtige Ernährung sowie auf tägliches hartes Training an. Denken Sie auch an Ihre Fußarbeit, damit Sie im Notfall schnell verduften können. Gehen Sie jeden Tag ins Fitnessstudio, und damit meine ich jeden Tag Ihres Lebens, an dem Sie sich überhaupt irgendwie auf den Beinen halten können. Nutzen Sie jede Gelegenheit, sich einen guten Profikampf anzusehen. Oder noch besser, sehen Sie sich einfach so viele Kämpfe wie möglich an, weil man auch von Boxern, die ihr Handwerk nicht verstehen, etwas lernen kann. Hören Sie nicht darauf, was sie sagen, beobachten Sie lieber, was sie machen. Und vernachlässigen Sie die Ernährung, das Training und die Fußarbeit nicht.
Kapiert? Mit der Schriftstellerei verhält es sich im Grunde genauso, bloß, dass sie mit Boxen nichts zu tun hat.
So einfach ist das.
Brewer’s Boy
Vorwort für Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable, Milleniumsausgabe, 1999
Vermutlich hat jeder Mensch etwas, woran er seinen Erfolg festmacht. Bei mir ist es die Tatsache, dass man mich gebeten hat, dieses Vorwort zu schreiben. Irgendwie schließt sich dadurch der Kreis. Zu dem ersten Brewer, den ich mir antiquarisch gekauft habe, sind inzwischen etliche Regalmeter hinzugekommen.
Reverend Ebenezer Cobham Brewer wollte den Menschen Wissen vermitteln; zu seinen Werken gehören A Guide to Knowledge, ein Lexikon der Wunder und das Reader’s Handbook of Allusions, References, Plots and Stories. Aber unsterblich gemacht hat ihn Phrase and Fable. Dieses Buch ist … aber sehen Sie selbst.
Ich habe nachgeschaut. Mein alter Brewer steht noch immer neben dem Wörterbuch. Und nun lesen Sie weiter.
Ich war ein Brewer’s Boy. Mit zwölf Jahren zog ich im Antiquariat mein erstes Exemplar aus dem Regal. Es ist bis heute noch erstaunlich gut in Schuss, wenn man bedenkt, wie ich es malträtiert habe.
Der Brewer führte mich in die Mythologie und Geschichte der Antike ein, aber das war noch längst nicht alles. Er ist nämlich eine wahre Schatztruhe an Glücks- und Zufallsfunden. Man findet darin vielleicht nicht, wonach man gesucht hat, macht dafür aber unerwartete Entdeckungen, die meistens noch viel interessanter sind. Einen einzelnen Eintrag zu lesen ist wie eine einzelne Erdnuss zu essen: praktisch unmöglich. Es gibt jede Menge andere nützliche Bücher. Aber im Anfang war der Brewer.
Er ist schwer zu beschreiben. Man könnte ihn ein Kompendium nennen (ein Wort, das in meiner Uraltausgabe weder mit K noch mit C zu finden war, dafür gibt es aber »Complutensische Polyglotte«, die Mühe hat sich also trotzdem gelohnt.) Ein Handbuch der Sagen, Legenden und Zitate, der historischen Nebenpfade, des Slang und von vielem mehr. Eine treffendere Bezeichnung für ihn wäre »Universalgelehrter«, im wahrsten Sinne des Wortes. Seine Blütezeit erlebte der Brewer in den Zeiten vor Trivial Pursuit, als die Menschen noch glaubten, aus dem geduldig zusammengetragenen Wissen über die kleinen Dinge würde automatisch das Wissen über die großen Dinge erwachsen – und man selbst dadurch ein besserer Mensch werden.
Für die vorliegende Milleniumsausgabe wurde Brewer’s aktualisiert. Sie enthält neben Attila dem Hunnen nun auch Gandalf (und warum auch nicht?). Die eine oder andere langweiligere Nymphe und auch einige klassische Obskuritäten wurden herausgenommen, um für sprachliche Neufunde Platz zu schaffen. Wer vom Brewer’s als zu obskur eingestuft wird, ist auf dem Olymp des Obskuren angekommen, und es tut weh, von solchen Einträgen Abschied nehmen zu müssen. Der ernsthafte Brewerist kann nur hoffen, dass sich der Verlag Cassell vielleicht eines Tages zu einer Recyclingausgabe überreden lässt, damit diese ausrangierten Schätze nicht unwiederbringlich verloren sind.
Aber heute ist morgen schon gestern. Eines Tages werden die Fab Four (fragen Sie Ihren Vater) auf einer Stufe stehen mit … ach, mit den ganzen anderen Sachen, für die sich kein Mensch mehr interessiert. Bei dem Tempo, mit dem Veränderungen heutzutage vonstattengehen, sind sie schon jetzt halb in der Versenkung verschwunden. Es ist lehrreich, ihnen dabei zuzusehen, wie sie sich zu den Fabeltieren und römischen Senatoren gesellen und nach und nach vom Staub der Jahrhunderte zugedeckt werden. Wir sind die Antike des nächsten Milleniums.
Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable ist das erste Buch, in das man schaut, wenn man nicht weiterweiß, und die letzte verzweifelte Hoffnung, wenn weniger brauchbare Nachschlagewerke nicht helfen. Ohne den Brewer ist kein Bücherschrank, keine WELT vollständig. So einfach ist das.
Paperback Writer
Guardian, 6. Dezember 2003
Mag sein, dass es am Internet liegt, aber wenn es ums Schreiben geht, fängt jedes Gespräch mit der Frage »Woher?« an. Woher nehmen Sie die Ideen/die Figuren/die Zeit? Dabei schwingt unausgesprochen eine Aufforderung mit: Her mit den Koordinaten für den Heiligen Gral.
Bestenfalls belegt man sein Gegenüber daraufhin mit einer Salve von Klischees, die nur deshalb zum Klischee verkommen sind, weil sie … nun ja, weil sie wahr sind und funktionieren. Bei den diversen Autoren, die ich zu diesem Thema gehört habe, kam früher oder später die gleiche Handvoll Klischees heraus. Auch bei mir. Obwohl man ahnt, dass eigentlich etwas ganz anderes erwartet wird. Aber die Leute stellen immer wieder die gleichen Fragen, in der Hoffnung, dass man das Geheimnis eines Tages aus Versehen doch noch preisgibt.
Immerhin, diese Zeitung hat mir ein Honorar gezahlt. Sich bezahlen lassen: schon mal ein guter Tipp von mir.
Mit dreizehn Jahren war ich auf meiner ersten Science-Fiction-Convention. Wie lange das her ist? So lange, dass dort alle Sportsakkos trugen. Alle außer Michael Moorcock.
Die meisten Science-Fiction-Autoren haben als Fans angefangen. Sie betätigen sich gern als Räuberleiterhalter für den Nachwuchs. Ich kenne kein anderes literarisches Genre, in dem die etablierten »Namen« so versessen darauf sind, sich die Konkurrenz selbst heranzuzüchten.
Als ich von der Veranstaltung zurückkam, stand mein Entschluss fest: Ich wollte Schriftsteller werden. Immerhin hatte ich schon Arthur C. Clarke die Hand gegeben, jetzt hieß es nur noch: Ärmel hochkrempeln.
Sobald ich ein Buch beendet habe, fange ich mit dem nächsten an. Wenn ich mich recht erinnere, war das ein Tipp des verstorbenen Douglas Adams, der sich allerdings zum Leidwesen der Fans an seinen eigenen Rat nicht gehalten hat.
Die letzten Monate eines Projekts sind eine Strapaze. E-Mails schwirren hin und her, man muss einem amerikanischen Lektor die Feinheiten (und vor allem die Unfeinheiten) des britischen Englisch verklickern, der Autor starrt auf einen Text, den er schon so oft gelesen hat, dass er für ihn jeglichen Sinn verloren hat, bastelt und schreibt um und drückt schließlich doch irgendwann auf SENDEN.
Dann ist es weg, und in diesen modernen Zeiten bleibt einem nicht mal mehr der therapeutische Effekt des Ausdruckens. Eben noch Schreibender, im nächsten Augenblick Geschrieben-Habender. Und genau dann, wenn das warme, rosige Gefühl, ein Buch fertiggestellt zu haben, nach und nach verfliegt und sich der schwarze Abgrund einer Wochenbettdepression vor einem auftun will, fängt man mit dem nächsten an. Außerdem ist es ein guter Vorwand, seine Nachschlagewerke nicht wegzuräumen, keine unwichtige Überlegung in einem Büro, wo das eine Buch gern mal als Lesezeichen für ein anderes herhalten muss.
Das nächste Projekt ist noch lange kein Buch. Man hat vielleicht einen Aufhänger, einen Namen, einige Sätze, aus denen eine Szene entstehen könnte, ein Gespräch, eine Handvoll Zeitungsausschnitte, ein paar Lesezeichen in einem alten Geschichtswälzer. Vielleicht tippt man sogar probehalber zwanzig Seiten. Man lässt sich nicht hängen. Man kniet sich wieder voll rein. Man arbeitet an einem Buch.
Außerdem justiert man seinen inneren Empfänger. Nachdem man das neue Buch angepeilt hat, geht es mit der Recherchearbeit los, wobei man alles Mögliche verwertet oder verwurstet, sei es eine beiläufige Bemerkung im Fernsehen oder ein Buch über ein vollkommen anderes Thema, aus dem einem genau im günstigsten Augenblick die Antwort auf eine historische Frage entgegenspringt. Oder man sitzt beim Abendessen zufällig neben einem Botschafter, der nur zu gern darüber plaudert, welche rechtlichen Fragen ein Mord in einer Botschaft aufwirft, wenn der Täter vom Botschaftsgelände flüchtet, also technisch gesehen in ein anderes Land. Auch dieser Leckerbissen wird sogleich der Handlung einverleibt.
Menschen sind hervorragende Informationsquellen, es gibt kaum bessere. Von einem ehemaligen Polizisten erfährt man mehr über die Polizeiarbeit als aus jedem Lehrbuch. Eine alte Dame, die in den 1930er Jahren als Hebamme gearbeitet hat, meilenweit vom nächsten Arzt entfernt, kann Geschichten erzählen, bei denen einem das Blut in den Adern gefriert. Oder ein pensionierter Postbote erläutert, warum man bei der Briefzustellung nicht nur vor dem vorderen Ende von Hunden auf der Hut sein muss.
Außerdem speichert man nebenher natürlich ständig unwillkürlich Informationen. Bei keiner Recherche kommt mehr heraus als bei der, die man leistet, während man glaubt, dass man sich einfach nur des Lebens freut. Auf dem Literaturfestival in Hay-on-Wye fand ich, direkt unter den Augen der anderen Autoren, das Buch The Cyclopedia of Commercial and Business ANECDOTES; comprising INTERESTINGREMINISCENCESANDFACTS, Remarkable Traits and Humours (und so weiter und so fort: 64 Wörter lang). Auf fast jeder Seite stößt man auf kostbare Nuggets: Preserved Fish (= Fischkonserve) war ein berühmter New Yorker Finanzier. Schön sind natürlich auch die von mir so genannten Sekundärentdeckungen, wie zum Beispiel die klammheimliche Freude eines viktorianischen Autors, der sich in einer Abhandlung über eine berühmte deutsche Bankiersfamilie zu Sätzen aufschwingt wie: »Soon there were rich Fuggers throughout Lower Saxony.« (Bald gab es in ganz Niedersachsen reiche Fugger.) Wobei der ungebildete – oder gemeine – Engländer den Namen Fugger etwas anders aussprechen würde. Und nicht zuletzt wäre da noch der aufschlussreiche Einblick in die Köpfe von Menschen, für die Geld nicht Mittel zum Zweck, ja, nicht einmal Mittel zu noch mehr Mitteln ist, sondern das, was für kleine Fische das Meer bedeutet.
Im Laufe der Jahre habe ich das eine oder andere gelernt. Unter anderem, was der beste Ort und die beste Zeit sind, um ein Buch zu planen: das Bett, gleich nach dem Aufwachen. Ich glaube, mein Gehirn wird nachts von einem besseren Schriftsteller mitbenutzt. Nun kommt alles darauf an, dass man ein Notizbuch bereitliegen hat. Und natürlich darauf, dass man hellwach ist. Wäre ich letztens hellwach gewesen, hätte ich vermutlich auf den Zettel neben meinem Bett mehr als nur »MegaPED« geschrieben. Sicher verbirgt sich darin der Schlüssel zu einer Handlungsidee, aber fragen Sie mich bloß nicht, worum es gehen sollte. Ich hab’s nur aufgeschrieben.
Und wenn Sie dann das Gefühl haben, dass in Ihnen ein Buch entsteht, schreiben Sie schleunigst den Waschzettel. Das ist der Klappentext. Ein Autor sollte sich nie zu gut dafür sein, seinen eigenen Klappentext zu verfassen. Die Essenz eines Buchs auf eine halbe Seite einzudampfen hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das Geheimnis der Schriftstellerei besteht zu mehr als der Hälfte daraus, das Buch aus dem eigenen Kopf zu locken.
Ratgeber für Buchhändler
Juli 1999
Dieser Text war ursprünglich nicht zur Veröffentlichung gedacht, sondern für die lieben Menschen bei Ottokar’s. Leider gibt es diese Buchhandelskette nicht mehr, aber die Ratschläge haben auch fünfzehn Jahre später nichts von ihrer Gültigkeit verloren.
Fangen wir folgendermaßen an: Auf den ersten Blick lohnt sich eine Signierreise für einen Autor nicht besonders, und zwar je beliebter der Autor, desto weniger. Läuft die Tour gut, ist sie anstrengend; läuft sie schlecht, ist sie anstrengend, frustrierend und eine Lektion in Demut. Ich bin mir nicht sicher, ob sich dadurch wirklich viele Bücher zusätzlich an den Mann oder die Frau bringen lassen. Im Grunde läuft es doch darauf hinaus, dass die Bücher, die in der Stadt X verkauft werden, hauptsächlich in der Buchhandlung Y über die Theke gehen. Signierstunden haben keinen Einfluss auf die Bestsellerliste – Bookwatch zum Beispiel passt die Meldungen der Geschäfte, in denen Signierstunden stattgefunden haben, nach unten an, damit sie die nationalen Absatzzahlen nicht verzerren. Ein gut verkäuflicher Autor müsste sich schon mächtig ins Zeug legen, um seinen Ranglistenplatz zu beeinflussen. Die Mahlzeiten finden zu den unmöglichsten Zeiten oder gar nicht statt. Man lebt aus dem Koffer. Die Welt rauscht an einem vorbei.
Natürlich spricht auch einiges für das Signieren, aber die Pluspunkte werden in erster Linie von den Buchhandlungen eingeheimst (wenn der Umsatz stimmt) oder vom Verlag (der damit seine Geschäftsbeziehung zur Buchhandlung oder zur Buchhandelskette pflegt). Für die Autoren dagegen kommt meistens nur eins dabei heraus: ein verdorbener Magen.
Wir lassen uns darauf ein, weil man uns zwingt, weil wir eitel sind, weil wir es schon immer gemacht haben, weil wir irgendwie glauben, es gehöre sich so, oder weil wir, auch das kommt vor, einfach Spaß daran haben. Bei einigen von uns geht es auch um das Gefühl, dass unser Werk erst dann wirklich in der Welt ist, wenn wir damit auf Tour gehen. Wie bei einem Musiker, um ein Beispiel aus einem anderen Zweig der Unterhaltungsbranche zu nennen. Man kann im Aufnahmestudio noch so viel Arbeit hineinstecken, Rock ’n’ Roll wird es erst auf der Bühne, vor Publikum.
Was die Buchhandlung vom Autor erwarten darf
Dass er pünktlich ist, höflich zu den Mitarbeitern (bei dem einen oder anderen Autor muss man in dieser Hinsicht Abstriche machen), freundlich zu den Kunden, und dass er sich nicht vor dem vorgesehenen Ende der Signierstunde aus dem Staub macht.
Doch dann beginnt schon die Grauzone. Soll der Autor auch ältere Werke signieren? Telefonisch vorbestellte Bücher? Bestellungen anderer Filialen? In jedes Buch eine Widmung schreiben? Und falls die Signierstunde gut läuft, so lange die Stellung halten, bis auch noch der letzte Käufer in der Warteschlange zufrieden nach Hause gedackelt ist?
Im Zweifelsfall würde ich bei diesen Fragen für ein Ja plädieren. Aber weil so eine Signierreise eine anstrengende Terminhatz ist und überhaupt der ungesündeste Zeitvertreib, den man sich jenseits der Olympiade im Schmalzessen nur vorstellen kann, sollten diese Punkte besser bereits im Vorfeld behutsam mit dem Verlag abgeklärt werden.
Was darf der Autor von der Buchhandlung erwarten?
In den letzten elf Jahren war ich fünfzehn Monate »auf Tour«. Hier ein paar Beobachtungen, die ich zusammengetragen habe:
Vor der Veranstaltung
Sind Bücher da? Nicht lachen! Manchmal gibt es das Buch tatsächlich nicht – oder nicht in ausreichender Zahl. Hin und wieder landet man immer noch in einem altmodischen Laden, der für eine Signierstunde sage und schreibe fünfundzwanzig Exemplare extra bestellt.
Es schadet nicht, wenn die Mitarbeiter schon mal etwas von dem Autor gehört haben und wissen, weshalb er da ist.
Zur Begrüßung darf der Gast ein bisschen mehr erwarten als ein: »Warten Sie da, ich hole wen.« Oder auch ein: »Ach? War das heute?« Denken Sie daran: Ganz gleich, wie erfolgreich ein Autor auch sein mag, hinter seiner coolen Fassade bibbert er wie ein kahlrasierter Affe. Über ein freundliches Lächeln freut er sich wie ein kleines Kind. Angenommen, er hat sich wie ein braver Junge mehr als rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn bei Ihnen eingefunden, dann können Sie ihm auch noch mit anderen Dingen eine Freude machen, beispielsweise mit einem
… Stuhl in einem Büroraum (jedenfalls mehr Freude als mit einem Hocker in einer Abstellkammer), wo er bei einer Tasse Tee ein bisschen runterkommen kann. Ich nutze diese Zeit gern, um schon mal Vorbestellungen oder Bücher aus dem Sortiment zu signieren, und lasse mir dabei die neuesten Klatschgeschichten erzählen. Ein Autor freut sich immer, wenn er erfährt, dass die Signierstunde eines Kollegen eine noch größere Pleite war. (Falls Ihnen nach Schabernack zumute ist, können Sie natürlich auch einen Erzrivalen Ihres Gastes in den höchsten Tönen loben und ihm dabei zusehen, wie seine Miene zu Stein erstarrt. Das ist spaßig, aber nicht ratsam.)
Ich selbst schreibe für gewöhnlich nur in Ausnahmefällen eine Widmung in die Vorbestellungen, weil dafür meistens schlicht und einfach die Zeit nicht reicht, aber für Sie als Buchhändler empfiehlt es sich, vorher beim Verlag nachzufragen, wie es der jeweilige Autor damit hält. Das sinnvolle Mantra auf ein solches Ansinnen lautet: »Aus Zeitgründen können wir keine Widmungen in Vorbestellungen garantieren.« Ich sage lieber gleich nein, wenn mit einem großen Ansturm zu rechnen ist. Dann macht sich niemand falsche Hoffnungen. So praktisch es auch ist, sich Bücher für andere Filialen gleich mitsignieren zu lassen, versteifen Sie sich nicht darauf. Wenn es zeitlich irgendwie machbar ist, sind die meisten Autoren gern dazu bereit. Aber stellen Sie sich nicht stur und tun Sie nicht so, als hätten Sie selbst rein zufällig sechshundert Exemplare auf Lager. Das ist ein alter Trick. Immer schön fair bleiben.
Wenn Sie von den lokalen Medien wegen eines Interviews angesprochen werden, geben Sie dem Verlag um Himmels willen so früh wie möglich Bescheid. Am besten leiten Sie die Anfrage direkt an die Presseabteilung weiter. Vielleicht lässt sich ja ein Termin einschieben, aber natürlich nur, wenn man vorher davon weiß. Es kann heikel werden, wenn plötzlich ein Interviewer aufkreuzt (der etwas murmelt wie: »Das war mit irgendwem abgesprochen«) und ein zwanzigminütiges Gespräch führen will, während die Leute Schlange stehen. So etwas gehört sich nicht.
Werbung für die Veranstaltung sollte vor der Veranstaltung gemacht werden. Mir wäre es auch lieber, ich müsste das nicht extra erwähnen.
Die Veranstaltung
Gibt es einen Tisch und einen Stuhl? Nein, leider wieder kein Scherz. Einmal war für mich weder noch bereitgestellt, und auch sonst habe ich in Buchhandlungen schon auf oder an den seltsamsten Möbeln Platz nehmen müssen. Wenn ich Tisch und Stuhl sage, meine ich einen echten Tisch und einen echten Stuhl, keinen Hocker an einem Regal, sodass man sich ständig die Knie anstößt. Überlegen Sie einfach, auf welcher Sitzgelegenheit Sie es selbst stundenlang bequem aushalten würden.
Machen Sie sich auch ein paar Gedanken darüber, wo Sie den Tisch aufstellen. Ich habe am liebsten eine Wand, ein Regal oder sonst etwas im Rücken. Dann kann mir nämlich der schniefende Jugendliche im blauen Anorak nicht zwei Stunden lang über die Schulter glotzen. (Und so einer ist immer dabei.) Das stört.
In manchen Buchhandlungen setzt man den Autor gern in die Nähe des Eingangs. Das ist im Winter keine gute Idee – wenn Sie nicht wollen, dass der Autor friert. Schützen Sie ihn vor den schlimmsten eisigen Böen! Findet die Signierstunde in einem Einkaufszentrum statt, wird man hin und wieder auch vor der Buchhandlung platziert. Bei einem VIP-Autor, der riesige Menschenmassen anlockt, kann das durchaus funktionieren, aber für den großen Rest ist es die Hölle. Außerdem ist es immer zu laut, und man wird von einem griechischen Chor umringt – alten Mütterchen, die mit stierem Blick halblaut vor sich hin knurren: »Wer issn der? Wer issn der? Isser aussem Fernsehen? Wer issn der?«
Eine Blumenvase auf dem Tisch? Nette Geste, aber irgendeiner kippt sie garantiert um. Nehmen Sie sie lieber runter, bevor die Signierstunde anfängt.
Viele Autoren haben ihre eigenen Stifte dabei, aber es schadet nie, ihnen zur Reserve noch ein paar hinzulegen, und am besten auch einen Filzstift, der auf glatten Oberflächen schreibt. Bitte keine angekauten Kulis – denen fehlt das gewisse Etwas. Manche Autoren sind dankbar, wenn man ihnen das Buch an der richtigen Stelle aufklappt, andere betrachten eine solche Hilfe als ihr gutes Recht. Jeder ist anders. Aber nach meiner Erfahrung sind die meisten schon zufrieden, wenn man sie in Ruhe signieren lässt, und verlangen nichts weiter, als dass ein Mitarbeiter dafür abgestellt wird, sie vor dem Irren mit dem Hackebeil zu beschützen.
Vergessen Sie auch die Schlange nicht. Lassen Sie die Menschen nach Möglichkeit nicht im Regen anstehen. Offenbar ist eine Warteschlange für einige Buchhändler so etwas wie eine Ansammlung lästiger Störenfriede, die bestraft gehören, und keine lange Reihe von Kauflustigen. Ich dagegen würde jederzeit noch einmal in dem (kleinen) Buchladen signieren, dessen Besitzer, nachdem ihm an einem kalten Novembertag nichts anderes übrig geblieben war, als die Kunden vor der Tür warten zu lassen, kurz entschlossen über die Straße gesprungen ist und in der Bäckerei gegenüber 210 warme Teilchen zum Vorzugspreis organisiert hat. Das hatte Stil und war wahrscheinlich auch noch gut fürs Geschäft.
Frauen mit kleinen, laut plärrenden Kindern sollten einen vorderen Platz in der Schlange bekommen, damit keine Trommelfelle in Mitleidenschaft gezogen werden. Bei Rollstuhlfahrern habe ich des Öfteren erlebt, dass sie nicht nur nichts dagegen haben auszuharren, bis sie an der Reihe sind, sondern geradezu erpicht darauf sind. Wie sagte mal einer zu mir? »Schließlich kann ich wenigstens sitzen.« Trotzdem sollte man eine lange Schlange unauffällig im Auge behalten, für den Fall, dass doch mal jemand dabei ist, für den das Warten eine Belastung ist.
Wenn Sie in Ihrer Buchhandlung einen Fernsehstar zu Gast haben, der ein Werk à la »Das Jux-und-Dollerei-Weihnachtsbuch« promoten will, verkneifen Sie sich einen Kommentar, wenn der Promi während der Signierstunde in seinem Machwerk schmökert. Möglicherweise sieht er das Buch zum ersten Mal. Bieten Sie ihm nicht an, ihm bei den mehrsilbigen Wörtern auf die Sprünge zu helfen.
Halbleeres Haus? Oder sogar ganz leeres? Wenn überhaupt niemand gekommen ist, muss etwas komplett schiefgegangen sein. Vor allem, wenn Sie für die Veranstaltung auch noch tüchtig die Werbetrommel gerührt haben. Wahrscheinlich können Sie nichts dafür. Lassen Sie den Autor nicht allein versauern, sondern reden Sie mit ihm, verstecken Sie die Messer und trösten Sie ihn, dass es bei der Signierstunde von Miss X sogar noch katastrophaler gelaufen ist.
Volles Haus? Vor lauter Erleichterung signieren die meisten Autoren die Bücher sämtlicher Leute, die sich vor dem offiziellen Ende der Veranstaltung in die Schlange eingereiht haben. Viele machen so lange weiter, bis man ihnen kein Buch mehr hinlegt oder die Zeit knapp wird. Man munkelt, dass es auch Kollegen geben soll, die nach dem Ende der Signierstunde ohne Rücksicht auf Verluste den Stift fallen lassen. Wenn die ihre Leser unbedingt verprellen wollen, können Sie ihnen auch nicht helfen. Bleiben Sie gelassen. Vielleicht müssen sie noch zu einem anderen Termin oder haben schon eine sehr lange Woche hinter sich. Eine gute Pressestelle hätte genügend Zeit eingeplant, aber gegen einen Sechsmeilenstau auf der Autobahn ist niemand gefeit.
Hege und Pflege des Autors