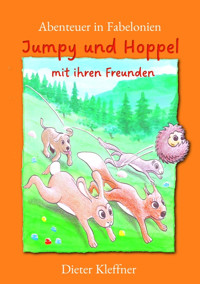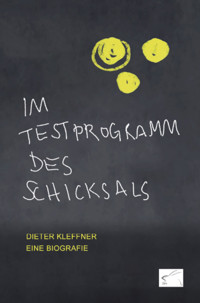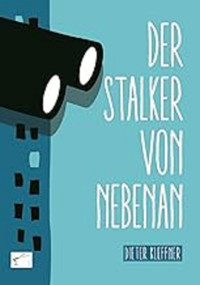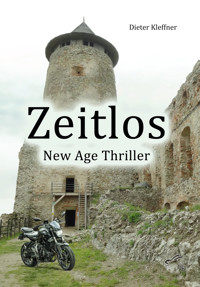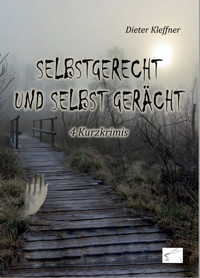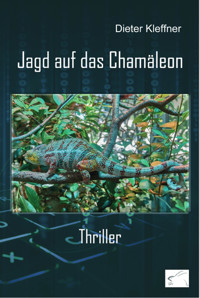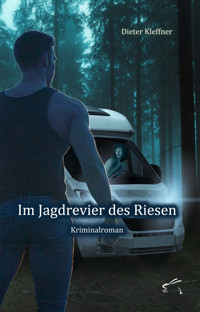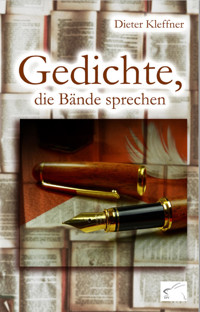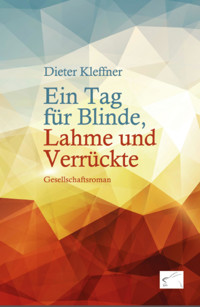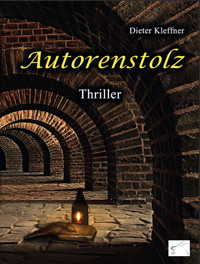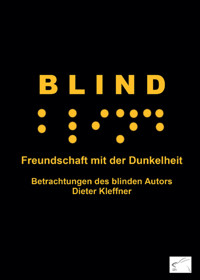
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Paashaas Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Blind – wirkt dieses Wort auf Sie schockierend? Die positive Einstellung und die Annahme der Behinderung begannen für den blinden Autor erst, als er mit der Dunkelheit Freundschaft geschlossen hat. Freundschaft braucht blindes Vertrauen, mit selbstverständlichem Geben und Nehmen. Ja, die Dunkelheit kann Menschen auch etwas geben, kann nützlich sein. Sie zwingt uns, andere Zeitgenossen nicht nach ihrem Äußeren, sondern nach ihren Äußerungen zu beurteilen. Das schützt vor Verblendung und Trugbildern. Reisen Sie ein Stück durch die Dunkelheit. Vertrauen Sie dem Autor blind. Erleben Sie viele Alltagssituationen, in denen Menschen ohne Sehvermögen zurechtkommen müssen, zum Beispiel beim Reisen, Einkaufen oder Essen. Möchten Sie wissen, wie die Blindenschrift entstanden ist oder ob es sogar geheime Botschaften auf Mohnbrötchen gibt? Was machen zwanzig blinde Schriftsteller während ihrer literarischen Tagung? Interessiert es Sie, welche Blindenwitze sich die Betroffenen an ihrem Stammtisch erzählen? Diese Lektüre will Ängste und Befremdungen abbauen. Sie bietet sachliche Informationen rund um das Thema Sehbehinderung, unterhält und lädt zum Schmunzeln ein. Mit Gastbeiträgen von Karin Klasen und David Röthle, beide ebenfalls erblindet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Edition Paashaas Verlag
Autor: Dieter KleffnerOriginalausgabe April 2019 Cover designed by Michael Frädrich © Copyright Edition Paashaas Verlag Printausgabe: ISBN: 978-3-96174-037-6
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.
Blind!
Freundschaft mit der Dunkelheit
Betrachtungen des blinden Autors
Dieter Kleffner
Für BLAutor,
den Arbeitskreis sehbehinderter und blinder Poeten und Schriftsteller, dem ich freundschaftlich verbunden bin
Prolog
Die Erde dreht sich in vierundzwanzig Stunden einmal um sich selbst. Dabei rotiert sie so um ihre eigene Achse, dass eine Hälfte ihrer Oberfläche mal dem Licht der Sonne ausgesetzt und mal abgewandt ist. Licht und Helligkeit gehören dem Tag, Lichtlosigkeit und Dunkelheit bestimmen die Nacht. Die Lebewesen der Erde können nur überleben, wenn sie sich von biologischer Materie ernähren. Das bedeutet, dass andere Lebewesen verzehrt werden müssen. Egal, ob es sich um pflanzliche oder tierische Wesen handelt. Die Natur kennt keine Moral, sondern nur das Überleben. So entstand und besteht der ewige evolutionäre Kampf um die biologische Materie. Diese biologische Materie muss passend zur Art des Lebewesens gefunden und oft erbeutet werden.
Die Wesen der Nacht werden von der Dunkelheit vor den Jägern beschützt, die ihre Beute sehen müssen. Sie besitzen Sinne und Fähigkeiten, die sich kaum auf optische Eindrücke, das Sehen, stützen. Bei einigen von ihnen sind das Gehör, der Geruchs- und Tastsinn besonders ausgeprägt. Sie jagen zusätzlich mit Hilfe von Infrarotsensoren oder Ultraschallsystemen, um nur einige zu nennen. Auch tagsüber wird im Dunkeln gejagt. Der Maulwurf lebt hauptsächlich unter der Erdoberfläche und hat schlechte Sehkraft. Seine vier übrigen Sinne sind jedoch extrem sensibilisiert. In den Tiefen der Meere wird ebenfalls ohne Tageslicht gejagt.
Die Wesen des Tages, des Lichts, empfinden die Dunkelheit beängstigend, da sie mit Hilfe der Augen bei Lichtmangel einen Feind kaum erkennen. Wenn die Sehkraft im Dunkeln als Hauptinformationsquelle ausfällt, so mahnt der Instinkt zur größten Vorsicht. Wir Menschen erhalten im Dunkeln die gleichen Impulse und fühlen uns unwohl. Im Dunkeln Angst zu haben bedeutet nichts anderes als auf natürliche Weise achtsam zu sein. Hat sich unser Verstand davon überzeugt, dass wir absolut sicher sind, so löst sich die Angst völlig auf und wir fühlen uns wieder wohl. Längst haben die Menschen mit ihrer Technik die Nacht zum Tag gemacht. Man spricht in dicht besiedelten Gebieten von Licht-Smog, der dem Biorhythmus die schlaffördernde Dunkelheit entzieht.
Der ästhetische Anblick wandernder Planeten, der Sternenbilder und der Milchstraße geht in Ballungsgebieten fast verloren, und damit auch der natürliche Bezug des Menschen zum Nachthimmel. Wer jedoch die Dunkelheit als Quelle der Ruhe und der Möglichkeit zur inneren Einkehr genießt, der beginnt, mit ihr Frieden und Freundschaft zu schließen.
Bei einer Erblindung steht man laut dem Volksmund völlig im Dunkeln. Eine echte Dunkelheit ist das nicht, aber unser Instinkt nimmt die Situation tatsächlich als solche war. Also steht dem Sehverlust zu Anfang die natürliche Angst gegenüber. Diese Angst löst sich auf, sobald dank guter Schulungen und vernünftiger Einstellungen auch mit der Erblindung Freundschaft geschlossen wird.
Mein Weg in die Dunkelheit
Ich wurde 1957 mit einem ‚Grünen Star‘ im Herzen des Ruhrgebiets geboren und noch im Säuglingsalter an beiden Augen operiert. Mit einem Visus, also einer Sehstärke, von knapp 50% auf dem besseren Auge und Glasbausteinen in der Brille traf ich im Kindergarten auf die ersten dummen Sprüche meiner Altersgenossen. Die Benutzung eines Opernglases zum Lesen der Schultafel schob mich auf der Spottliste auf Platz 1. Ich kompensierte den gesellschaftlichen Druck als Klassenclown und erntete bald die Anerkennung meiner normal sehenden Mitschüler und die für mich ärgerlichen Klassenbucheinträge.
Das Sehen wurde noch schlechter und ich machte an der Rehabilitationsstätte für Sehbehinderte und Blinde in Mainz eine Ausbildung zum Masseur und medizinischen Bademeister. Dort fühlte ich mich unter ähnlich Betroffenen zum ersten Mal richtig anerkannt und absolvierte mit Freude mein Examen. Ich bekam eine Anstellung in einer Klinik, heiratete und gründete eine Familie. Die Glückseligkeit wäre perfekt gewesen, doch dann wurde der ‚Grüne Star‘ wieder aktiv. Mit zwölf weiteren drucksenkenden Augenoperationen flüchtete ich jahrelang vor dem weißen Stock. Trotz größter Bemühungen der Ärzte mündete mein Sehen in völliger Erblindung. Alle Gegenstände begannen mit mir zu sprechen. Das waren die Uhr, die Waage, der Taschenrechner, das Vorlesesystem, die Hörbücher usw. Selbst mit dem weißen Stock hatte ich endlich Freundschaft geschlossen und inneren Frieden gefunden. Meiner Meinung nach hatte ich mein Testprogramm des Lebens bestanden.
Das war ein großer Irrtum, denn das Programm war noch gar nicht zu Ende! Knochenmarkkrebs und Lymphdrüsenkrebs katapultierten mich nach 34 Jahren Klinikarbeit aus meinem Beruf und ich landete mitten in einem existenziellen Vakuum. Zwischen den Chemotherapiezyklen nutzte ich die freie Zeit, mich autodidaktisch in die Anwendung eines Screen Reader-Programms einzuarbeiten, um blind den PC bedienen zu können. Durch diesen neuen Schicksalsweg fand ich die Liebe zum Schreiben und erarbeitete ein autobiografisches Manuskript. Angehörige und Freunde hatten dieses mit Begeisterung gelesen und mich gedrängt, den Schritt zur Publikation zu wagen. Im Herbst 2012 konnte ich dank vieler lieber Helferlein die Autobiografie unter dem Titel „Im Testprogramm des Schicksals“ als Taschenbuch und E-Books auf den Buchmarkt bringen. Es folgten umfangreiche, positive Berichte in der Presse der Sehbehindertenverbände und der Lokalpresse. Um den Nichtbehinderten einen noch tieferen Einblick in die Welt behinderter Menschen zu geben, veröffentlichte ich im Jahr 2015 den Gesellschaftsroman „Ein Tag für Blinde, Lahme und Verrückte“. Auch dieses Buch stieß in der Presse der Sehbehindertenverbände auf gute Kritik. Während dieser Zeit wurde ich Mitglied im Literaturzirkel der BLAutoren. Das ist eine Gruppe sehbehinderter und blinder Poeten, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die sich aus dem gesamten deutschsprachigen Raum als Arbeitskreis zusammengeschlossen haben. Ich erweiterte meine schriftstellerischen Tätigkeiten auch im Genre der Kriminalromane und wechselte mit der Buchproduktion zum Edition Paashaas Verlag. So ist das Schreiben nun mein leidenschaftlicher Lebensinhalt geworden.
Da mir von vielen Lesern zum Thema Erblindung immer wieder neue interessante Fragen gestellt wurden und werden, möchte ich mit diesem Buch Antworten geben und verständliche Eindrücke vermitteln. Aber am wichtigsten ist es mir, dass alle Sehbehinderten und Blinden, die ihre Behinderung noch nicht annehmen konnten, mit Hilfe meiner Beispiele und Gedanken auch dem unausweichlichen Schicksal freundschaftlich die Hand reichen.
Dieter Kleffner
Kapitel I – Die Augen schließen, das geistige Auge öffnen!
01 Über Sinne und Unsinn
Jeder Mensch hat ein Weltbild. Doch jeder erfasst seine Welt ganz individuell. Wir können ähnliche Weltbilder haben, aber nie dieselben. Die Vorstellung von der äußeren physikalischen Welt entsteht in unserem Gehirn mit Hilfe der Informationen der fünf klassischen Sinnesorgane. Gemeint sind die Sinneswahrnehmungen Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Ertasten. Bei dieser klassischen Aufzählung gerät fast immer der Gleichgewichtssinn in Vergessenheit, dessen Sensoren im Innenohr liegen. Gerade bei geschlossenen Augen gibt dieser Sinn dem Gehirn die Informationen, ob wir schwanken oder ein Tablett mit Gläsern vor uns in der Waage halten.
In antiken Schriften bis hin zur Neuzeit wird immer wieder behauptet, dass es Menschen mit dem sechsten Sinn gäbe, der auch als ‚das zweite Gesicht‘ bezeichnet wird. Dabei handelt es sich um die Fähigkeit, Ereignisse vorauszusehen, die in der Zukunft liegen. Einer der berühmtesten Menschen mit dieser Fähigkeit war Nostradamus. Da seine Voraussagen alle in der Form einer Metapher überliefert wurden, war das Eintreten seiner Voraussagen immer reine Auslegungssache.
Ganz sicher gibt es aber den Unsinn, der ständig durch Unwissenheit entsteht. Unsinnig ist zum Beispiel die Behauptung, dass blinde Menschen besser hören als Sehende. Nein, diese Betroffenen haben ein genauso gutes oder weniger gutes Gehör wie alle Sehenden! Aber wer keine optischen Informationen bekommt, der ist gezwungen, die Informationen der übrigen Sinnesorgane besser auszuwerten. Einfach ausgedrückt: Der sehbehinderte Mensch hört genauer hin, sensibilisiert seinen Tastsinn, schnuppert öfter und schmeckt intensiver ab. Ich weiß als Betroffener, wovon ich spreche.
Häufig wird mir die Frage gestellt: „Kann man nichts gegen die Erblindung tun? Im Fernsehen wurde doch gezeigt, dass man Augen transplantieren kann. Es gibt auch elektronische Brillen.“
Da ist er wieder, der Unsinn. Liebe Leser, fragen Sie jeden anderen, aber bitte nie einen blinden Menschen, ob man gegen seine Erblindung nichts unternehmen kann. Niemand ist freiwillig blind. Alle Blinden, die ich kennengelernt habe, sind sehr gut über den Stand der Augenheilkunde informiert. Bei wissenschaftlichen Meldungen über geplante Heilungserfolge in den Bereichen künstlicher Sehzellen oder gar der Gentechnologie bekommen alle Blinden spitze Ohren. Doch nicht alle behalten wie ich bei unsinnigen Fragen einen ruhigen Puls. Deshalb kläre ich auch gerne auf.
Ja, es gibt bei der Erblindung durch eine Hornhauttrübung die Möglichkeit der Transplantation. Doch bei dieser sogenannten Keratoplastik wird nur am vorderen Auge die trübe Haut durch eine klare ersetzt, nicht das gesamte Auge. Da es sich bei der transplantierten Haut um eine Organspende handelt, muss aufgrund der Abstoßungsgefahr das Immunsystem des Patienten auf Dauer mit Medikamenten beeinflusst werden. Deshalb sind in diesem Fall Nutzen und Schaden gründlich auszuloten.
Auch die elektronische Brille gibt es, mit der ein Blinder besser sehen kann, als das mit gesunden Augen möglich wäre. Diese Brille gehört Geordi La Forge, dem blinden Navigator im Raumschiff Enterprise, also nur zu finden im Genre Science-Fiction! Elektronische Brillen können zurzeit das natürliche Auge maximal wie eine Lupe oder ein Fernglas unterstützen.
02 Das Dunkelrestaurant – der Praxistest für coole Sehende
Über Blindheit etwas zu hören ist interessant. Das Nichtsehen mal für wenige Stunden zu erleben, ist viel eindrucksvoller. Das lässt sich völlig gefahrlos in die Praxis umsetzen.
Jeder sehende Gast, der die Neugier und den Mut aufbringt, ein köstliches Menü in einem Dunkelrestaurant einzunehmen, fordert seinen vier verbliebenen Sinnen ungewohnte Leistungen ab. Hören, Tasten, Riechen und Schmecken verlangen plötzlich mehr Aufmerksamkeit und Konzentration.
Die moderne Gesellschaft ist es gewohnt, während des Essens zu plaudern, mit den Augen Milieustudien zu betreiben oder sogar auf dem Smartphone zu tippen.
Nein, das wird in einem Dunkelrestaurant bewusst ausgeschlossen.
Begleiten wir nun vier Gäste, die einen Tisch im Dunkelrestaurant reserviert haben. Sie werden im beleuchteten Empfangsraum freundlich gebeten, alle Lichtquellen wie leuchtende Armbanduhren, Smartphones und Feuerzeuge in den Jacken oder Handtaschen zu verstauen und diese an der Garderobe abzugeben. Und schon kann das Abenteuer beginnen.
Eine hochgradig sehbehinderte oder blinde Mitarbeiterin stellt sich vor und bittet die Gäste in einen kleinen Zwischenraum. Dieser dient als Schleuse zum Dunkelbereich. Wird die Tür zum beleuchteten Empfangsraum geschlossen, ist es bereits finster. Die Mitarbeiterin erklärt: „Mein Name ist Maria. Traditionell sind wir hier alle per Du. Das entspannt die Situation.“ Auch die Gäste nennen ihren Vornamen. Maria fährt fort: „Ich bediene euren Tisch und bin jederzeit abrufbar. Jede Handreichung wird angekündigt und genau erklärt. Sollte sich jemand nicht wohlfühlen oder zur Toilette müssen, dann geleite ich die Person sofort hinaus. Wir werden uns nun wie bei einer Polonaise an die Schultern fassen und ich gehe voraus. Wenn niemand mehr eine Frage hat, dann geht es nun los.“
Nein, keiner dieser Gäste hat eine Frage. Alle haben nur ein mulmiges Gefühl. Ein Gefühl, wie vor der Fahrt in einer dunklen Geisterbahn. Unzählige Stimmen sind hinter der nächsten Tür zu hören. Teilweise laut und vergnügt. Also kann das Ganze gar nicht so furchtbar sein.
Maria öffnet die Tür zum inneren Restaurant. Und tatsächlich … es herrscht absolute Finsternis. Schlagartig verstummen alle Stimmen. Die anderen Gäste lauschen gespannt. Was verändert sich jetzt? Ah, da kommen scheinbar neue Gäste. Die sind ebenfalls stumm, völlig auf die Schulterbewegungen des Vorgängers, auf die eigenen Schritte und das Gehör konzentriert. Schwatzen und gleichzeitiges Lauschen harmonieren nicht.
Die bereits Anwesenden schmunzeln getarnt von der Dunkelheit. Sie wissen, wie froh und dankbar jeder der Neulinge gleich sein wird, wenn er sicher und fest auf seinem Stuhl sitzen darf. Leise und zaghaft nehmen die übrigen, unsichtbaren Gäste an unsichtbaren Tischen ihre Gespräche wieder auf.
Doch die neuen Gäste fragen sich: Wie viele Tische und Leute sind eigentlich in diesem Raum? Wie viele Schritte sind wir schon gelaufen? Man hätte diese doch zählen können. Zu spät dran gedacht!
„Wir sind angekommen“, sagt Maria fröhlich. Nacheinander ertasten die vier angespannten Personen die linke und die rechte Tischkante, dann endlich jeder seinen Stuhl. Irgendjemand pustet durch gespitzte Lippen erleichtert aus. Es hört sich wenigstens so an.
Maria nimmt sogleich die Getränkebestellung auf. Erst jetzt fällt auf, dass es rundherum wieder äußerst laut geworden ist. Maria macht mit ihrem Mund kurz ein zischendes Geräusch. Ein „Sch…“, wie wir das noch aus der Schule kennen, wenn der Lehrer Ruhe haben wollte.
Sehende Menschen sind in der Lage, bis zu vierzig Prozent Hörverlust mit den Augen auszugleichen. Sie sehen, wenn sie angesprochen werden. Sie haben von klein auf gelernt, von den Lippen zu lesen. Sie analysieren den Ausdruck der Augen, die Mimik und Gestik ihres Gegenübers. Diese Fähigkeit ist im Dunkelrestaurant vorübergehend futsch. Also meint nun fast jeder Gast, unter einem Hörverlust zu leiden und wird lauter und lauter. Erstaunlich …, ein Zischen und alle sind in diesem Raum sofort still. Das würde in keinem beleuchteten Restaurant geschehen, weil die Augen die Situation souverän überblicken und beherrschen können. Im Dunkeln muss man schon hinhören, um eine eventuell wichtige Information mitzubekommen. Wie gesagt: zuhören und gleichzeitig quatschen geht nun mal nicht. Also sind alle Gäste kurz ruhig, dann flüsternd, dann wieder laut.
Oh, Maria ist weg. Und nun? Bloß nicht aufstehen! Das Gesäß empfindet den Stuhl nun als Orientierungshilfe. Nur die Hände könnten ein bisschen Auslauf vertragen. Vorsichtig lassen die neuen Gäste ihre Finger über die Tischplatte gleiten. Sie ist nackt. Keine Tischdecke, kein Platzdeckchen, die bekleckert werden könnten. Sehr praktisch und beruhigend. Steht denn überhaupt etwas auf dem Tisch? Allgemein stehen dort doch traditionell Pfeffer und Salz. Meistens eine Kerze. Aber damit muss man hier wohl nicht rechnen. Ein Blumengesteck ist auch nicht zu erwarten. Ist ja toll. Die können sich hier die gesamte Tischdekoration sparen. Wie sauber ist es hier eigentlich? Die Finger ertasten rechts eine Fensterbank. Ach so, mit Folie wurde alles verdunkelt.
Etwas angespannt beginnt das Tischgespräch und stoppt schon bald abrupt.
„Die Getränke sind da!“, ist plötzlich Marias Stimme zu hören. Vorsichtig strecken sich ihr suchende Hände entgegen. Wie hoch muss man wohl greifen? Ist ihre Hand schon da? Oder hat man sich verpasst? Oh je, jetzt bloß nichts überschwappen lassen. Nicht auf das gute Kleid, nicht auf die gute Hose. Eigentlich wäre das völlig egal, sieht hier doch niemand. Ja, das wäre tatsächlich egal, wenn nicht im Anschluss draußen die sehende Welt warten würde. Die sehende Welt, die jeden Fleck und jeden hässlichen Pickel wahrnimmt.
Geschafft! Alle haben ihre Gläser bekommen und direkt schon einmal genippt. Sieht doch niemand! Aber das Glas wird jetzt nicht mehr losgelassen.
Wo ist Maria? Sie ist schon wieder unterwegs. Sie kennt die Räumlichkeit, hat in ihrem Kopf einen ziemlich genauen Plan von der Einrichtung. Ihre Hand streift an mehreren Tischkanten entlang und sie weiß immer, wo sie ist. Die andere Hand schiebt einen kleinen Servierwagen, auf dem Gläser und Flaschen recht sicher stehen. Sie verraten ihr Vorhandensein hin und wieder durch leises Klappern.
Das Tischgespräch wird entspannter und lauter. Die neuen Gäste gewöhnen sich an die Situation.
„Wer von euch hatte als Vorspeise Suppe bestellt und wer den Salat?“ Maria ist schon wieder aus dem Dunklen zu hören.
Vorsichtig tasten Finger nach Suppentassen mit Unterteller, andere nach Salattellern. Maria wünscht guten Appetit und verschwindet wieder im Nichts.
Löffel erkunden die heiße Flüssigkeit. Die Art der Suppe wurde zuvor nicht angekündigt. Das soll der Geschmackssinn analysieren. Ist der Löffel denn schon voll? Also hier im Dunkeln kann man mit dem Mund auch direkt über die Tasse gehen. Sieht doch niemand. Oh, heiß! Habe ich jetzt geschlabbert? Also vorne auf der Tischkante ist nichts zu fühlen. Nicht zu feste pusten! Man sieht ja nicht, ob dann etwas aus dem Löffel schwappt.
Gegenüber stochert eine Gabel im Salat. War hier nicht auch ein Messer auf der Serviette? Tatsächlich. Da ist es doch. Salat schneiden ohne etwas zu sehen, ist nicht leicht. Die Fingerkuppen melden, dass eine Tomate und das Dressing bereits neben dem Teller die Tischplatte erreicht haben.
„Wo ist mein Messer geblieben?“, fragt der Nachbar und stößt kräftig an sein Bierglas. Es wackelt und wackelt und bleibt doch stehen. Irgendjemand muss wohl zwei Messer haben. Finger suchen. Finger finden.
Weiter mit dem Salat. Wieso schmeckt der jetzt an einer Stelle nach Bier? Die Serviette ist weg. Wer hat denn jetzt zwei Servietten?
Die Suppentasse ist mittlerweile halb geleert. Geht der Geschmack Richtung Kürbissuppe oder doch Richtung Pfifferlinge? Also Tomaten sind es nicht. Die Zunge analysiert kleinste Gegenstände. Kräuter oder so. Etwas Cremiges ist auch dabei. Längst liegt der Löffel nutzlos am Rand des Untertellers. Die Lippen berühren die Tasse und trinken direkt daraus. Sieht doch niemand, schmeckt genauso und ist stressfreier als löffeln.
Auf jeden Fall sind Pinienkerne im Salat. Das ist sicher. Blöd ist nur, dass der Lollo Bianco so weit über die Gabel hängt, dass das Gestrüpp samt Dressing gegen die Wange klatscht. Wo ist die Serviette?
Mittlerweile wird es wieder zu laut und dieses Mal zischt Marias Kollege Theo, um Ruhe hineinzubringen.
Der Hauptgang folgt. Schon bei der Tischbestellung hatte jeder Gast im Vorfeld zwischen Rindfleisch, Schweinefleisch, Geflügel, Fisch oder mediterraner Küche gewählt. Die Beilagen bleiben zunächst geheim. Sie sollen ja im Dunkeln erschnuppert und erschmeckt werden.
Maria wünscht wieder „Guten Appetit“ und lässt die Gäste mit ihren soeben servierten Speisen zurück. Gabelzinken und Messerspitze prüfen die Materialdichte. Wenig Widerstand - vielleicht eine Kartoffel? Mehr Widerstand – vielleicht ein Rosenkohl? Was kugelig erscheint und nach dem Druck mit dem Messer auch noch über den Tellerrand rollt, kann nicht das Schnitzel sein.
Gegenüber setzt der andere Gast sein Bierglas an gewohnter Stelle ab. Ein kugeliges Hindernis hätte die Aktion fast zum Kippen gebracht. Finger suchen nach dem Hindernis. Ist das etwa vom eigenen Teller geflüchtet? Oder wurde es doch von seinem Gegenüber frech untergeschoben?
Alle an diesem Tisch sind still und konzentriert. Mancher leckt sich bereits die Finger. Nicht nur, weil es so klasse schmeckt, sondern weil ihm einzig die Finger ein klares Bild davon vermitteln, wie viele Kartoffel- und Gemüsestückchen sich heimlich auf den Weg zum Nachbarn gemacht haben.
Marias Stimme ist plötzlich wieder da: „Na, kommt ihr zurecht?“ Einstimmig kommt die Antwort: „Danke, bestens, bestens!“
Wein und Bier beruhigen die Nerven. Die Anspannung wird weniger und das Geklecker auf dem Tisch ist ein bisschen mehr geworden.
Fehlt noch das Dessert. Wo kommt das denn her? Ideal, es ist ein Schälchen mit kleinen Früchten. Lippen schmiegen sich an den Rand des Schälchens und der kleine Löffel schiebt die Köstlichkeit direkt in den Mund. Sieht doch niemand.
Stumm steht die Frage im Raum, ob die Gäste ihre Etikette vergessen und heute überwiegend mit der Finger-Food-Technik gespeist haben. Niemand weiß das, sah das, möchte das zugeben. Es wäre ja auch nur eine Option.
Das Menü ist geschafft! Maria trägt die Teller und Schälchen ab. Man tauscht die Ergebnisse der Speiseanalysen aus und prostet sich erneut zu. Ja, man stößt sogar mutig im Dunkeln mit den Gläsern quer über der Tischmitte an. Es klappt. Die Gläser klirren nur leise. Man ist stolz. Stolz, etwas Schwieriges gewagt und bestanden zu haben.
Das Sehen ist fast vergessen. Ebenso die Zeit. Und dann kommt der Moment, wo Maria sagt: „So, jetzt zieht die Polonaise wieder hinaus ins Licht.“
Erneute Anspannung. Die ersten beiden Hände suchen Marias Schultern. Niemand verlässt so gern den wunderbar sicheren Stuhl. Der letzte Gast von diesem Tisch verpasst den Anschluss und tapst locker in die Dunkelheit. Er greift ins Leere. Wo ist der eigene Stuhl, wo die gewohnte Tischkante? Bloß nicht an irgendeinen anderen Tisch stoßen. Finger tippen gegen einen fremden, speisenden Gast. Dem bleibt der Bissen vor Schreck im Hals stecken.
Maria ist stehen geblieben und zählt die Häupter ihrer Lieben. Ihre geschulte Hand zieht den verlorenen Blindgänger zu sich und die Polonaise ist wieder komplett. Im Gleichschritt schwankt die Gruppe los und mündet in der Schleuse. Die Tür zum finsteren Innenraum wird geschlossen. Alle sind bereit, durch die nächste Tür in die Welt des Lichts zu treten. Mit einem Schlag ist es taghell. Reflexartig schließen sich die Lider der gesättigten Gäste. Neugierige Augen linsen vorsichtig durch den zart gelösten Wimpernvorhang. Ja, sie ist noch da…, die Welt der Kontraste, Farben und Bilder. Die Welt der optischen Orientierung. Die Welt, in der das stolze Auge souverän auch jeden fremden Weg erkennt.
Keiner der Teilnehmer muss etwas sagen. Jeder erkennt in den Augen seines Gegenübers, in dessen Mimik und Gestik, was der andere nach diesem gemeinsamen Abenteuer denkt.
03 Die Dunkelheit als Heimspiel
Freunde hatten mich zusammen mit meiner Frau in das oben beschriebene Dunkelrestaurant eingeladen. In der Schleuse erklärte ich der blinden Mitarbeiterin Maria, dass ich ebenfalls blind sei. Sie forderte mich sofort begeistert auf, in diesem Restaurant mitzuarbeiten. Ich lehnte dankend ab, da ich sehend bereits so ‚umwerfend‘ war, dass ich kein Talent zum Kellnern aufweisen konnte. Also schloss ich mich der Polonaise in den Speiseraum an.
Während sich meine Frau und meine Freunde mit ihren verbliebenen vier Sinnen auf die Finsternis konzentrierten, änderte sich für mich nichts. Für mich war das ein reines Heimspiel. Mitarbeiterin Maria und ich praktizierten die Teller- und Gläserübergabe mit routinierter Lässigkeit. Essen und Trinken waren für mich ein Genuss. Die Freunde hatten hier schon einmal gespeist und ihre Anspannung hielt sich deshalb in Grenzen. Doch für meine Frau war die Situation neu und somit der reinste Stress. Sie fieberte dem Moment entgegen, an dem es wieder hinaus ins Licht gehen würde. Ihre Uhr lief quälend langsam, meine überraschend schnell.
Da wir gemeinsam den Raum betreten hatten und nun wieder gemeinsam verließen, bestätigte sich besonders im Dunkelrestaurant Albert Einsteins Theorie, dass die Zeit relativ ist.
Wir traten nach zweieinhalb Stunden ins Licht. Drei geliebte Menschen atmeten erleichtert auf. Sie hatten 150 Minuten völlige Dunkelheit ertragen. Dazu gehört Mut. Nach diesem Erlebnis haben sie mir aufrichtig gesagt, dass sie die Situation eines blinden Menschen nun mit mehr Verständnis betrachten könnten. Auch der Respekt gegenüber der eigenen Sehkraft sei deutlich gestiegen.
Anmerkung von Verlegerin Manuela Klumpjan: „Bei mir war es damals so, dass ich die ganze Zeit versucht habe, trotz der völligen Dunkelheit etwas zu sehen, das war sehr anstrengend. Auch unsere Tischgespräche waren viel ernster als sonst, weil wir uns in der Dunkelheit irgendwie freier gefühlt haben. Diese Erfahrung haben auch andere Sehende gemacht, mit denen ich später gesprochen habe.“
Fazit: Wer sich eine solche Erfahrung etwas kosten lässt, wird reicher nach Hause gehen.
04 Als Blinder eine Attraktion!
Seitdem meine Sehnervenzellen von dem hohen Augeninnendruck fast alle zerstört wurden, kann ich keine Lichtquellen direkt orten. Ich kann aber beim Licht ein- oder ausschalten einen diffusen Unterschied wahrnehmen. Trotzdem weiß ich beim Betreten eines Raumes nie, ob das Licht bereits an ist oder nicht. Der Sehende kann das nachvollziehen, wenn er zur abendlichen oder nächtlichen Stunde in einem beleuchteten Raum seine Augen schließt. Wenn er das Licht ein- oder ausschaltet, so wird er das durch die geschlossenen Lider unterschiedlich wahrnehmen.
Auch hier ist Klärungsbedarf. Wenn mich jemand fragt, ob ich hell oder dunkel unterscheiden kann, und ich das mit einem ‚Ja‘ beantworte, dann folgt sogleich die zweite Frage: „Also sehen Sie doch noch?“ Um dem Missverständnis und Unsinn vorzubeugen, antworte ich am liebsten: „Ne, ich sehe gar nix.“
Meine Dunkelheit misst sich nicht wie im Dunkelrestaurant in Stunden oder Tagen, sondern sie ist zu meiner Welt geworden. Sie ist eine Welt, in der nicht auf Zuruf der Service herbeieilt oder mich eine einfühlsame Maria samt ihrer Polonaise durch das Leben führt! Als Blinder bin ich für Sehende grundsätzlich eine Attraktion. Mein weißer Stock ist ein Stigma und deshalb wird sogleich alles still, wenn ich ein Restaurant betrete. Während im Dunkelrestaurant niemand darauf achtet, in welcher Manier der einzelne Gast zu speisen pflegt, muss gerade ich als Blinder im Restaurant der Sehenden besonders auf meine Etikette achten. Alle Augen sind auf mich gerichtet. Nicht nur das. Selbst aus dem engsten Freundeskreis kommt oft die Belobigung: „Du hast ja gar nicht über den Teller geschlabbert. Und der Teller ist sogar völlig leer.“
Ist das nicht sonderbar? Muss ich als Blinder stolz auf gute Tischmanieren sein? Ja, bin ich! Knigge hat seine Empfehlungen schließlich in erster Linie für Sehende geschrieben …
Mein Geheimnis, die Grenzen des eigenen Tellers nicht zu überschreiten, liegt darin, dass ich mit Gabelzinken und Messerspitze sehe. Das ist kein Witz. Es fiel mir erst nach einigen Jahren Dunkelheit auf, dass mein Gehirn alle ertasteten Dinge sofort in Bilder umsetzt. Wenn ich im Restaurant auf einem Stuhl sitze und per Zufall mit der Fingerkuppe unter die Sitzfläche taste, dann weiß ich sofort, ob Kreuz- oder Schlitzschrauben verwendet wurden. Leider auch, wie viele Kaugummis dort ihr Ende fanden. Gerade diese Tastbilder würde ich mir gerne ersparen, da die sehenden Verursacher mir damit den Appetit verderben. Etikette und Stil haben nichts mit einer Behinderung zu tun, das ist eine Frage der Haltung und des eigenen Anspruchs.
Vielleicht sollte ich als Blinder auch nicht so genau hinschauen …