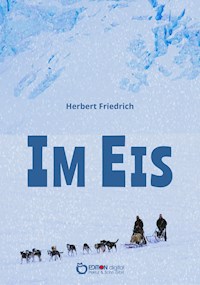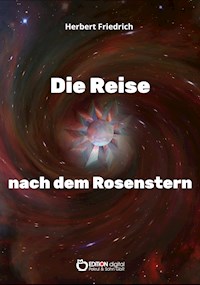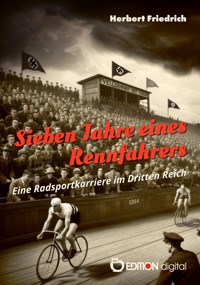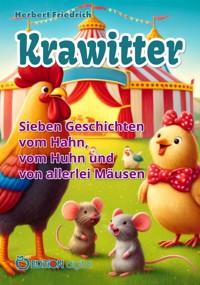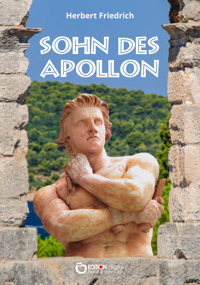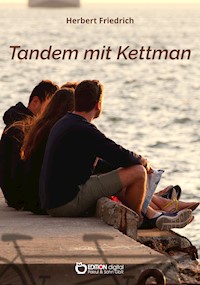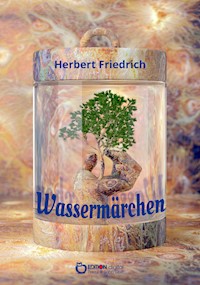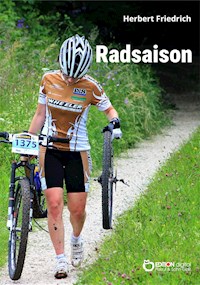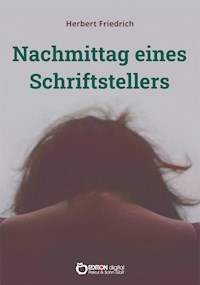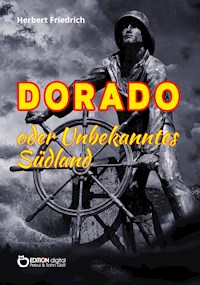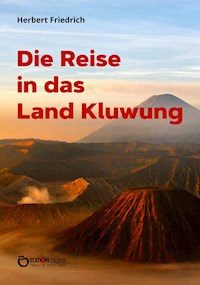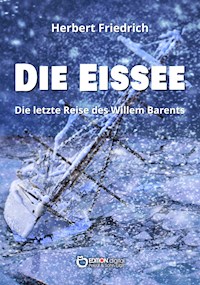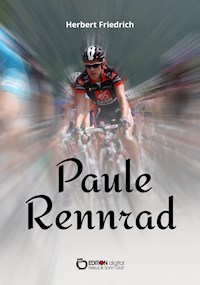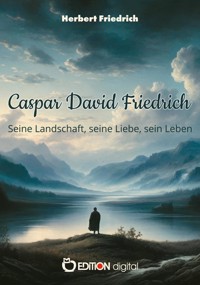
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Caspar David Friedrich, der Mann mit den drei Königsnamen, war gleichsam ein König unter den Malern, einer, der sich ein eigenes Kunstreich geschaffen hat, »in dem er, unumschränkt waltet und herrscht«. Schon zeitig fing der Lichtgießersohn aus Greifswald zu zeichnen an, studierte in Kopenhagen, bis er sie malte, »die unendlich leisen Töne und Übergänge der Luft und der Ferne«. Zuerst in Sepia, später in Öl. Und immer wieder Hünengräber, die Ruine von Eldena und Neubrandenburger Eichen, Gebirge, wallende Nebel, der Mond über dem Meer und der Mensch als Rückenfigur, ein Teil der Natur. Herbert Friedrich, der in Dresden lebende Schriftsteller, ist feinfühlig den Lebensspuren dieses großen Malers der Romantik nachgegangen und hat dabei manches Neue entdeckt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Herbert Friedrich
Caspar David Friedrich
Seine Landschaft, seine Liebe, sein Leben
Biografie
ISBN 978-3-68912-022-1 (E-Book)
Das Buch erschien 2018 bei MAXIME Verlag Maxi Kutschera.
Covergestaltung: Ernst Franta mit einem von der KI erstellten Bild.
Fotos: SLUB/Deutsche Fotothek, Herbert Friedrich
Die Zahlen vor dem Schrägstrich beziehen sich jeweils auf die Quelle (vgl. dazu das Literaturverzeichnis), die dahinterstehenden geben die Seiten an.
2024 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
Weiß Gott, mir ist’s immer fatal, wenn ich an irgendeinen Freund denke, mir nicht seine nächste Umgebung hinzudenken zu können.
Carl Gustav Carus in einem Brief an Regis vom 29. Januar 1815
Ich meinesteils fordere von einem Kunstwerk
Erhebung des Geistes und
– wenn auch nicht allein und ausschließlich – religiösen Aufschwung.
Caspar David Friedrich
Es liegt eine unendliche Kindlichkeit, zugleich aber etwas von jenem untrüglichen Ernst des Kinderauges in seinen Bildern … Vielleicht ist jedoch das Betonen des religiösen Elements den Bildern mehr … angedichtet, als aus ihnen herausgeschaut.
Anonymus 1858 anlässlich einer Ausstellung in München
I. DAS HAUS AN DER ELBE
Caspar hieß einer der drei Könige, jener Weisen, die aus dem Morgenlande gezogen kamen, um dem gerade geborenen Jesuskind ihre Ehrfurcht zu bezeigen. David war der zweite König von Israel, der sich vormals, kaum dem Knabenalter entwachsen, in den Feldzügen Sauls mit keckem Mut hervorgetan und den feindlichen Recken Goliath erschlagen hatte. Friedrich schließlich nannten sich durch die Jahrhunderte hindurch Dutzende von Fürsten. So trug Caspar David Friedrich drei Königsnamen und konnte wohl selber ein König genannt werden, ein König unter den Malern.
Die Stadt, die er sich zwischen Meer und Gebirge, zwischen Ostsee und Alpen, zur Heimat erkoren hatte, war das unvergleichliche Dresden. Die Straße, in der er dort fünfunddreißig Jahre lang wohnte, lag an der Elbe und wurde so genannt. Das Wasser schob sich an seinen Atelierfenstern vorbei, Nebel quoll daraus hervor, Schollen stießen sich krachend, über festes Eis liefen die Leute von einem Ufer zum anderen.
Fischerkähne trieben in Sommersonne. Hochfluten schwemmten die Keller voll. Bis zu seinem Fenster stiegen Schiffsmasten empor. Jahrzehnt um Jahrzehnt. Der Geruch von Fisch, Holz und Wasser war hier ständig um ihn. Wenn er an der Staffelei saß, vernahm er die Arbeitslieder der Schiffszieher und die Rufe der Männer, die schwere Fichtenstämme aus Kähnen wuchteten.
Diesen Strom malte er, das Elbschiff im Frühnebel, die zerfaserte Flusswindung vor dem Großen Gehege, die Brücke, die die Altstadt mit der Neustadt verband, ja auch des Stromes Quelle im Riesengebirge. Es scheint, als hätte er gerade jene Dresdner Gegend mit dem Treiben am Wasser zu seinem Wohnsitz gewählt, weil ihn all das an die heimatliche Hafenstadt Greifswald erinnerte. In dieser Straße wohnten Korbmacher, Platzbäcker, Seiler und Zeugschmiede, kleine Handwerker also, vor allem aber Leute, die von der Elbe lebten. Und die Straße verlor sich stromauf schon bald in der Landschaft zwischen den Wiesen, einen Gondelschuppen gab es noch, eine Ziegelei und weiter weg ein Holzwachthaus und die Wiesenvogtei und über dem Strom die Weinberge bis hin zum fernen Dorfe Loschwitz. Wer in dieser Straße logierte, war nicht von Stadtmauern umgeben.
Zunächst wohnte er mehr dem Elbberge zu, möglicherweise in dem Eckhaus, wo die Elbgasse mündete, in der Nummer 26 jedenfalls; in welchem Stockwerk, wie lagen die Räume? Soviel er gezeichnet hat, eine Skizze davon hat er nicht hinterlassen.
Eine bescheidene Wohnung war dies gewiss, schlicht wie sein Bewohner, das Malzeug, die Werkstatt, das Bett zum Schlafen, vielleicht etwas Küche und Abstellraum. Dreizehn Jahre hauste er hier allein, dann heiratete er und nahm seine Frau zu sich. Als das erste Kind geboren wurde, erdrückte die Enge alles.
Besucher waren immer gekommen, um die neuartigen Bilder dieses „gemüthvollen Dichters des Natur- und Menschenlebens“ (2/82) zu sehen. Prinzen aus Preußen, Dänemark und Russland waren die Treppen zu seinem kargen Atelier hinaufgestiegen. Philosophen kamen und Poeten, Johanna Schopenhauer, Schleiermacher, der Baron de la Motte, der die Nibelungensage dramatisiert und die „Undine“ geschrieben hatte. Der Maler Peter von Cornelius. Und Goethe. Wen die Kunst Dresdens anlockte, der flanierte nicht nur durch Galerie, Grünes Gewölbe und Antikensaal, der ging auch zu Friedrich. Auch in der neuen Wohnung ein paar Schritte hin blieben die Besucher nicht aus. Hier bezog er eine ganze Etage. Platz war gefragt, denn zwei Kinder wurden ihm noch geboren. Jetzt hatte er sechs Fenster, die auf den Elbstrom hinausgingen.
Das jedoch, was er im fremden Sachsen nicht an Heimat haben konnte, holte er sich auf die Staffelei: Greifswald im Mondschein, Rügenlandschaft mit Regenbogen, Hünengrab im Schnee. Aber er malte hier auch das Hochgebirge und das vom Eis zermalmte Schiff vor Grönlands Küste; Gegenden, die er nie gesehen hatte.
Friedhöfe, Grabmale alter Helden, Gartenterrasse und der verlorene Reiter im Winterwald – jegliches seiner Bilder entstand in dieser Straße, Gemälde um Gemälde, mehr als dreihundert an der Zahl. Sein erstes wie auch sein letztes. Was heute in Berlin, Wien, Sankt Petersburg hängt, in besten Galerien der Welt, nahm von hier seinen Weg.
Die Bomben vom 13. Februar 1945 rasierten auch diese Häuserzeile am Wasser weg. Ein fester Bezugspunkt, der seit Friedrichs Zeit hier in Elbnähe unverrückt stehenblieb, ist die Ecke der Jungfernbastei vom Rest Dresdner Festung, welcher Brühlsche Terrasse genannt wird. Von hier, vom Monument des Kurfürsten Moritz, aus, sind es nach dem „Grundriss der Haupt und Residenz Stadt Dresden nebst den Vorstädten“, den Hessler senior 1837 zeichnete und junior 1849 ergänzte, dreihundertfünfundzwanzig Dresdner Ellen bis zu dem einen und vierhundertfünfzig bis zu dem späteren Friedrich-Haus.
Nun kann man das in Meter umrechnen, wenn man herausfindet, wie groß die Dresdner Elle seinerzeit gewesen ist. Einfacher wäre es, Schritte zu zählen. Nach genanntem Plan ist es von der Einmündung des „Elbberges“ in unsere Straße bis zu jener des Elbgässchens ebenso weit wie vom Elbgässchen bis zu Friedrichs zweitem Wohnsitz.
Also starte man. Über die Mündung des Gondelhafens, den es nicht mehr gibt, ginge unser Elbelauf unter der Brücke hindurch, die es damals nicht gab, wohingegen ebenjener „Elbberg“ auf den Strom stieß.
Nun gelangte man schon an die ersten Häuser der Straße An der Elbe. Das Venetianische Haus – Ruine beseitigt – wurde erst zehn Jahre nach Friedrichs Tod gebaut, daneben stand die Elbaufsicht. Und nun, jenseits des Elbgässchens (etwa die jetzige Steinstraßenmündung), das erste Wohnhaus Friedrichs, fünfzehn Jahre seines Lebens, Arbeit und früher Ruhm, Kriegszeit und Hochzeit. Man folge immer noch, Ellen oder Schritte zählend, der Straßenflucht und käme nun am barocken „Schwarzen Bären“ vorbei, dessen Schlussstein über dem Tor der Maler oft angesehen haben mag: ein Bär mit einer Kanne. Drei Häuser weiter stünde man vor der Nummer 33, einem sechsgeschossigen Haus, dessen oberste Wohnungen Mansarden waren. Das wäre Friedrichs zweites Wohnhaus, noch einmal fünfzehn Jahre Arbeit, das Heranwachsen der Kinder, Reisen von hier aus, neue Freunde wie der norwegische Landschaftsmaler Johan Christian Dahl, der mit in dieses Haus zog. Und endlich fünf unsäglich lange Jahre Krankheit. Bis der Tod kam.
So könnte man spazieren von der glücklicherweise festen Ecke der Brühlschen Terrasse, immer dem Strom entgegen, und würde den ganzen Weg über kein einziges jener Häuser mehr erblicken. Und stünde am Ziel vor einer kleinen Wiese, wo bis 2005 ein schmuckloser Zwölfgeschosser stand, dessen Zwilling landein versetzt ist. An dieses kleine Grasland grenzt, eingezäunt, eine Schule, die in den 1960er Jahren auf der enttrümmerten Fläche entstand. In entsprechenden Ämtern wird zu finden sein, wie sich die damalige Bebauung erstreckte. Mit Sicherheit wird der Grundriss von Friedrichs Wohnhaus nicht dem der jetzigen Schule entsprechen. Die längst ausgebaute Straße führt den Großstadtverkehr an der Elbe entlang an Dresdens Zentrum vorbei. Dort auf die Brühlsche Terrasse aber, von der wir Schritte oder Ellen zählend gestartet sind, ist auch Caspar David Friedrich gelangt. Aus Edelstahl steht da seine Staffelei, der Stuhl davor und das Fenster dabei, das auf den Strom hinausging. Ein Denkmal, eingeweiht an seinem 150. Todestag. Spät hat sich die Stadt ihres Malers besonnen.
Nichts aber erinnert mehr daran, wo der Maler die vielen Jahre gewohnt und gearbeitet hat und wo er gestorben ist. Eine Gedenktafel an seinem Hause gab es erst 1940. Fünf Jahre später ging es im Feuersturm unter. Die Schule an dieser Stelle wurde zunächst nach Käthe Kollwitz benannt; später trug sie weitere Namen. Jahrzehnte sind Kinder hier ein- und ausgegangen, was wissen sie von der Bedeutung dieses Ortes. Ein Täfelchen an dieser Schule – mit den Namen Friedrich und Dahl – ehe sie hier ganz vergessen sind: Diese Hoffnung bleibt.
II. DAS LICHTGIESSERHAUS
Und dann das andere Haus, in dem Caspar David Friedrich am 5. September 1774 geboren wurde, zur damaligen Zeit einige Tagereisen von Dresden entfernt, im Norden, im Lande Po Morje, am Meere also, in Neu-Vorpommern, das seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges unter schwedischer Herrschaft stand. Sein Vater war der Lichtgießer und Seifensieder Adolph Gottlieb Friderich.
Wer Lichte gießen, wer Seifen sieden wollte, der brauchte Feuer. Und so loderten unentwegt unter den Kochern die Flammen in dem schmalen Haus, dem sich andere dann anfügten. Nur die Turmgasse trennte es vom linken Nachbarn. Hier wurden über Jahre und Jahrzehnte Lichte gegossen, die Winter waren lang, die Fenster klein. Sohn und wieder Sohn der Familie Friedrich betrieb dieses Handwerk, über die Herrschaft Napoleons hinaus, mit der auch die Schwedenherrschaft endete. Und die Preußen kamen, und Dampfwagen fuhren auf Eisenbahnen, und immer noch kochte man in diesem Hause in der Greifswalder Langen Straße Talg und Seifen und ähnliche Produkte und verkaufte alles im angrenzenden Laden. Beim Schein der Petroleumlampe schließlich. Und endlich in elektrischem Licht.
Am 9. Oktober 1901, am hellen Tage fraß das so lange gezähmte Feuer das gesamte Haus. Das „Greifwalder Tageblatt“ berichtet über das Unglück: „In einem Raum, der an das abgebrannte Gebäude stieß und nach dem Hof führte, waren ein Gehilfe und ein Lehrling mit dem Kochen von Bohnerwachs beschäftigt. Ein Luftzug, durch das Öffnen der Hoftür hervorgerufen, trieb die Flamme aus dem Gasbehälter heraus, welche seitwärts schlug und einem in unmittelbarer Nähe stehenden Benzinbehälter zu nahe kam. Das Benzin explodierte und setzte die nähere Umgebung in Brand. Die Flamme schlängelte sich nun an dem in der Nähe befindlichen Treppengeländer empor … Das ganze Gebäude mit Ausnahme eines Teiles des Ladens ist ausgebrannt …“ (15/199)
Das Feuer hatte prächtige Nahrung gefunden. Viele trockene Balken steckten in diesem alten Bau. Der Dachstuhl stürzte zusammen, das Fachwerk verkohlte, die Flammen verschlangen Hausrat und Werkzeug und Kleider. Die vom Stammvater sorgsam gehütete Familienbibel mit den freudvollen und leidvollen Eintragungen von seiner Hand, wann ihm ein Kind geboren und genommen worden war und vom schlimmen 7. März 1781, als ihm die Ehefrau, die Mutter seiner Kinder, starb – alles nun Asche. Es verbrannten vor allem einzigartige Erinnerungsstücke an Caspar David, die im Besitz der Familie gewesen waren. Einmalige Bilder von ihm gingen in Flammen auf. Vernichtet wurde das bedeutendste seiner Selbstbildnisse, das einzige in Öl, von dem nicht einmal eine Abbildung oder ein Foto existiert, wie Rauch verweht in der Luft. Mit zwanzig Jahren hatte Caspar David Friedrich für immer Vaterhaus und -land verlassen. Aber in diesem Bild war er in der Greifswalder Wohnstube seinen Geschwistern gegenwärtig gewesen. Als junger Mann saß er am Tische, den Kopf in die Hand gestützt, und nahm den Betrachter mit dem „ungewöhnlich strahlenden Glanz der beseelten Augen“ (45/37) gefangen. Ein Meisterwerk seiner Spätzeit, die „Klosterruine Eldena im Riesengebirge“, trug schwere Schäden davon, konnte aber geborgen und wiederhergestellt werden. Dieses Feuer in der Langen Straße zu Greifswald war wie der Auftakt eines großen Brennens, einer kolossalen Vernichtung von Friedrich-Bildern. Dreißig Jahre später verbrannten im Münchner Glaspalast alle seine dort gezeigten Gemälde, der zweite Weltkrieg fraß weitere, „Klosterfriedhof im Schnee“ verbrannte im Flakbunker Zoo in Berlin …
Mit dem Rest Laden, der da 1901 stehengeblieben war, konnte der Besitzer nicht mehr viel anfangen. Er ließ die Brandstätte bereinigen und später auf den Grundmauern ein neues Haus errichten.
Herbst 1987 auf Friedrichs Wegen in Greifswald: Wer will, kann dort Seife und Lichte kaufen wie eh und je. Das Haus beherbergt eine Drogerie. An der Hauswand erinnert eine Inschrift: „An dieser Stelle stand das Geburtshaus des Malers Caspar David Friedrich …“ Geburts- und Sterbedaten dazu. Die Turmgasse links, durch die sich damals kaum ein Mann zwängen konnte, ist nach dem Abriss des Nachbarhauses breiter geworden. Rechts neben der Drogerie folgen zwei Häuser bis zum Einschnitt der Nikolaistraße, die seit 1924 den Namen des Malers trägt.
Die Namen Turmgasse und Nikolaistraße weisen auf das Bauwerk hin, das hinter Friedrichs Geburtshaus alles andere überragt: die gotische Kirche St. Nikolai. Mit den dort verbauten Ziegelmassen hätte man alle Häuser der Langen Straße aufführen können. Den Turm mit dem Barockhelm von 1625 kennen wir von den „Wiesen bei Greifswald“ und von manch anderem Friedrich-Bild. Wenn er ihn gemalt hatte, dann schwang in ihm mit, dass gerade an diesem Punkt seine unmittelbare Heimat sei: Wie ein Pfeil aus dem Himmel heraus wies der Turm unmittelbar auf sein Geburtshaus.
Viel Zeit bedarf es nicht, das Häusergeviert zu umrunden. Kurz ist die Caspar-David-Friedrich-Straße. „An der Nikolaikirche“ kann man abbiegen, wo einstens der Friedhof lag und vielleicht auch Friedrichs Mutter bestattet worden war, und hat jetzt die Hintergebäude der Langen-Straße-Häuser vor Augen. Die auf den rötlichen Backstein gemalten Schriften haben Jahrzehnte überdauert. „G. H. C. Colltrepp …“ lautet die eine, mit dem Hinweis: „Eingang zur Delicatessenhandlung Langestraße 27“. Hier An der Nikolaikirche wurden die Schätze des Meeres und der Tropen nur angeliefert, nicht aber verkauft.
Von „Delicatesse“ ist die Schrift im rechten Abschnitt der Mauer: „Gust. Ad. Friderich. Fernsprecher 310“. Was einen vor der Erinnerungstafel nicht angerührt hatte, jetzt wird es lebendig durch das unvermittelte, nie erwartete Zeugnis. Gustav Adolf Friderich – war er es, dem das Unheil widerfuhr, dass ihm das Haus abbrannte? Das Hintergebäude blieb verschont …
Auch das erstaunt: Als dieser Mann auf die Welt kam, lebte noch glückliche Erinnerung an die Schwedenjahre unter den Friderichs; er ist in der Familie nicht der erste mit diesem Namen, vielleicht aber der letzte.
Im Museum findet man den Namen wieder, spiegelverkehrt diesmal, weil in Seifenformen gepresst. Tausend und aber tausend Stück Seife werden den Namen Friderich durch die Lande getragen haben, mit exotischen Reliefs geschmückt – Mohr und Palmen –, die sich, Duft verbreitend, langsam zwischen den Händen wegwuschen.
Irgendwann auf dem langen Weg durch die Zeit, über einhundertfünfunddreißig Jahre Seifensiederei von Adolph Gottlieb zum Gustav Adolf, hatte sich die Schreibweise des Namens wieder gewandelt zum Anfang hin, in jene Form, wie die einzige erhaltene Notiz über den ältesten bekannten Vorfahren des Malers Friedrich, den Großvater, geschrieben worden war: „Gottfried Friderich, gestorben am 14. 11. 1748 in Neubrandenburg“. Von diesem Manne weiß man weder Geburtsjahr noch Beruf, wohl aber, dass er neun Kinder gehabt hat. Einer seiner Söhne wurde Caspar Davids Vater.
Da der Maler in Dresden zwar alle möglichen Schreibweisen seines Namens bei Unterschriftsleistungen angewandt, vorrangig aber mit „Friderich“ unterzeichnet hat, liegt der Schluss nahe, dass Amtsstuben, Kunstrezensenten und Ausstellungskataloge seinen Namen in die gebräuchliche Schreibweise gebracht haben. Das, was an der Mauer des Hintergebäudes in Greifswald geschrieben steht und in Seifen gepresst wurde, ist die ursprüngliche Form.
Die Feuerwehr zu Greifswald jedenfalls hatte in jenem Oktober 1901 einiges geleistet, indem sie bei der engen Bebauung das Übergreifen des Brandes auf die Nachbarhäuser verhindert und auch das Hintergebäude gerettet hatte. Freilich stammt es, so wie es heute dasteht und das große Brennen überstanden hat, nicht aus Caspar Davids Zeit, geschweige denn aus seiner Kindheit. Wahrscheinlich wurde es an der Stelle früherer Gebäude Ende des 19. Jahrhunderts gebaut, was Greifswalder Akten aufklären könnten. Die Seitenfront nach der Turmgasse zeigt sparsame Verzierungen, spitzgestellte Formziegel über den Fenstern und einen kleinen Kopf aus Stein. Vor allem wird an dieser Stelle deutlich erkennbar, wo das neue Haus an dem alten, vom Brand verschonten Bau ansetzt.
Das ist das Grundstück, das der Neubrandenburger Adolph Gottlieb Friderich anno 1765, zwei Jahre nach seinem Zuzug nach Greifswald, von den Erben des verstorbenen Bauschreibers Wendt kaufte. Es war das Jahr seiner Heirat mit der ebenfalls aus „Neu-Brandenburg“ stammenden Sophie Dorothea Bechly, der achtzehnjährigen Tochter eines Zeugschmieds. Kein Wunder, dass er der jungen Familie eine eigene Bleibe schaffen wollte, wo er auch seine Lichte nicht mehr mühsam in einer gemieteten Werkstatt produzieren musste. Dieses Haus lag an der Hauptstraße der Stadt, da galt es zuzugreifen und Mitbewerber aus dem Felde zu schlagen. Also bot er einhundert Reichstaler mehr als den Schätzpreis des Hauses, nämlich achthundert, davon wollte er die Hälfte in bar entrichten, das andere aber als Hypothek auf das Grundstück nehmen. Mit fünf Prozent Zinsen. Außerdem bot er an, dem jüngsten Sohn des verstorbenen Besitzers eine kleine Stube kostenlos zu überlassen, solange jener studiere.
Das war den Vormündern der Bauschreiberkinder wie auch dem Rat der Stadt angenehm. Und so sprach man Friderich-Vater das Haus ohne Versteigerung zu. Es befand sich „im mittelmäßigen Stande“ und war „durchgängig im Fachwerk gebaut und straßenwärts mit einer massiven Wand, so nur einen halben Stein breit, geblendet“. (15/197) Das Hintergebäude zum Nilolaikirchhof hin war in schlechterem Zustand. Auch die Hofeinfriedungen zur Turmgasse und zum Nachbarn mussten instand gesetzt werden. Also hatte der Neubrandenburger Lichtgießer Friderich, der kaum zwei Jahre das hiesige Bürgerrecht besaß, wiederum tief ins Säckel zu greifen. Es ist erstaunlich, wie der Fünfunddreißigjährige diese Summe aufgebracht hat.
Allerdings war der Kauf jenes Grundstücks nicht die letzte Schlacht, die Friderich zu bestehen hatte. Die Vorsteher der Nikolaikirche erhoben Einspruch beim Rate, während bereits emsig jenseits ihres Friedhofes Taler um Taler verbaut wurde. Sie sahen Feuersgefahr für die Kirche und fürchteten lästigen Geruch und andere Nachteile aus dieser Nachbarschaft. Adolph Gottlieb jedoch baute und gewann, und schon nach zwei Monaten, im Dezember 1765, konnten die Kämmerer Vernow und der Zimmermeister Rühs feststellen, dass alle Reparaturen vollbracht und die feuerpolizeilichen Bedingungen eingehalten worden waren. Im Sommer darauf wurde ihm das erste seiner schließlich zehn Kinder geboren.
Vater Friderich verstand nicht nur sein Handwerk, sondern auch, sich durchzusetzen. Schon mit seiner Übersiedlung nach Greifswald hatte er Spürsinn für das bewiesen, was gebraucht wurde. In ganz Schwedisch-Vorpommern existierten nur noch in Stralsund ein Kerzengießer und ein Seifensieder. Kein derartiges Handwerk gab es in Grimmen, Richtenberg, Franzburg, Wolgast. Ein Herr Gadebusch schrieb in seiner „Schwedisch-Pommerschen Staatskunde“ von 1786: „Die Licht- und Kerzengiessereyen reichen bis jetzt Bei weitem nicht hin, die Bedürfnisse des Landes hierinn zu bestreiten, daher sowohl Tallig- als weisse Wachslichter eingeführt werden.“ (15/199) im Jahre 1780 waren das für 3418 Reichstaler Lichte und für 8049 Reichstaler Seife! Und da saß nun Adolph Gottlieb Friderich an der Hauptstraße von Greifswald und brauchte um seinen Absatz nicht zu bangen. Listig und selbstbewusst hatte er sich als „Neu-Brandenburger“, als Mecklenburger in der schwedischen Stadt niedergelassen. In einem gemieteten Raum hatte er sein Zeug fabriziert und sich mit den Haken gehakelt, mit den Kleinhändlern also, weil er nicht nur, wie er sich bei der Einbürgerung verpflichtet hatte, den Großhandel kastenweise belieferte, sondern seine Kerzen auch pfund- und stückweise losschlug. Ja, er hatte „sich dann auch angemaßet, ein Zeichen dieses Lichthandels öffentlich vor der Tür seines Wirtes anzuhängen“ (15/197) Kaufmannsreklame, die ihm nie zustand! Friderich ließ nicht locker, bis es ihm gestattet wurde, die von ihm hergestellten Lichte in jeder beliebigen Menge zu verkaufen. Es war jene Zielstrebigkeit, wie er sie später beim Hauskauf bewies. Und kaum dass er sich in der Langen Straße eingerichtet hatte, kam er dem Magistrat mit einem neuen Wunsch: Im Hintergebäude seines Grundstücks wolle er eine Seifensiederei einrichten. In Stralsund, wo die Regierung Schwedisch-Vorpommerns saß, die gerade seinen Streit mit den Haken, mit den Häkern, den Hökern zu seinen Gunsten entschieden hatte, lagen beide Handwerke bei verschiedenen Meistern. Friderich dagegen strebte für Greifswald an, Lichte und Seife in einer, in seiner Werkstatt zu verfertigen.
Bei dem bisherigen Importartikel Seife war der Rat sehr wohl ansprechbar, ja, man fühlte vor, ob der Antragsteller außer weißer auch grüne Seife herzustellen imstande sei. Für Friderich kein Problem. Mehr Umstände bereiteten dagegen die vorhandenen Baulichkeiten. Da tauchten wiederum Kämmerer im Grundstück auf und ließen sich an Ort und Stelle erklären, wie sich dieser Friderich die grün-weiße Seifenproduktion dächte. Sie maßen mit Augen und Zollstock, prüften die Mauern. Ein weiterer Feuerbrand sollte in diesem Hause entfacht werden, der unter Kontrolle bleiben musste. Das wollte wohlbedacht sein. Der Tischler Pahlmann wurde gehört, ob er als Nachbar sein Holz sicher glaube. Dem Glaser Guhser, dem anderen Nachbarn, konnte die Bude abbrennen. Vielleicht wurden auch wieder die Herren von der Nikolaikirche befragt, doppeltes Feuer, doppelte Gefahr oder wenigstens Brandgeruch in der Luft, Talgdunst, Wabereien aus Seifenkesseln, all das mit dem Windhauch auf das Gotteshaus zu, in das Grün der Bäume, in das Weiß des Schnees. Sehr erbaut werden die Provisoren von St. Nikolai nicht gewesen sein. Aber die schnell überzeugten Kämmerer ordneten an (während die junge Frau Friderich das erste Mal schwanger war): „Dieses Haus ist nach dem Kirchhof zu unten mit einer massiven Mauer zu versehen … Nach dem Berichte … soll der Kessel, worinnen die Seife gesotten wird, in der Mitte dieses Gebäudes drei Ellen tief in die Erde eingesetzt und mit Mauersteinen, so in Kitte zu legen, befestigt werden.“ (15/198) So zogen denn wieder Maurer in den kleinen Hof ein, während im Haus natürlich weiterhin Talg und Wachs geschmolzen wurden. Und der Mai kam, und die Brandmauer wuchs, und ein Gewölbe schloss sich über dem Kessel, und die Erstgeborene Catharina Dorothea kam zur Welt, und ein Schornstein wuchs über dem Kessel massiv aus dem Dach hinaus, bei gutem Sommerwetter. Und als der Herbst kam, konnte unter dem Kessel das Feuern beginnen.
In diesen Brandmauern und dem feuerfesten Schornstein und Kessel steckten natürlich wiederum allerhand Taler, Ausgabe von Hunderten und Hunderten in kurzer Zeit … Das musste erkocht und ersotten werden. Die Feuer gingen nicht aus, da in der Langen Straße. Zwei „Werkmeister“ wachten „bei ihrem Eide“ über die Feuer, schürten und gossen die erschmolzenen Flüssigkeiten in Formen, während nicht nur Kerze für Kerze über den Ladentisch ging, sondern Friderich jene Artikel auch kastenweise in sein „Cabriolet“ hievte und über die Dörfer bis hin zur Grenze fuhr, damit die Geldstücke wieder in die Kasse wanderten. Am liebsten wäre es ihm gewesen, wenn er in der Stadt das Alleinrecht für die Lichtgießerei gehabt hätte. Aber da stellte plötzlich ein Major von Bülow seine Leute zum Wachsschmelzen an, auf der Wachsbleiche. Und da gab es einen Kaufmann, dem jenes Geschäft ebenfalls wohlgefiel. Da hatte Friderich gegen den Major vorzugehen wie auch gegen den Kaufmann Linde und viel später noch gegen die Gewürzkrämerkompanie, die sich ebenfalls anmaßte, Lichte in kleinen Mengen zu verhökern. Solche Streitigkeiten zogen sich über einen Zeitraum von fünfundzwanzig Jahren hin, an dessen Ende der kommende Maler Caspar David längst an der Akademie in Kopenhagen studierte. Mit immer wachem Auge hielt Vater Friderich das Seine zusammen.
Und nun kamen in diesem Handwerkerhaus in der Langen Straße auch die Kinder zur Welt, in kürzestmöglichem Abstand, nach Catharina die kleine Maria, dann Adolf, dann Johann David, der nur zweiundzwanzig Tage lebte, dann Johann Samuel.
Und schließlich Caspar David, das sechste Kind nach noch nicht zehnjähriger Ehe.
Nun setzte die Entdeckung der Welt ein, der Himmel der Wiege, die kleine Stube mit dem Ofen. Im Erdgeschoss unten wurden auf der einen Seite des Ganges Lichte, auf der anderen Suppe und allerlei Nahrhaftes gekocht, die Dämpfe jeweils aufgefangen von mächtigen Kaminhauben. Genug stieg noch die Treppe empor, zu dem, der da noch in der Wiege lag; zwei Mädchen schauten hinein, acht und sechs Jahre alt, ein Vierjähriger stand dabei. Und der Kleinste konnte noch nicht einmal laufen, jener Johann Samuel, mit dem sich Caspar David in den Namen des verstorbenen Bruders teilte: drei Wochen Erdenleben des Johann David in den Namen der nachgeborenen Brüder verlängert.
Den Platz in der Wiege musste er beizeiten räumen, jetzt konnte er seinerseits von Mutters Arm hinunterschauen, wo Johann Christoffer schrie. Als Heinrich zur Welt kam, rutschte er schon über die knarrenden Treppen und kannte dann auch den ausgebauten Dachboden und den kleinen Hof und die Kirchhofmauer und den Turm von St. Nikolai. Dort hatte ihn Diakon Brockmann über das Taufbecken gehalten, „des Lichtgießers Friedrichs ehel. Sohn Caspar David“ (25/9); von dort vernahm er Glocken und Gesänge, bis er an den Händen der Schwestern selbst in die Kirchenhalle gelangte. Zu Hause las der Vater beim Schein von Friderich-Kerzen von den drei Weisen aus dem Morgenland und von Saul und David.
Später stob er mit den Brüdern durch die Hunnenstraße gegenüber und zum Hafen. Bald wusste er, wo die Schuhmacher und die Schmiede wohnten, und trieb sich am Markttag zwischen den Ständen umher, während nun ein Christian in der Wiege lag und ein Jahr nach jenem die kleine Elisabeth. Nun waren sie sechs Jungen und drei Mädchen, die Kammern voll, eng war der Platz am Tisch, ein, zwei Fremde saßen auch immer mit da, Gehilfen des Vaters, eine Frau, die der Mutter zur Hand ging. Immer hatte die Mutter ein Kleines auf dem Schoß und eines an der Hand und eines im Leib.
Sophie Dorothea geborene Bechly, achtes Kind eines Zeugschmieds, nun hatte sie selber zehn geboren, hatte, solange sie in diesem Haus in der Langen Straße lebte, in ununterbrochener Folge Kinder ausgetragen und gestillt. Und nun an einem Märztag des Jahres 1781 ging sie für immer davon.
Da war ein Licht erloschen im Lichtgießerhaus. Mehr als das: Wie die Sonne war es gewesen und hatte gewärmt und Helle gespendet und Märchen und Lieder und Fröhlichkeit. Vielleicht war sie bei ihrem Tode wiederum schwanger gewesen. Sie starb mit vierunddreißig Jahren; ihr jüngstes Kind, Elisabeth, war da auf den Tag genau neun Monate alt und Caspar David sieben Jahre.
Mit dem Hinscheiden der Mutter änderte sich im Friderich-Haus alles. Eine Haushälterin, die Mutter Heiden, besorgte die Wirtschaft. Der Vater blieb Witwer bis zu seinem Ende. Und wie erst diesem Hause Leben um Leben zugeführt worden war, so eröffnete der Fortgang der Mutter den Reigen des Todes. Das jüngste Kind folgte ihr kaum ein Jahr später; es starb, wie im Kirchenbuch zu lesen steht, an den Blattern.
Jetzt bekam jenes Gärtchen hinter der angrenzenden Mauer für Caspar David Bedeutung; dort war nun nicht mehr nur das Gotteshaus, sondern auch die Wohnung von Mutter und der kleinen Schwester. Fremd war er nicht zwischen diesen Steinen und Holzkreuzen, genauso wenig wie in der Stadt, die er mit den Brüdern durchstreifte. Im Hafen lagen Schiffe mit leeren Rahen und solche, die Segel setzten, um nach Schweden aufzubrechen. Fässer wurden über Bohlen in Laderäume gekarrt. Männer ruderten in Booten, stiegen in die Wanten oder hingen an Schiffsleibern und strichen Teer, während Möwen nach Fischen stießen. Das Wasser, der Ryckfluß, verlor sich zwischen Wiesen in der Ferne, und jenseits davon lagen das Rosenthal und die Kuhlenweide. Diesseits, hinter Stadtmauer und Graben freilich, streckten sich die Schlachterwiese und die Neuen Morgen und die nummerierten Schläge und das Ellerholz. Über die Wiesen hinweg sah man die Silhouette der Stadt, die von den mächtigen Kirchen Nikolai, Jacobi und Marien bestimmt wurde.
Zu Hause warteten natürlich Pflichten auf den Jungen, die sich mit den Jahren änderten. Vielleicht hatte er die kleinen Brüder zu betreuen. Die Mutter Heiden wird ihm auch einiges abgefordert haben.
Vorratsholz galt es zu stapeln. Der vier Jahre ältere Adolf blieb dann zuerst bei den Streifzügen aus, weil er nun in die Geheimnisse der Seifenherstellung eingeführt wurde.
Und ein Lehrer wartete dann zu Hause, lehrte nicht nur schreiben und lesen, sondern auch Latein und die Bibel verstehen; sonntags war der Tag des Herrn und Feierstunde in seinem Hause jenseits der Friedhofsmauer. Vom Turme St. Nikolai sah Caspar David wohl auch das Meer. So wuchs er heran, in einer Gemeinschaft, die er gewohnt war, die er nicht missen wollte, Leben allüberall. Wo eine Hand gebraucht wurde, griff er zu. Abends lauschte er mit den anderen, wenn anstelle des Vaters Mutter Heiden aus dem Buch der Bücher vorlas, lauschte auch den Übungen und den Liedern, die die Schwestern Catharina und Maria auf dem Klavier hervorbrachten. Eines Tages hatte dieses Instrument im Hause gestanden. Das war die verschworene Gemeinschaft der Geschwister unter dem Regiment des rechtschaffenen, unentwegt arbeitenden Vaters.
Wie kalt die ersten Dezembertage des Jahres 1787 gewesen waren, wird kaum überliefert sein. Wehte der Wind vom Meer her, brachte er polare Kälte mit, sackte er Schnee aus Wolken, goss sich Regen herab, biss der Frost zu? War der träge dahin fließende wasserreiche Ryckfluss zugefroren oder nicht, der Teich neben dem Brückenkopf vielleicht, der Stadtgraben am ehesten. Am 8. Dezember jenes Jahres geschah etwas, was später immer wieder in der Familie erörtert wurde, über die Zeit hinweg, sowohl im heimatlichen Greifswald wie auch in Breesen, wohin Schwester Catharina dann geheiratet hatte. Und endlich in Dresden in Friedrichs Umfeld; ja, sogar in einem Nachruf bei seinem Tode wurde es noch erwähnt, das schreckliche Ereignis: Am 8. Dezember 1787 ertrank Caspars jüngerer Bruder Christoffer.
Die Bedeutung, die jenes Unglück für Friedrich erlangte, ermisst man vielleicht am deutlichsten, wenn man im „Kunstblatt“ vom 9. Mai 1840 den Nekrolog auf den Tod des Malers liest. „… sein Leben war ein langes Unglück. Die Erinnerung an seinen Bruder, der ertrank, als er ihn (wer wen?) beim Schlittschuhlaufen retten wollte, warf einen tiefen Schatten über sein ganzes Leben, da er sich als Ursache dieses Todes betrachtete.“ (41/48)
Wenn diese Bemerkung am Ende von Friedrichs eigenem Leben erfolgt, so zeigt sie, was die Zeitgenossen als eine Wurzel ansehen für jene Merkwürdigkeiten, die sie bei Friedrich feststellten, Menschenscheu und Verschlossenheit, die versponnenen Bilder mit ihren Grabsteinen und Eulen und Ruinen im Schnee. Was sie nicht verstanden, dafür brauchten sie eine Erklärung. Und die hatten sie in ebenjenem Ereignis gefunden.
Wilhelmine Bardua – die Schwester jener Malerin Caroline, welche mit Friedrich befreundet war und ihn noch in seinen letzten Lebensjahren porträtierte –, Wilhelmine also sei am ehesten entschuldigt. Sie schrieb: „Man erzählte, Friedrich habe in früher Jugend das Unglück gehabt, einen sehr geliebten Bruder beim Baden ertrinken zu sehen, ohne ihm zu Hilfe kommen zu können, nachdem er selbst früher durch denselben Bruder aus ähnlicher Gefahr gerettet worden war. Dieses traurige Geschick habe ihm unauslöschlich den Stempel der Schwermut aufgedrückt.“ (24/199)
Allenthalben also erzählte man vom ertrunkenen Bruder, und wie oft, durch die vielen Münder, hatte sich die Geschichte verändert. Wilhelmine hatte wohl nicht einmal vernommen, dass das Schreckliche mitten im Winter geschehen war, somit Badeunfall ausschied.
Also Schlittschuhlauf. An einem frostklirrenden Dezembertag laufen Kinder auf dem Eis bei Greifswald, wobei es unerheblich ist, ob es sich um Ryck, Teich oder Stadtgraben handelt; einer bricht ein und ertrinkt. Ein schreckliches Geschehen für jenen, der dabei ist und hilflos zusehen muss. Es bedarf nicht der Zuspitzung, dass der arme Christoffer gestorben sei beim Versuch, Caspar David zu retten (wie es viele Jahre später auch die Dresdner Freunde Carus, Schubert und Wilhelm von Kügelgen niederschrieben und vor diesem Fixieren gewisslich viele Male erzählt haben werden, über Jahrzehnte von einem Ereignis getrennt, bei dem sie nie zugegen gewesen waren).
Was aber, wenn der Winter so mild gewesen war in jenem frühen Dezember, dass es kein Eis gegeben hatte? Auch diese Version gibt es. So erzählte Gustav Adolf, Neffe und Patenkind des Malers und Nachfolger seines Vaters Adolf im Greifswalder Stammhaus: Die Geschwister Friderich wären zum Stadtgraben gezogen; Wasser lockt Kinder allemal, und wenn da noch ein Boot liegt, ein Kahn, irgendetwas, was schwimmt, da klettert man hinein. Und da stakt nun die Fuhre auf dem Graben herum. Und kentert. Und jeder stürzt ins Wasser. Jeder, der im Boot war! Und einer ertrinkt …
Man stelle sich das vor, das Schreien, das Klatschen im Wasser, Sprudeln und Strampeln, die Kälte benimmt den Atem, Nasen röcheln nach Luft, Hände versuchen zu greifen. Wie viel schwimmen da wohl, im Dämmerlicht schon. Passanten rennen herzu, fuchteln mit Stangen. Mancher mag da noch ins Wasser gesprungen sein, um zu retten.
Und dann liegen sie in den Betten, die Geschwister Friderich, in Decken gewickelt, schlucken heißen Tee. Und einer ist tot …
In Gustav Adolfs Schilderung ist keine Rede davon, dass Christoffer ums Leben gekommen sei, als er versucht hätte, Caspar zu retten. – Falsch ist zumindest das eine an dieser Lesart: „Geschwister“ im Boot. Schwestern waren mit Sicherheit nicht dabei. Sie waren zu jenem Zeitpunkt junge Damen von einundzwanzig und neunzehn Jahren. Bruder Adolf stand mit seinen siebzehn gewiss vorm väterlichen Seifenkessel; Johann ging schon in die Lehre als Schmied, selbst seine Anwesenheit bei dem Geschehen ist fraglich. Füglich bleiben von den vielen Geschwistern nur Caspar, Christian, Heinrich und das Opfer, Christoffer, übrig. Vielleicht waren Nachbarskinder dabei. Im Kirchenbuch in St. Nikolai steht geschrieben: „Den 8. 12. 1787 ist des Lichtgießers Friderichs sel. Sohn, alt 12 Jahr, da er seinen ins Wasser gefallenen Bruder retten wollte, ertrunken.“ (45/28) „Ins Wasser gefallen.“ Da steht nicht: im Eis eingebrochen. Da stellt man sich doch wohl eher vor, dass ein Boot kentert. Und Christoffer stand möglicherweise am Rand und sprang in die trübe, kalte Flut, um zu retten. Wen? Christian (acht Jahre), Heinrich
(zehn) oder Caspar (dreizehn)? Wäre solche Konstellation eingetreten, liegt der Gedanke nahe, dass sich unter Umständen auch der Älteste am ehesten selbst hätte retten können.
Vater Adolph Gottlieb in der Langen Straße nahm sich die Stammbibel und las noch einmal, was er einst glücklich hineingeschrieben hatte: „Anno 1775, den 8. October früh 2 Uhr ist mein Sohn Johann Chistoffer zur Welt geboren am Sonntag.“ Nun setzte er mit zitternder Hand und gottergeben dahinter: „Er ist ertrunken 1787 den 8ten December.“ (45/28) Alle näheren Umstände behielt Vater Friderich für sich.
Und dann geschieht das Merkwürdige, dass die Geschichte in der Eislaufvariante fünfzehn Jahre nach dem Unglück nicht nur nach Dresden gelangt, sondern dort sehr bald in der Zeitung steht, ein Vorgang, an dem Caspar David Friedrich nie gelegen sein konnte. Und sie wird ihn nun durch alle Schaffensjahre begleiten und noch einmal manifestiert werden im Nekrolog.
Nun also war die Kammer leer, obwohl nur einer darin fehlte, dieses leere Bett am Abend des Unglückstages, das Atmen, das Weinen der beiden kleineren Brüder. Und bald nun war Weihnachtszeit, da sich die Kirche St. Nikolai schmückte und das Kind in der Krippe auf Stroh lag und das andere Kind, aus dem eisigen Wasser gezogen, in die eisige Erde kam.
In jene Zeit mögen die ersten Versuche fallen, da sich Caspar mit Papier und Bleistift in eine Ecke zurückzog und in das wundersame Geflecht von Linien versenkte. Vielleicht lenkte ihn sein Taufpate auf solche Beschäftigung oder der Kandidat der Theologie, der als Hauslehrer fungierte und den Lotte Sponholz, Catharinas Tochter, in ihren späteren Aufzeichnungen Rabbke nennt. (Ein Student jenes Namens war freilich damals nicht an der Universität eingetragen, wohl aber ein Carl Friedrich Papke.)
Man könnte sich vorstellen, Caspar schrieb jene ersten kalligrafischen Arbeiten aus keinem anderen Grund, als unmittelbar nach Christoffers Tod den Vater auf seine Art zu trösten, indem er sich Sprüchen zuwandte. Die Bibel bot davon genügend. Während er also geschrieben hätte, hätte er sich zugleich selber Mut zugesprochen.
Das erste heute noch erhaltene Schriftblatt solcher Art entstand allerdings ein Jahr später. Datiert wurde es mit dem „1. Dezember 1788“. „Gott hat selbst in unsere Schmerzen und Bekümmernisse einen gewissen Keim zum Vergnügen gepflanzt …“ Es ist mit der Feder in jenem Schwarzbraun geschrieben, das er später in Sepiabildern so meisterhaft anwenden wird. Die Initiale hatte er in Wasserfarben kunstvoll ausgeschmückt. Die Arbeit eines Vierzehnjährigen, der gewiss tief Schmerzliches erlebt hatte, aber die nie endende Hoffnung und den Mut des Heranwachsenden in sich trug. „Aus dem Tode wird Leben geboren“, heißt es in diesem Blatt.
Vier Monate später schrieb er in einem anderen Blatt: „Wer nicht gehorchen lernt, lernt auch in der Folge nicht auf eine vernünftige Art befehlen …“ Man spürt den Hauslehrer Rabbke-Papke mit seinem Latein. Denn da steht nichts anderes als ein Ausspruch des weisen Solon über das Regieren, den Seneca in seinem Dialog „De ira“ wiederholt hatte: „Nemo autem regere potest, nisi qui et regi.“ Diesmal schmückte Caspar die Ornamentbogen mit fantastischen Vögeln aus, die sich spiegelgleich gegenüberstehen.
Von diesem aus dem Lateinischen übersetzten Spruch bis zum Latein selbst war es nur ein Schritt. „Mediam Cydnus amnis, de quo paullo ante dictum est …“ (Mitten im Flusse Cydnus, von dem schon vorher die Rede war …) Den lateinischen Text gab er nun auch in lateinischer Schrift, nicht mehr in Fraktur, dekorierte ihn mit einer Urnenvase und verwendete alle Liebe wiederum für ein Ornament. Jenes stellt nichts anderes dar als die Abkürzung seines Namens, welche einmal direkt zum Synonym für ihn werden sollte.
Irgendwo in einer der Stuben des Hauses hatte er seinen Platz, die weißen Blätter vor sich, von denen für ihn ein unwiderstehlicher Reiz ausging, sie mit Linien zu bedecken. Feder, Sepia, gelbe und orange Tinte verwendete er und schrieb „Mäßigkeit ist zuförderst nöthig beim Essen und Trinken“ und „Strebe nach den besten Freunden“ und andere moralisierende Sprüche. Ein Blatt ist datiert vom 1. Januar 1789. War es ein Neujahrsgruß für Vater, Lehrer oder Paten? Diese Blätter werden in der Familie von Hand zu Hand gegangen sein; mit leiser Bewunderung werden alle den Text wie auch ihren Caspar betrachtet haben. Die jüngeren Brüder wollten wohl nun auch für sich einen solchen Storch wie im „Mäßigkeitsspruch“ und die anderen Vögel, die keine Namen trugen, keiner Art angehörten, weil sie der Fantasie des Zeichners entsprungen waren.
Wurde die Geschichte vom Tode Christoffers in Greifswald wie auch in Dresden erzählt, ausgeschmückt und vielfach verändert, so auch eine andere, die aber im Wortlaut ziemlich gleichbleibt, dafür aber um so weniger auf Fakten beruht. Sie berichtet von der Herkunft jener Lichtgießerfamilie.
Ihr zufolge hätte der Urgroßvater Friedrich – nicht etwa Friderich – im schönen Schlesien ein Schloss auf einem Hügel besessen, wäre nämlich beileibe kein Handwerker gewesen, sondern ein Graf, der mit nichts anderem beschäftigt war, als seine Güter zu verwalten. Am Fuße des Schlossberges hätte Friedrichsdorf gelegen, mit einem Kirchlein. Nun aber hätten „Sendlinge des Kaisers“ die Kirche geschlossen, sodass kein protestantischer Gottesdienst mehr möglich gewesen wäre. Der angesehene Graf Friedrich habe daraufhin im Schloss eine Kapelle eingerichtet und verfolgte protestantische Pfarrer aufgenommen. Als Gegenzug hätten katholische Truppen die Kapelle zerstört und, was ihnen unter Äxte und Fäuste kam, zerschlagen. Den größten Frevel begingen sie sicher damit, dass sie die Bibel ins Feuer warfen. Dem Grafen drohte die Todesstrafe, sobald noch einmal ein Pfarrer das Schloss beträte. So hätte er schweren Herzens die Heimat verlassen und wäre nach dem protestantischen Schweden gezogen. Soweit vom gräflichen Urgroßvater. Großvater Friderich aber – der doch 1748 in Neubrandenburg starb – hätte dann seinen Sohn – Caspars Vater – in die Stadt Greifswald geschickt, „wo er einen tüchtigen Seifensieder wusste“. (36/10)
Eine schöne Geschichte. In Greifswald hatte vor Friderich nie ein Seifensieder gelebt. – Freilich hatten sich die Kaiser aus dem Hause Habsburg der Verbreitung der Reformation in den schlesischen Gebieten widersetzt. Besonders Ferdinand II. versuchte die Schlesier zum alten Glauben zurückzuführen; so hatte das überwiegend protestantische Land im Dreißigjährigen Krieg unsägliche Leiden zu erdulden. Kirchen wurden geschlossen und ihre Vermögen eingezogen.
Irgendwo, irgendwann sollte da also auch ein Graf Friedrich zwischen die Mahlsteine gekommen sein und Schloss, Dorf und Untertanen eingebüßt haben. Schweden als Zufluchtsland. Vor dem Hintergrund historischer Geschehnisse wurde eine Legende aufgebaut, die in keinem Punkt urkundlich bestätigt werden kann.
III. QUISTORPZEIT
In jener Zeit, da Christoffer sichtbar vor Caspars Augen versank und somit verdeutlicht wurde, wie jäh menschliches Dasein abbrechen konnte, stellte sich in der Familie Friderich und vor allem für den sensiblen Caspar selbst die Frage nach seinem eigenen weiteren Dasein. Der Hauslehrer Rabbke-Papke war am Ende mit seinem Latein, weil Caspar in das Alter gekommen war, in dem man ihn in die Hände eines anderen geben müsste: eines Meisters. Aber in wessen? Wie oft mag Vater Friderich nachts nachgedacht haben, wie Caspar einmal sein Brot verdienen könne, tags den Jungen beobachtet, wenn er Zureichungen in der Werkstatt machte, beim Feuerschüren, beim Säubern der Seifenformen, beim Mischen von Pottasche mit allen möglichen Ingredienzen, damit es gute Seife werde.
Und dann in seiner Ecke, in die er sich zurückzog, dieses Papier vor sich, das möglicherweise schon leisen Groll in Vater Friderich weckte. Die Hand, die da den Stift führte, wie würde sie Schmiedehammer oder Hobel anfassen? Erwägungen, ob es gut sei, auch diesen Sohn in der eigenen Werkstatt als Lichtgießer auszubilden. Gespräche mit dem Jungen unter vier Augen, wortkarge Meinung zu erfahren, Beratung in der ganzen Familie, ernsthafte und solche am Tisch beim gemeinsamen Essen, mit lockerem Zuruf über die Suppe hinweg. Vielleicht setzte sich Caspar viel schwerer über Christoffers Tod hinweg als all seine Geschwister, vielleicht war er in jener Zeit besonders schwächlich und anfällig für vielerlei Krankheit. Mancher Rat wird da von manchem erteilt worden sein, gefragt und ungefragt, vom Hauslehrer genauso wie von der Haushälterin. Und Caspar hätte wieder einen kalligrafisch gestalteten Spruch anbieten können, lateinisch oder auch deutsch: Multorum manus, paucorum Consilium. (Viele Hände, wenig Rat.)
Ein Personenkreis allerdings wäre für Rat in wichtigen Lebensfragen direkt vorbestimmt gewesen, nämlich jener, der am Taufbecken bei der Heiligen Dreieinigkeit gelobt hatte, über das Leben dieses Kindes zu wachen. Das waren bei Caspar der Kaufmann Loof, die Frau des Pastors Mayer und der Kandidat der Theologie Enghardt, der bei Caspars Taufe einen David Wiesner aus Neubrandenburg vertreten hatte.
Vielleicht ist der Wismaraner Johann Daniel Enghardt sogar der erste Hauslehrer Caspars überhaupt gewesen. Zog nun der verwitwete, mit Kindern gesegnete Lichtgießer noch die Paten all seiner anderen Kinder zurate, wäre er auf einen Personenkreis von dreißig, vierzig Leuten gekommen. Das waren Bäcker, Tischler, Drechsler, ein Bohr- und ein Kupferschmied; einer, der Knöpfe herstellte, Glaser und Buntfutterer fanden sich wie auch ein Goldschmied. Da hätte vielerlei Werkstatt für Caspar offengestanden, mit Eisen, mit Glas, mit Holz, mit Feuer, leichten oder schweren Hämmern und vielem, bei dem auch Kunstsinn gefragt war. Aber mancher dieser Handwerker konnte sich wohl geradeso in der Stadt behaupten und um nichts in der Welt einen Lehrling gebrauchen.
Was waren freilich die Paten der ersten Hälfte der Friderich-Kinder gegen jene der später geborenen, als der Name Friderich Klang in Greifswald hatte und mancher nicht mehr wusste, ob dies nun ein Lichtgießer oder Händler war. Da standen denn nach und nach, wenn wieder ein Kind dieses fleißigen Friderich getauft wurde, die wohlhabenden und angesehenen Kaufleute Biel, Binder, Luhde, Weißenborn oder Vahl am Taufstein. Oder deren Frauen. Und einmal die Pastorenfrau Mende. Und auch ein Dr. Scheuring. Das waren Leute, die sich in mannigfaltigen, dem Vater Friderich auch verborgenen Bereichen auskannten.
Von mancherlei Seite hätte da Rat kommen können und wird gekommen sein, und eines hatte sich dann verfestigt, herausgebildet, wohlabgewogen, zehnmal gedreht und gewendet: bei den verdammt guten Blättern, die da auf dem Tisch lagen (und der Pate Loof hatte vielleicht einen dieser Sprüche gerahmt in seinem Comptoir hängen): Caspar doch zu dem neuen Zeichenmeister zu geben, der gerade an der Universität seine Arbeit begonnen hatte.
Das war Johann Gottfried Quistorp, ein Mann Anfang Dreißig, Architekt, Bildnismaler und Radierer. In Dresden hatte er bei Anton Graff die Malerei studiert und bei Krubsacius die Baukunst. Und nun brauchte ihn die Stadt, in der er aufgewachsen war, eben Greifswald, damit es auch hier in der Baukunst vorangehe. Dieser Quistorp wird im Verlaufe der Jahre zwei Häuser in der Knopfstraße bauen und am Gymnasium und Vahls Haus in der Steinbeckerstraße und den Neubau des Mühlentores leiten und noch mancherlei mehr. Vor allem aber wird er an der Universität junge Leute in der Zivil- und Kriegsbaukunst ausbilden und an die Kunst überhaupt heranführen.
Die allgemeine Überlieferung berichtet, dass Caspar David Friedrich 1790 bis 1794 Zeichenunterricht bei Quistorp genommen habe. Da aber sowohl seine beiden älteren wie auch die jüngeren Brüder ihre Berufsausbildung mit vierzehn begonnen hatten, erhebt sich die Frage, was die Jahre 1788 und 1789 für Caspar brachten. Wurde er weiterhin vom Hauslehrer unterrichtet? In der väterlichen Werkstatt beschäftigt, bis der Vater dahinterkam, dass der Sohn nicht zum Lichtgießer tauge? Oder war er zu krank für eine durchgängige Lehre? Zwischen Blattern und Fleckfieber lauerte allerhand Tückisches, und gerade diesen beiden Krankheiten fielen 1782 und 1791 zwei Friderich-Kinder zum Opfer. Möglicherweise gibt es eine ganz einfache Erklärung, wie jene beiden fraglichen Jahre ausgefüllt waren. Caspar David ging bereits von 1788 an zu dem „Akademischen Zeichenmeister“ Quistorp in den Unterricht. Mit vierzehn Jahren! Es war seinerzeit keineswegs unüblich, dass talentierte Jungen in relativ frühem Alter das Studium der Künste an Zeichenschulen oder Akademien aufnahmen.
So zog denn Caspar David täglich aus dem Haus, mit der Zeichenmappe unter dem Arm, sicher froh, der Werkstatt, den Seifendämpfen zu entrinnen und noch eine Galgenfrist von einigen Wochen oder Monaten zu haben. Was dann? Er vergaß es, wenn er in Quistorps Stube unter einer Handvoll Gleichaltriger saß und diesem neuen Lehrer zuhörte und Dinge sah, die er vielleicht noch in der Kirche, kaum aber zu Hause sehen konnte: Kunst. Bilder von zarter Farbigkeit, kleine Skulpturen, Radierungen, Licht- und Schattenflächen. Allerhand hing bei Quistorp an den Wänden, viel kramte er aus Schubladen, Bücher füllten eine Menge Regale. Und wenn Quistorp erklärte, enthüllte sich das Wesen einer Figur oder eines Porträts. Zu Quistorp zu gehen wurde ihm über Wochen und Wochen zur lieben Gewohnheit, ja zum Bedürfnis. Immer entdeckte er Neues. Er kopierte. Und las. Und hatte die anderen um sich. Vor allem zu dem Ratsapothekerssohn Karl Schildener fühlte er sich hingezogen, der schon über zwanzig war und später zum Sammler von Werken Caspar David Friedrichs werden sollte.
Aus Friedrichs Quistorpzeit sind konstruktive und geometrische Übungen erhalten, die erkennen lassen, dass sein Lehrmeister Architekt und Baumeister war. Die Reißschiene, die später in Friedrichs Atelier an der Elbe hängt, wird der Maler weidlich für die eigenen Bilder benutzen.
Erhalten sind vor allem auch Studien der menschlichen Figur: männlicher Akt mit Stab, Vorder- wie Rückenansicht, die Maßeinteilung eingezeichnet; männliche und weibliche Torsos in verschiedenen Ansichten, die dort fehlenden Köpfe geduldig auf andere Art geübt, im Profil, mit gesenktem Blick und verschiedenem Ausdruck; Hand-, Bein-, Arm- und Fußstudien. Auge, Haar, Ohr gesondert, feste, klare Umrisse ohne Schraffuren. Später wird dann der Mann mit Stab, nackt, zum Herakles, der die Keule auf der Schulter trägt. Und Hephaistos sitzt in der Landschaft auf einem Stein, den unvermeidlichen Schmiedehammer dabei; er füllt das Blatt in der Diagonale, jeder Muskel an der richtigen Stelle. Flora dagegen wendet uns den Rücken zu, in einer angestrengten Pose, die vor allem die Biegsamkeit der Wirbelsäule verdeutlicht. Blumen trägt sie im Haar und in der Hand.
Quistorp war nicht der Mann, der seine Schüler Figuren der antiken Mythologie hätte kopieren oder frei gestalten lassen, ohne ihnen die Abenteuer des Herakles, die Bedeutung der Flora nahezubringen. Auch durch seine Bibliothek. Und da er unzweifelhaft erkannt haben dürfte, dass Caspar einer seiner begabtesten sei, wird der Lichtgießersohn aus der Langen Straße auch zu den wenigen gehört haben, die außerhalb der regulären Unterrichtsstunden ihre Zeit mit Quistorp verbrachten. Weit in die Ferne war da wohl gerückt, dass all diese Studien doch nur als eine Überbrückung gedacht waren, bis sich Endgültiges fände.
Johann Gottfried Quistorp hatte aber die Literatur nicht nur in Büchern vorzuweisen; seit seiner Studienzeit war er mit einem Dichter befreundet: Ludwig Theobul Kosegarten. Dieser Mann war, als Caspar David zu Quistorp kam, Rektor der Wolgaster Stadtschule und wurde 1792, noch während Caspars Quistorpzeit, Propst in Altenkirchen auf Rügen. Sehr wohl besteht die Möglichkeit, dass der junge Caspar durch Quistorp diesen Dichter persönlich kennengelernt hat, der nicht müde wurde, die „Urnatur“ der Insel Rügen, ihre Eichenhaine und Hünengräber zu besingen. Gerade in den Jahren 1790 bis 1794 erschienen Kosegartens „Rhapsodieen“, in denen Stimmungen und Gemütsbewegungen in Naturbildern widergespiegelt werden. Kosegarten heißt den Morgen in einer Ode willkommen: „Jüngling, sey mir gegrüßt!“ Der Morgen als Jüngling. Und „Schönheit ist das Göttliche in der Natur“ (31/31) bei Kosegarten. „So lasst uns denn noch einmal ausgehen und nach Gott fragen in der heiligen Natur, und forschen, ob wir seiner Fußtritte mehr erspähen können.“ (31/33) Diesem eigenen Anspruch folgend, hält er „am achten des Herbstmondes 1792“ den Fischern der Vitte eine Predigt direkt am Meeresufer, und sie werden „den nehmlichen Morgen einen ungewöhnlich reichen Heringsfang“ (31/145) machen, wie er später stolz anmerkt. Kosegarten schreibt: „Im allgebährenden Frühling, im allesreifenden Sommer, in des Herbstes Verwesungen, im starrenden Winterschnee – Leben ist’s.“ (31/33) Wer denkt da nicht an Friedrichs spätere Jahreszeitenzyklen …
Dieses Dichters Werk hatte Caspar bei seinem Zeichenmeister Ouistorp zumindest lesen können; vielleicht vertiefte sich dessen Eindruck auf ihn noch dadurch, dass er dem Manne letztlich von Antlitz zu Antlitz gegenüberstehen konnte.
Und dann las er von Rügen, dieser zerlappten Insel hinter dem Meere, hinter dem Greifswalder Bodden, auf der er doch schon gewesen war oder aber, angeregt gerade durch diese Lektüre, hingelockt wurde. Kosegarten erzählte nicht nur von seinem Ufergottesdienst in der Vitte. Er gab eine Beschreibung von Wittow, führte den Leser nach Stubbenkammer und Jasmund, wallfahrtete mit ihm nach Arkona und erklärte die Herkunft von rügenschen Namen.
Allerdings verbrämte er alles durch die Sicht eines Mannes, der an der rauen Küste der Insel Schiffbruch erlitten hatte und nun von hier aus Briefe schreibt. Kosegarten merkt hintersinnig an: „Wie diese Briefe dem Herausgeber in die Hände fielen, kann dem Leser gleichgültig seyn. Weniger kann es die Versicherung, dass er für jede darin befindliche topografische, statistische, antiquarische und naturhistorische Notiz, wie für seyn Eigenthum einsteht.“ (31, Band 2, „Briefe eines Schiffbrüchigen.“ Vorbemerkung.) Gerade diese Dinge festgehalten zu haben, darin besteht die Leistung des schreibenden Propstes.
So reiste Caspar David mit Kosegarten über Rügen und Hiddensee, ohne auch nur einen Fuß aus Greifswald zu setzen. Und er fand manch Abenteuerliches und manch Abergläubisches. Du kletterst an der Steilküste bei Jasmund, im Sturm, der die Äste der Bäume landwärts flüchten lässt, und auf einmal erscheint dir im tosenden Meer ein Schiff, „wie dunkle Luftgebilde“. Dennoch sind Rumpf, Tauwerk, Masten und Segel „in einem blassen Feuer“ so genau auszumachen, dass jeder Versierte auf Anhieb den Namen des Schiffes sowie dessen Heimathafen hätte nennen können. Ehe du dich jedoch von deinem Erstaunen erholst, ist die Erscheinung verschwunden! Später erfährst du, dass eben dieses Schiff dort, wo du es gesehen hast, einige Tage danach untergegangen ist: Es hat gewafelt. Auch der Mensch kann versinken: Ertrunkene wafeln! Wer hat da wohl Christoffer gesehen, da im Eis einbrechen, Tage vor dem Ereignis, wie ein dunkles Luftgebilde, in einem blassen Feuer?
In einem der Briefe lässt Kosegarten seinen Schiffbrüchigen schreiben: „Einige hundert Schritte jenseits von Nobbyn stieß ich auf ein majestätisches Hünengrab, das imposanteste und zugleich am besten erhaltene, was ich auf dieser Insel noch gesehen habe. Es streichet von Norden nach Süden. Der längliche Steinkreiß misst gegen dreißig Schritte in der Länge und gegen zehn in der Breite. Die Zahl der Steine, die ihm umsetzen, ist neununddreißig. Es sind mächtige Blöcke darunter. Die beiden mächtigsten bilden den Eingang und würden leichtlich einen Reuter zu Pferde bedecken. Der Grabhügel selbst ist sanft gerundet und streicht hart bis an das Ufer hinunter.“ (31/96)
Einige Jahre danach wird Caspar David diese „Steinsetzung von Nobbin“ zeichnen, wie viele andere Hünengräber. Und er wird das von Nobbin aufnehmen in sein berühmtes Sepiablatt „Hünengrab am Meer“, das er im Frühjahr 1807 in Dresden zeigte. Das Verzeichnis jener Ausstellung nannte ihn E. D. Friderich aus Schweden. Ja, dieser Ländername, verbunden mit diesem Sujet der wilden Steine, der Eichen und der Wasserweite, assoziierte nordische Gefilde. Die Schreibweise Friderich ist noch dem Greifswalder Ursprung verhaftet. Und die Abkürzung E. des Vornamens wird wohl mehr Druck- oder Hörfehler gewesen sein. Denn zu diesem Zeitpunkt ist er im Grunde schon ein bekannter Mann.
Sein Gefährte aus der Quistorpzeit, sein Freund, der Ratsapothekerssohn Karl Schildener – inzwischen Bibliothekar und Professor für Jurisprudenz an der Universität –, wird sich beharrlich mühen, damit festgehalten werde, was in seiner Heimat überhaupt noch an Großsteingräbern vorhanden ist, und sorgen, dass sie vor dem endgültigen Verfall bewahrt werden, diese „ehrwürdigen und durch nichts wieder zu ersetzenden Denkmäler der Vorzeit“ (45/56), wie er sie 1826 in der von ihm herausgegebenen „Greifswalder Akademischen Zeitschrift“ nennt. Ein Pfarrer zählte derzeit auf Rügen noch einhundertsiebenundachtzig Hünengräber!
Quistorp wäre der letzte gewesen, der sich nicht von Kosegarten leiten ließ, die Natur als eine Offenbarung Gottes anzusehen und also mit seinen Schülern hinauszuwandern und ihnen die Augen für die Schönheit der pommerschen Landschaft zu öffnen: der weite Horizont, die fließenden Übergänge zwischen Himmel und Wasser, das gewellte Moränenland, die Mühlen auf den Hügeln und die schilfgedeckten Hütten mit den Ziehbrunnen.
Und so hat er auch ein Ohr für den profunden Kenner des nordischen Altertums, der einstens in seiner Stube sich im Zeichnen versucht hatte, Karl Schildener nämlich, und nimmt sich seinen anderen berühmten Schüler (der inzwischen die Akademie in Kopenhagen absolviert hat und in Dresden wohnt und den er glücklicherweise, gelobt sei Gott, von den Seifenkesseln, von den Schmiedehämmern weggefischt hatte mit Wortgewalt und Vorstellungskraft dem Vater gegenüber und dem Bündel Beweisen in der Hand, den trefflichen Zeichnungen), Caspar nämlich, und wandert mit ihm nach dem nahen Gützkow zum Riesensteingrab. Und ist es dem Karl Schildener schuldig, ihm hinterher eine genaue Beschreibung davon zu geben:
„Der große, etwa zwölf Fuß lange, sieben Fuß breite und fünf Fuß dicke obere Deckstein des Grabes ruhte auf vier, nur etwa einen Fuß hoch aus der Erde hervorstehenden Steinen, welche (wie bey solchen Gräbern gewöhnlich) unten tief in der Erde die vier Wände des Grabes bildeten. Die Grube war ganz mit dem Acker gleich, voll Erde, und der Zwischenraum zwischen dieser und der unteren Fläche des Decksteines so niedrig, dass ich, der ich schmal bin, nur mit Mühe unter durch kriechen konnte. Als Friedrich das Grab zeichnete, lag ich oben auf dem Decksteine und rauchte ein Pfeifchen, so hat er mich in sein Skizzenbuch mit aufgenommen.“ (45/57)
Dieses Gützkower Riesensteingrab finden wir wieder in einem von Friedrichs ersten Ölbildern überhaupt, dem „Hünengrab im Schnee“, um 1807 gemalt, und zwanzig Jahre danach wird es kein anderer erwerben als eben Karl Schildener. Jener Mann hatte allen Grund gehabt, mühsam zusammenzubringen, was von diesen „durch nichts wieder zu ersetzenden“ Denkmälern auffindbar war. Als er sich Friedrichs „Hünengrab im Schnee“ an die Wand hängte, war dessen Urbild bei Gützkow „ganz mit dem Acker gleich“. Abgetragen nämlich!
Kosegarten schrieb bereits Hünengrabgedichte, als der kleine Caspar sich gerade anschickte, laufen zu lernen:
„Uber die vier moosbewachsenen Steine
über die drei rauschenden Eichen Fried und Ruh
Die ihr schlummert drunten,
Helden, herrliche …“ (41/54)
Dort ruhten freilich nicht gewaltige Heerführer und Schlachtenschlager aus dem Sagenkreis, keine Hünen eines tapferen Riesengeschlechts, sondern Steinzeitmenschen, deren Taten völlig unbekannt waren. Die überlieferten Heldengesänge waren viel jünger als jene Art Gräber.
Der junge Caspar, der da also bei Quistorp den Dichter Kosegarten für sich entdeckte und all das fand, was ihn später als Maler beschäftigen wird, hätte nun in diesen „Rhapsodieen“ auch „Eine Homilie“ lesen können, benannt „Vom großen Manne“. Damit aber kein Zweifel blieb, wer gemeint war, versah der dichtende Geistliche sie mit der Widmung „An Ernst Theodor Brückner, Diener des Wortes Gottes zu Großen-Vielen im Mecklenburgischen“. Noch war dieser Mann für Caspar ohne Bedeutung.
Aber 1801, da er Quistorp Pfeifchen schmauchend auf dem Gützkower Großsteingrab zeichnet, wird er Ernst Theodor Johann Brückner ebenfalls konterfeien, der längst nicht mehr in seinem Dörflein Groß-Vielen sitzt (schon nicht mehr, als Kosegarten jene Homilie veröffentlichte), sondern Pfarrer in Neubrandenburg war. Und da lebte zu der Zeit auch ein Hake, ein Kaufmann, ein Friderich, ausgebildet vom Vater als Lichtgießer, mit Namen Adolf, Caspars ältester Bruder! Und der nahm sich die älteste Tochter des Pastors Brückner zur Frau.
(Sie werden das väterliche Stammhaus in Greifswald als Lichtgießer und Seifensieder übernehmen und als viertes Kind einen Sohn haben, Gustav Adolf, der bis zu seinem Tode 1888 das Feuer im Stammhaus bewacht; dessen Sohn aber wird das große Brennen 1901 erleben.)
„Über die vier moosbewachsenen Steine
über die drei rauschenden Eichen Fried und Ruh …“
Kosegarten schreibt 1784: „Als wir noch Barbaren waren … thürmten wir unsere Rolande und Münster auf. Als aber Maximilian dem Faustrecht das Schwert entwunden, als der ewige Landfrieden Leben und Eigenthum gesichert hatte …, da … hatten wir unsere Opitze und Albrecht Dürer … und unsere Mengs, unsere Händel, unsere Klopstocks, erflogen Höhen, die Apoll, Homer und Pergolese sicher nicht erflogen hatten.“ (31/13)
Die von ihm verehrten Künstler, die Kosegarten hier nennt, sind von „unserem Boden“, also samt und sonders deutsche. Anders hätte er ohne Zweifel vor allem einen noch anführen müssen, an dem sein Herz hing und der überall aus seiner Dichtung spricht: James Macpherson. Oder Ossian. Wobei das eine für das andere steht. Macpherson hatte die „Works of Ossian“ 1765 herausgebracht, in Teilen freilich schon vorher. Es sind Epen, in denen Ossian seinen Vater Fingal besingt, den König der Kaledonier, des schottischen Hochlandes; aber Ossian rühmt auch eigene Taten. Später gelangte man zu der Ansicht, dass es sich nicht um alte keltische, gälische Gesänge des sagenhaften Barden Ossian handele, sondern um Macphersons eigene Dichtung.
Unerheblich für Caspar und Kosegarten.
Dem Stoffe nach sind es Schlachtengesänge und Sagen des dritten Jahrhunderts, aus der schottischen Geschichte mit Kolorit der uralten Heidenzeit. Fingal, der Hort aller Bedrückten, kommt mit seinen Schiffen einem Freunde zu Hilfe. Er ist „der erste der Männer, der Brecher der Schilde! Die Woge schäumt unter seinem schwarzen Bug. Wie Wälder ragen empor in die Wolken die Masten mit ihren Segeln.“ (38/47)
Und: „Wie hundert Stürme von Morven, wie die Stürme von hundert Bergen, wie jagende Wolken über dem Himmel, wie das dunkle Meer, das an die Küsten der Wüste anprallt, so brüllend, wild und so schrecklich trafen die Heere sich auf Lenas hallender Heide.“ (38/66)
Fingal, der König der Hügel, der König der Muscheln, des Ödlandes, der Mann mit den vielen Beinamen, siegt. „Düster stand er gelehnt an den Speer, rollend sein rotes Auge umher, schweigend schien er und hoch wie eine Eiche an Lubans Ufer, welcher die Äste versengten Blitze des Himmels vormals. Sie beugt sich über den Strom, im Winde flattert ihr graues Moos. Also stand der König.“ (38/87)
„Drei rauschende Eichen“, drei Eichen am Meer mit der Steinlegung von Nobbin, drei Eichen im Winter mit dem Großsteingrab von Gützkow … Friedrich-Bilder.
In dem kleinen Epos „Karthon“ stehen sich Vater und Sohn im Kampf gegenüber, ohne sich zu erkennen, wie im Hildebrandslied. Und Karthon fällt. „… da liegt er nun, eine mächtige Eiche, entwurzelt von plötzlichen Stürmen.“ (38/153)
Und in dem Epos „Kalthon und Kolmal“ heißt es über die Gefallenen: „Nicht findet man mehr ihre Gräber auf der Heide, Jahre kamen mit ihren Stürmen, grüne Grabhügel schwanden hinweg, kaum noch sieht man Dunthalmos Grab oder den Ort, wo er hinsank unter dem Speer Ossians.“ (38/191) Wo ist das Großsteingrab von Gützkow …
Das Gedicht „Berrathon“ schließt mit einer Voraussage von Ossians nahem Tod. „Unser Ruhm ist umschlossen von vier grauen Steinen.“ (38/247) „Ja, mein Ruhm wird bleiben und wachsen gleich einer Eiche in Morven, die ihr breites Haupt in die Stürme erhebt und jauchzt im Rasen des Windes.“ (38/248)
Ossians Ruhm ist dank Macpherson vor allem geblieben, der sich zeit seines Lebens nicht als Dichter der Epen zu erkennen gibt. Aber Ossian ist bald nach seinem Erscheinen in aller Munde. Alle Welt liest das. Goethe überträgt die „Lieder von Selma“, die zu den schönsten der Ossianischen Dichtung zählen, für seinen Werther. Kein Wunder, wenn Zeitgenossen beim Betrachten von Friedrichs Gemälden ausrufen werden: „Ganz ossianisch!“
Mit Quistorp, vielleicht schon vorher, hatte er vor allem auch jene Landschaft eine Stunde vor der Stadt kennengelernt, wo der Ryck in das Meer mündet. Dort lag das Fischerdorf Wieck und vorher noch das kleine Dorf Eldena, das die imposante Ruine eines Klosters aufwies. Dieses Kloster Hilda hatten Zisterziensermönche aus Seeland vor sechshundert Jahren gegründet, das reich wurde durch die Salzgewinnung aus Solquellen nördlich der Ryckmündung. Diesem Kloster verdankte Greifswald seine Entstehung. Caspar stieg mit Quistorp durch die Trümmer. Noch waren der Chor der Kirche und das Langschiff erkennbar, hingegen kaum noch, dass Wirtschafts- und andere Gebäude einen fast quadratischen Innenhof umgeben hatten. Er berührte die Steine, er pflückte kleine Blumen von den Simsen. In dem Pfeiler des hohen Westfensters führte eine beklemmend enge Wendel zu einem Austritt in halber Höhe, von wo er das Meer sah. Ein Alter, dessen Hütte in die Ruine hineingebaut war, schalt, als er hier herumkletterte. Nachts träumte er von dem Kloster. Erste Zeichnungen davon brachte er mit. Er stand auch in Wieck, wo sich endlos das Meer ausbreitete, und erfrischte sich im Wasser am Kuhstrand zwischen Netzen und Stegen.
Vier oder gar sechs Jahre wanderte Caspar David Friedrich also zu Quistorp. In dieser Zeit wuchs er zum jungen Manne. Anfangs, wenn er da nach Hause kam, voll von dem Neuen. Wenn er die Tür aufstieß und in den Flur trat, in seiner Langen Straße. Talgdunst flutete ihm aus der Lichtstube entgegen. Bruder Adolf stand vor der Feuerkammer und hörte wohl nicht einmal, dass er kam. Aus der Küche schaute Mutter Heiden und rannte gleich zum Herd, da er doch ausgehungert von dem Zeichenmeister käme. Was hatte sie für eine Ahnung, welcher Art Speise es bei Quistorp gab. Im Laden am Ende des Ganges standen unweigerlich Käufer. Der Vater verhandelte mit wer weiß wem im Salon. Also die Treppe hinauf. Aus der einen Stube riefen die Schwestern. Ihnen konnte er zeigen, was er heute gezeichnet hatte.
Das da ist die Flora; vielleicht ist der Rücken verzeichnet. Und das ist Herakles, ihr seht es an der Keule. Ein Bärenfell hat er sich über die Schultern gehängt. Und der da sitzt, mit dem Hammer am Boden, das ist Hephaistos – und ist es wieder nicht. Denn dieser Gott des Feuers und der Schmiedekunst, der unseren Bruder Johann in Neubrandenburg beschützen könnte, hatte verkrüppelte Füße, weil Zeus ihn aus dem Olymp geschleudert hatte. Schaut euch dagegen das Blatt an: Kein Krüppel sitzt hier, sondern ein Mann durch und durch. – Hephaistos war der einzige Gott, den die Griechen arbeitend in seiner Werkstatt dargestellt hatten.
Er musste nun den schönen Schwestern Catharina und Maria genau erklären, warum Gottvater Zeus seinen Sohn Hephaistos auf Lemnos hinuntergeworfen hatte. Dann stieg er noch die letzte Treppe hinauf, wo seine kleine Stube lag und die Hälfte des Geschosses schon Boden war. Hier nahm er sich Zeit, noch einmal diesen Quistorptag zu durchdenken.
Wenn er in der Wohnstube am großen Tisch unter allen anderen saß, mochte er sich zuweilen wie ein antiker Gott vorkommen: der einzige in der Familie, der nicht arbeitete. Da trieb es ihn in die Lichtkammer, in das Seifengewölbe. Er schleppte Kohle und Holz und schürte Feuer wie Hephaistos und arbeitete sich aus bis zum Umfallen und wäre vielleicht auch gern Schmied geworden und verfluchte Quistorp und die ganze Kunst und lachte dem Vater zu und riss der Mutter Heiden den Milchkrug aus der Hand und trank gierig, und seine Füße waren nicht verkrüppelt, und er ließ wohl einen Tag bei Quistorp aus und ging dann doch wieder hin und sah bei Quistorp kleine Stiche nach Gemälden von Rubens, Velazquez, Anton van Dyck: Hephaistos in seiner Werkstatt.
Eines Abends schwieg er wohl auf die Fragen seiner Schwestern, als er von Quistorp kam, und schlich sich gleich in seine Kammer, aus Ärger und Scham und Missmut. An diesem Tage hatte ihn der Zeichenmeister in die Küche geschickt, damit er einen Kessel heißes Wasser hole. Wasser ist gut gegen Schmutz, denn schau dir das Bild an. Wer erkennt denn noch, dass es einen Laubwald mit Jäger darstellt. Die Jahre hatten es übertüncht, Lichtruß und Fliegen das Ihre dazu getan.
Als Caspar mit dem Wasser wiedergekommen war, lehnte das Bild am Tischbein, und Quistorp war weg. Vom Nebenzimmer her hörte Caspar ihn reden. Wenn da ein plötzlicher Besucher dem Quistorp ins Haus gefallen war, konnte es lange dauern. Und das Wasser im Teekessel wurde dabei kalt! Der Sohn eines Mannes, der Seife herstellte, verstand sich aufs Reinigen. Kurz entschlossen goss Caspar das Wasser, so heiß es war, auf das Bild.
„Mein Gott!“, rief der herzueilende Zeichenmeister erschrocken „mit lauwarmem Wasser den Schmutz erweichen, aber nicht so! Nun schau dir das an …“ War es eine Nachtlandschaft geworden, ein Meer und ein Himmel? Das Bild war dahin …
Und als er eines Abends von Quistorp nach Hause kam, saß einer da in der Wohnstube und spielte mit dem Vater Karten, der Hauslehrer noch dabei, der eine oder andere Nachbar. Dieses neue Gesicht gehörte einem Studenten der Theologie, an dem der Vater Gefallen gefunden hatte, ein solider Mensch offenbar, aufgeweckt und so beschlagen, dass er den Vater Friderich im rechten Maß beim Spiel gewinnen ließ.
Was ihn wirklich getrieben hatte, im Friderich-Haus Fuß zu fassen, erhellte sich, wenn Catharina mit dem Bierkrug eintrat. Dann erhellten sich auch die Augen des jungen Sponholz, während sich in Catharinas feinem, edlem Gesicht keine Miene verzog.
Wer es verstanden hatte, zu den beiden vom Vater klösterlich gehaltenen Mädchen vorzudringen, musste wahrhaftig beschlagen sein. Ist es nicht bitter, wenn du die, die du magst, nur in der Kirche zu sehen bekommst? Aber glücklicherweise war ein heftiger Regen niedergegangen, hatte Jungfer Catharina unter der Kirchentür festgehalten, und der junge Sponholz hatte zur rechten Zeit den schützenden Schirm bereit, hatte dem Mädchen geholfen und später den Regenschirm bei ihrem Vater wieder abgeholt und es in dieser kurzen Zeit vermocht, den Lichtgießer zu beeindrucken.
Vielleicht war Vater Friderich der letzte im Haus, der dahinterkam, dass Sponholz mehr wollte, als ab und zu abends mit dem Alten ein Spielchen zu machen. Gab der junge Theologe auch manche Karte bewusst verloren, am Ende hatte er doch gewonnen.
Und als Caspar eines Abends von Quistorp nach Hause kam, saß einer da, der noch weiter vorgedrungen war als Sponholz, ins Allerheiligste, in die Stube, die über der Lichtstube lag und folglich die wärmste im ganzen Haus war. Dort saß einer an Marias Bett, an einem Maientag, und hatte ihren Körper mit linsengroßen roten Flecken gezeichnet und schüttelte sie im Frost. Und das war der Tod.