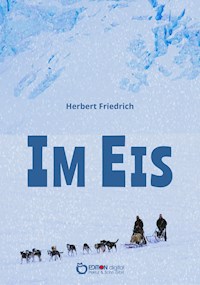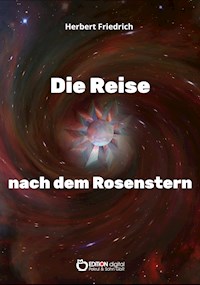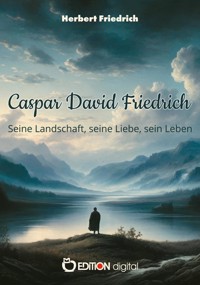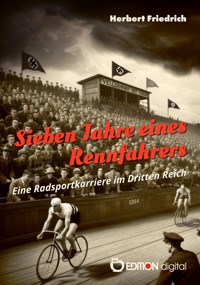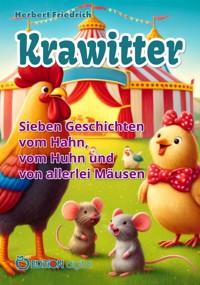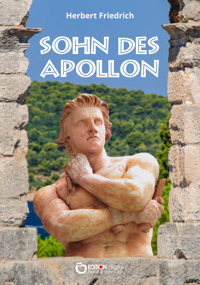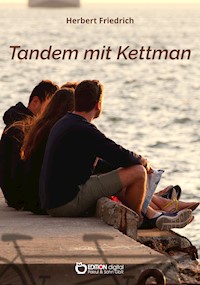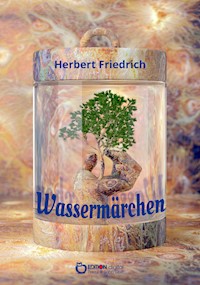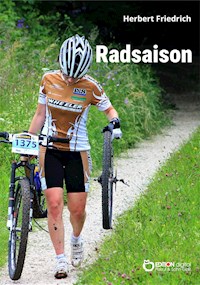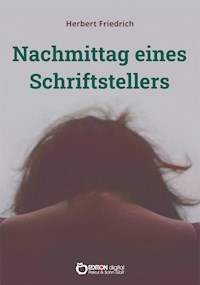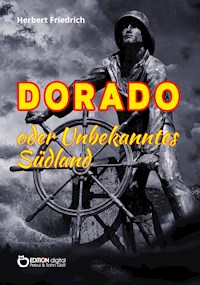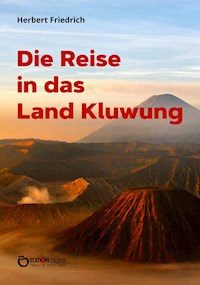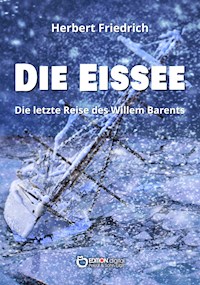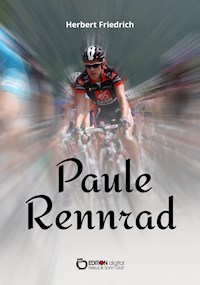7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In sieben dramatischen Erzählungen aus der Zeit von 1936 bis 1946 stellt der Autor junge Menschen vor bedeutsame, meist für sie oder andere lebensbedrohliche Entscheidungen. 1936, im faschistischen Deutschland, versteckt Hannelore ihren Bruder, der Flugblätter gedruckt und verteilt hat, vor den Häschern – und vor dem Vater. Zwei Partisanen springen im Hinterland der von den Deutschen besetzten Sowjetunion mit dem Fallschirm ab, um mit Hilfe der kleinen Partisanenabteilung das Kesselhaus mit dem Stab der Panzerarmee zu sprengen und die Bevölkerung nicht zu gefährden. Gefangene Wehrmachtssoldaten, die vor Ihrer Aburteilung stehen und denen Tod oder Strafkompanie drohen, erhalten durch Zufall die Chance, das Leben eines Kameraden zu retten. Junge Menschen des Reichsarbeitsdienstes helfen ihren Vorgesetzten, einen sensiblen Musikstudenten psychisch und physisch zu quälen. Junge Soldaten, die ihre Ausbildung noch nicht abgeschlossen haben, kommen zur Partisanenbekämpfung auf einen einsamen slowakischen Bauernhof. In der kasachischen Steppe warten im Mai 1945 junge Männer auf die Nahrungslieferung. Hungern sie weiter oder tasten sie die Saatkartoffeln an? Da hören sie im Radio die Siegesparade auf dem Roten Platz. In einem deutschen Kohlebergwerk wird das Leben der in der Nachkriegszeit hungernden Bergleute durch Diebstahl, Pfusch und Gleichgültigkeit bedroht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impressum
Herbert Friedrich
Der stärkste Regen fängt mit Tropfen an
Erzählungen
ISBN 978-3-96521-505-4 (E-Book)
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
Das Buch erschien 1971 im Verlag Neues Leben Berlin.
2021 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
Der verlorene Vater
An einem der letzten heißen Spätsommernachmittage des Jahres 1936 stand Hannelore Lehnert in der niedrigen Küche der „Moorschenke“ und wusch ab. Hastig tauchte sie den Lappen in das Wasser, in dem sich die Spuren des Mittagessens mengten. Ihre Bewegungen verrieten Eile und Ungeduld. Das Geschirr klapperte in dem zerbeulten Asch.
Nicht dass Hannelore durch ein Übermaß an Arbeit zu einer solchen Eile getrieben worden wäre. Seitdem Ernst, ihr jüngerer Bruder, vor vier Jahren, halb vom Vater hinausgeworfen, das Haus verlassen hatte und vor zwei Jahren auch Joachim, der älteste der drei Geschwister, gegangen war, lebte sie mit dem Vater allein in der Wirtschaft. Die Mutter, von der noch ein vergilbtes Bild in der Oberstube über der Kommode hing, war an Tuberkulose gestorben, als Hannelore zehn Jahre alt gewesen war. Gäste aber kehrten ganz selten in der Schenke ein.
Hannelore wischte sich mit dem Handrücken eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Die Luft war dämpfig, Dunst von gebratenen Zwiebeln und angebrannten Kartoffeln hing in der Küche. Draußen gab es den harz- und pilzduftenden Wald und die Stoppelfelder.
Sie kratzte den Rest Sauerkraut aus dem Topf und warf ihn in den Abfall. Sauerkraut fraßen weder die Ziege noch die sechs Kaninchen, die sich der Moorwirt noch hielt. Ein paar Hühner scharrten irgendwo im Hof. Lange war es her, da hatten sie Kühe und Schweine besessen. Das war zu Mutters Zeiten gewesen. Jetzt erhob sich am Platz des Stalles der kleine Saal.
Ihre Augen gingen wieder zum Fenster, als ob sie beim Anblick des Waldes, der das Hochmoor umschloss, die Schwüle nicht mehr so spürte. Der Wald war freilich weit weg. Wer behände zu Fuß war, konnte ihn in zwanzig Minuten erreichen. Nur an einer Stelle schickte er einen dunklen Streifen wie einen Finger durch den Feldgürtel abwärts. Das war die „Goldrinne“, der von Gebüsch umsäumte Hohlweg. Dort hinunter fuhren die reichen Bauern, der Bachmann und der Hilfert, ihr Getreide. Dort hatte sie als Kind Himbeeren gepflückt und dabei das erste Mal eine Schlange gesehen. Der lange, schlaksige Joachim hatte das Tier mit einem Stock erschlagen, worüber Ernst wütend geworden war, denn die Schlange war eine Ringelnatter gewesen.
Joachim war tot, im Rheinland verunglückt, vor knapp einem Monat. Ernst hasste die Schenke, das ganze Dorf. – Die Goldrinne lag in der Sonne …
Hannelore trocknete Messer und Gabeln ab, dabei brauchte sie die Augen kaum. Rechts vom Wald konnte sie ein Stück der Landstraße sehen, auf der die Brüder davongezogen waren. Hinter dem Wald, jenseits des Moores, das war schon nicht mehr Deutschland, dort lag die Tschechoslowakei. Ganz rechts aber, im Fenster nicht mehr sichtbar, erstreckte sich das Dorf und die Straße mit den Vogelbeerbäumen, die zur Schenke heraufführte.
Allein danach drängte es das Mädchen ungeduldig, nicht Hitze und Arbeit trieben es: Die Landstraße wollte es überschauen bis zum Dorf, das könnte am besten von der Oberstube aus geschehen.
Die Landstraße herauf musste der Briefträger kommen.
Sie schleppte den Asch mit dem Schmutzwasser hinaus, stieß die Tür auf und trat in den Flur. Tief atmete sie; hier war es kühler. Unter der Treppe befand sich die Pumpe.
Sie goss das Wasser weg und spülte den Asch aus, da hörte sie den Vater die hölzernen Stufen herabsteigen.
Eine unangenehme Kühle kroch ihr die Beine hinauf, als stände sie bloß auf den Steinplatten.
Sie kam unter der Treppe hervor, gerade als Paul Lehnert, der Moorwirt, an ihrem Ende angelangt war. Er zuckte zusammen, als das Mädchen so plötzlich vor ihm stand. Gebückt stand er da, abwartend, auch nachdem ihm Hannelore den Weg freigegeben hatte.
„Was ist?“, fragte sie leise.
Seine Augen lagen zwischen Fettpölsterchen in dem fleischigen Gesicht. Die herabgezogenen Mundwinkel machten es grämlich und unzufrieden. Auch rasiert hatte er sich wieder nicht. Seit Mutters Tod hatte er Fett angesetzt, einen Bauch hatte er bekommen und eine Glatze.
„Wenn wer nach mir fragt: Ich bin im Hof Holz hacken.“ Er blickte an ihr vorbei, während er sprach. „Also im Hof bin ich.“
„Gut, Vater“, antwortete Hannelore, und das meinte sie auch so. Gut, dass er im Hof war, wenn der Briefträger kam. Dem begegnete sie lieber allein.
Während Hannelore in der Küche die abgelaufenen Dielenbretter auftrocknete, fiel ihr ein, wie seltsam das gewesen war, was der Vater gesprochen hatte. „Wenn wer nach mir fragt …“ Wer käme zu einer Zeit, da jede Kraft auf den Höfen gebraucht wurde? Am hellen Tage? „Ich bin im Hof Holz hacken … Hörte man es nicht, wenn er hackte? Wozu sagte er es? Es musste ein wichtiger Gast sein, den der Vater erwartete.
Es ging bereits auf halb drei, als sie endlich mit einer Handarbeit am Fenster der Oberstube saß. Die Beilschläge hallten. Zur Moorschenke kam er immer zuletzt, der Briefträger. Erst musste er durch das ganze Dorf, das sich bis zum Johannsbach hinabdehnte und in einzelnen Gehöften weit über den Hang verstreute bis zur Steinrücke hinüber. Dabei war Seifersdorf ein kleines Dorf mit kaum siebenhundert Menschen. So ein Dorfbriefträger indes musste bergauf und bergab steigen, mit Paketen und Briefen und Geld. Die Postsparkasse hatte er auf dem Halse, und zwei Nachbardörfer ohne Poststelle betreute er. Den Kranken brachte er gewöhnlich, wenn er in Bruchstädt abrechnete, die Medizin mit aus der Apotheke. Und wenn man ihm ein Telegramm durchgab, musste er nachts aufstehen, auch im Winter oder im Regen.
Es gab hundert Gründe, weshalb sich ein Dorfbriefträger verspäten konnte. Hannelore fand sie. Denn sie liebte den jungen, breitschultrigen, manchmal etwas unbeholfenen Burschen.
Als sie ihn endlich in der prallen Nachmittagssonne das Rad den Berg heraufschieben sah, legte sie die Handarbeit beiseite und huschte die Treppe hinunter. Beruhigend klang das Krachen des trockenen Holzes unter Vaters Schlägen. Das Mädchen rannte zwischen Küche und Gaststube hinaus auf die Straße. Mit der festen braunen Hand die Augen beschattend, spähte sie ihm entgegen.
Der Mann mit dem Rad winkte und beeilte sich beim Aufstieg. Endlich stand er vor ihr, „Da bin ich, Hannel“, rief er fröhlich. „Was soll es sein, Eilbrief, Päckchen oder Telegramm?“
Sie blieb ernst, doch sie küsste ihn. Und sie sagte dann: „Kein Telegramm mehr: … verunglückt im Rheinland …“
„Verzeih …“ Er lehnte das Rad gegen die Hauswand und griff ihre Hand.
Seit einem Jahr liebten sie sich. Damals waren sie in Dittersdorf zum Tanz gewesen. Er hatte sie nach Hause gebracht. Sein Weg führe ihn sowieso an der Schenke vorbei, hatte er gesagt. Dabei kannten sie sich von Kind an. Mit Joachim war er in die Klasse gegangen, Rudolf Bender, der Sohn des Briefträgers. Dann war er Schmiedegeselle gewesen, bis er durch einen Unfall drei Finger der rechten Hand verlor. Einen Hammer konnte er so nicht mehr halten, also hatte er dem alten Bender in der Post geholfen. Nach dessen Tod vor zwei Jahren hatte der Gemeinderat mit Zustimmung des Hauptpostamtes in Bruchstädt den jungen Bender als Postbeauftragten bestätigt.
„Bist heute arg lange geblieben“, sagte sie mit einem kleinen Vorwurf in der Stimme. „Dabei steigst du bloß jeden zweiten Tag zu uns herauf.“
„Es ging nicht schneller.“ Er hängte umständlich die Jacke über die Lenkstange. „Festgehalten haben sie mich. Aber“, er lachte, „heute Abend, wie immer. An der Goldrinne …“
Sie strich über seine Hand, die den Lenker hielt, und blickte hinüber zu den Feldern und zum Hohlweg. Eine Wand schwarzer Wolken stand über dem Wald.
Sie fühlte, er war heute anders als sonst. Erst der Vater, jetzt er. „Festgehalten“, hatte er gesagt. Sie suchte in seinem Gesicht.
„Was hat dich vorhin festgehalten, Rudi?“ Die Kälte war wieder in ihr wie vorhin auf den Steinplatten, dieses eisige, beklemmende Gefühl, das von den Beinen aufwärts stieg und den ganzen Körper zu erfassen drohte.
Er verengte die Augen. „Ach, eine Kleinigkeit. Wir reden heute Abend.“ Sein Lächeln war gezwungen. „Ich muss weiter.“
Sie sah ihn unverwandt an. Erregt und unbefriedigt zugleich, ließ sie seinen Arm los und stand mit hängenden Schultern vor ihm.
„Es wird nichts werden heute Abend, es wird regnen. Und da sagst du: Kleinigkeit. Wie soll ich wieder zwei Tage warten. Und wenn es nicht regnet, merkt Vater vielleicht etwas, und ich kann nicht fort.“ Brüsk schwieg sie; die Beilschläge hallten.
Der junge Mann sah auf die Gewitterwand, die die schmalen Fenster des Wirtshauses erblinden ließ. Brüchiges Fachwerk und ein verwittertes Schild „Moorschenke. Inhaber Paul Lehnert“. Und daneben eine Laterne an kunstvoll geschmiedetem Arm, damit auch nachts der Name des Besitzers zu lesen sei. Der erste Blitz flammte.
Plötzlich sagte Rudolf: „Ich weiß etwas über Joachim.“
„Ja …?“ Ihre Lippen zitterten.
„Über Joachims Tod." Er schaute sich um. „Aber hier ist doch wohl nicht der Ort dazu. Und die Zeit.“ Er verstummte.
Sie drängte: „Sprich doch.“
Er gab sich einen Ruck. „Hitler hat ihn nach Spanien geschleppt. Dort ist er verreckt.“
„Spanien?“ Spanien. Knallige Schlagzeilen auf den Blättern, die in der Gaststube hingen. WAS GEHT IN SPANIEN VOR? VON DER AUSSENWELT ABGESCHNITTEN. GENERAL FRANCO MARSCHIERT. FRANKO, DER LEITER DES AUFSTANDS.
Und Joachim mittendrin. Als Francos Mann.
In Spanien verreckt. Sie stand da, als könne sie jeden Augenblick umsinken. „Woher hast du das?“
„Es ist besser, du sagst es ihm nicht.“ Er wies hinüber zum Hof, wo der Alte noch immer auf das Holz einhieb. Dann strich er ihr übers Haar. Seine Hand erschien ihr fast zu schwer. Sein Atem ging schnell. „Wir sprechen heute Abend, Hannel. Lass den Kopf nicht hängen.“ Er stieg schon aufs Rad.
Das Mädchen, verwirrt, aufgewühlt, sah ihm hinterher, bis er in der Kurve verschwand.
Als sie hineinging, hatte die Wolkenwand den halben Himmel überzogen, und erste Böen trieben Staub und dürre Aste über die Straße.
So also war Joachim gestorben …?
In der Oberstube schaute sie sofort zum Fenster hinaus, aber Rudolf war nicht mehr zu sehen. Leer glitt ihr Blick über Sofa, Tisch und Stühle.
Spanien, ein heller, fröhlicher Name, Tanz unter blauem Himmel und fremdländischer Gesang, und das Meer … Nicht im Rheinland verunglückt! Es war ein marterndes Denken. Und sie dachte: Woher weiß es Rudolf?
Mechanisch rückte sie einen Stuhl zum Kachelofen, um das Brett mit den Engeln herunterzuholen. Vor einem halben Jahr hatte sie Heimarbeit übernommen: Bemalen von Engelflügeln und -leibern. Lauter Engel ohne Köpfe standen vor ihr, eine Welt voller kopfloser Engel.
Die Schenke hatte sie daran gehindert, einen Beruf zu erlernen. Die Tochter wurde zum Kochen und Servieren gebraucht. Das Vieh musste abgeschafft werden und ein Saal her. Die Äcker wurden verkauft, um den Saal zu bauen. Und darüber hinaus wurden Schulden gemacht. Der Großvater hatte einen kleinen Ausschank betrieben, für durstige Wanderer. Vor allem jedoch war Großvater Bauer gewesen. Am Schenkbusch hatten ein paar Morgen gelegen, die hatte Vater dem Bachmann verkauft, dem Erbhofbauern. Die beiden Felder an der Hähne gehörten jetzt dem Hilfert. Ein Stück Vieh nach dem anderen war abgeschafft worden, fast unmerklich, so dass man weiter gar nichts dabei fand. Und alles nur aus dem Grund:
Paul Lehnert betreibt keinen Ausschank mehr nebenbei, sondern wird Gastwirt, Besitzer eines Restaurants.
Mit einem bitteren Gefühl tauchte Hannelore den Pinsel in die Goldfarbe und zog die Striche, immer die gleichen: an der Außenseite der Flügel, einen Halsring, einen Gürtel. Mit der blauen Farbe kamen Tupfen auf die Flügel und Knöpfe auf das Kleid. Die Goldrinne fiel ihr ein, als sie die Goldstriche zog.
Woher wusste es Rudolf?
Sie hörte die Ziege meckern. Das Tier graste an der Böschung im Schatten des Holzstapels.
Auf einmal war es finster im Zimmer. Als sie die karierten Gardinen zur Seite zog, grollte der Donner los, leise und gefährlich wie ein gereizter Hund. Das Himmelsviereck, das sie überschauen konnte, war blauschwarz überzogen, als hätte jemand Tinte darüber gegossen. Den Bruchteil einer Sekunde tauchte der aufzuckende Blitz alles in Licht. Dann platschte der Regen herunter.
Als sie hinaussah auf die Vogelbeerbäume, die der Sturm schüttelte, auf die Regenstriemen, die er prasselnd auf das Dach warf, vernahm sie durch das dumpfe Rollen des Donners das Meckern der Ziege.
Das Mädchen stürmte zur Tür und jagte die Treppe hinab. Sie hörte den Vater die Tür zum Hof verschließen. „Vater!“, rief sie. „Die Ziege!“
„Ist schon gut, Mädel. Sie ist schon im Schuppen.“
Aufatmend blieb sie am Fuß der Treppe stehen.
„Das ist ein Wetter!“ Sie lauschte dem dräuschenden Regen.
Wie von einem Windstoß flog die Haustür auf, der Regen peitschte herein. Jemand fluchte: „Kotzdonnerwetter!“ Der vor Nässe glänzende, mit Lederjacke und Stiefelhose bekleidete Mann, der das Motorrad in den Flur schob, war Hahndorf, der Bürgermeister.
Der erwartete Gast … Der also …
Sie raffte den Rock und stieg die Treppe hinauf. Sie vernahm nicht mehr, wie sich die beiden begrüßten. Ein Blitz flammte auf, unmittelbar von einem heftigen Knall gefolgt.
Da würden sie wieder beisammen sitzen, trinken, und hinterher war Vater wie hypnotisiert, begeistert, einen Bürgermeister zum Freund zu haben und selbst, mit Hilfe des Bügermeisters, Gastwirt zu sein.
Sie hasste Hahndorf. Als sie letzten Sommer das Fremdenbuch im Gemeindeamt zur Kontrolle vorgelegt hatte, hatte er plump versucht, sich ihr zu nähern.
Hahndorf hatte dem Lehnert eingeblasen, die SA brauche einen Saal, einen Versammlungsraum für die völkischen Kundgebungen. Das Volk würde zur Moorschenke strömen, der Umsatz sich enorm steigern. Und Vater war gern gefolgt, berauscht von diesen kühnen Gedanken und vom eigenen Bier. Wie hätte er auch dem Alten Kämpfer Hahndorf, einem der ersten Männer in brauner Uniform im ganzen Kreis, diesem Ellbogenmenschen, den er im Stillen ob seines selbstbewussten, rücksichtslosen Auftretens bewunderte, nicht folgen sollen?
Nachdem Mutter gestorben war, die Haus und Pfennige zusammengehalten und ihm den Kopf zurechtgerückt hatte, wenn er vieles begann und nichts zu Ende brachte, hatte er wieder jemand, der ihm beim Denken half.
Draußen floss gleichmäßig der Regen. Das Gewitter zuckte nur noch in der Ferne. Hannelore presste den Kopf an die kühlen Scheiben.
So war verkauft und gebaut worden. Großvaters Zimmer wurde Fremdenzimmer. Die Fundamente des Stalls reichten nicht für einen hundert Personen fassenden Saal mit einer kleinen Bühne.
Da das Geld ausging, wurde eine Hypothek aufgenommen. Als der Umbau vollendet war, kamen wirklich aus Neugier des Öfteren Gäste, sogar aus Dittersdorf und Bärwald. Tanz fand im Saal statt und einmal ein Hutzenabend. Lehnert und Hahndorf rieben sich die Hände.
Dann kam die Zeit, da einer nach dem anderen wegblieb. Hin und wieder trank noch ein Holzknecht in der Gaststube sein Bier, aber im „Stall“ des alten Lehnert wollte keiner mehr tanzen. Daran war die SA nicht schuldlos. Sie hielt hier ihre Versammlungen ab, doch bedeutete dies kaum eine Einnahme für die Schenke. Oft genug hatte Joachim ein Dutzend Kumpane freigehalten. Er hatte die Wirtschaft später übernehmen sollen und warb auf seine Art Kunden. Während die Redner vom blonden blauäugigen Herrentyp, von untermenschten Äfflingen und der Sendung des deutschen Volkes sprachen, flüsterte er seinem Nachbarn zu, wo die Veranda hinkäme. Einen Bierkeller wollte er bauen und das ganze Haus aufstocken.
Hannelore hatte beim Servieren oft solche Reden gehört und dabei in Joachims Augen den gleichen Ausdruck gefunden wie damals, als er die tote Ringelnatter betrachtet hatte.
Und jetzt war er selber tot.
Allein Ernst, der jüngere, lebte. Wenn einer damals gewettert, geflucht, die Faust auf den Tisch gehauen hatte ob dieser Schlamperwirtschaft, dann war es Ernst gewesen. Verhöhnt hatte er Joachim. Dann hatte er es satt gehabt und war fortgezogen nach einem heftigen Streit mit Vater und Bruder.
Hannelore beneidete ihn, dass er so gehandelt hatte. Die letzte der drei Geschwister war sie im Haus. Sie verabscheute diese muffige, ungesunde Luft, den Bierdunst, die Schwüle und die widerlichen Reden jener Daumendreher, der Freunde Joachims und des Vaters.
Rudolf konnte sie hier herausreißen. Durch die Heimarbeit mit der kümmerlichen Entlohnung legte sie sich Spargroschen zurück für die Hochzeit und das Notwendigste, was sie brauchen würden.
Das Mädchen richtete sich auf. In ihre Handflächen hatte sich das Fensterbrett in roten Striemen eingedrückt. Auf dem Tisch standen die kopflosen Engel. Nichts war zu vernehmen als das Rauschen des Regens und ab und an das Knacken der alten Balken.
Währenddessen hockten der Bürgermeister und der alte Lehnert auf dem durchgessenen Ecksofa am Stammtisch bereits beim dritten Bier. Die Hitze war wirklich zu groß gewesen. Paul Lehnert war stolz auf seine Gaststube. War sie auch winzig, so sollten sich doch seine Gäste wohl fühlen; er versäumte nie, sie auf die verschiedensten Details aufmerksam zu machen. Der „Bruchstädter Anzeiger“ hing einträchtig neben dem „Erzgebirgischen Heimatkalender“ und dem „Völkischen Beobachter“. Links neben dem Kleiderständer hing ein feiner Spruch. Der Joachim hatte den Spruch gemalt, denn der konnte das. „Die Männer und die Pferde steigen hoch im Werte“, war dort zu lesen. Wenn Paul Lehnert hinüberblickte, musste er immer an Joachim denken. Dann kniff er die Augen zusammen, dass von ihnen nichts blieb als ein Schlitz.
Noch kunstvoller freilich war die Darstellung über dem Klavier, sowohl vom Wort her als auch vom Bild, stammte doch das eine von Goethe, das andere aber von Joachim. Wer lesen konnte, der las, was da in schwarzen gotischen Lettern gemalt worden war: „Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst.“ Damit aber dem Leser kein Zweifel über den rechten Weg aufkommen konnte, hatte Joachim einen Wanderer dazugemalt, der einen Berg ersteigt, und am Gipfel des Berges die Moorschenke.
Lehnert seufzte und wischte mit dem Handrücken die vorgestülpten Lippen ab. Ja, er war ein Alleskönner gewesen, der Joachim.
„Draußen, dort nach der Straße zu, wollte der Junge eine Veranda bauen und an dieser Wand“ – Lehnert wies in die Ecke – „einen Durchbruch machen.“
Hahndorf, der Bürgermeister, sah gar nicht auf. Leicht vorgebeugt saß er da, stippte den Finger in die Bierlache und malte Figuren.
„Und dahin“, fuhr Lehnert betulich fort, „sollte ein Billard.“ Dann setzte er das Glas an, bis es leer war.
„Hatte wohl in der Lotterie gewonnen, dein Joachim?“, fragte Hahndorf spöttisch. „Hier ein Kronleuchter, dort ein Sessel. Wollte wohl sogar eine Bar einrichten?“ Der Bürgermeister lachte, dabei seinen mächtigen Unterkiefer entblößend. „Eine Bar, womöglich in Lehnerts Stall, wo früher die Kühe gestanden haben. Eine Milchbar!“
Lehnert stimmte in das Lachen ein, verstummte aber, als er sich bewusst wurde, dass Hahndorf auf seine Kosten lachte. Schwerfällig erhob er sich und humpelte, einen Stuhl streifend, zum Büfett, um die Gläser neu zu füllen.
Hahndorf rief: „Bring gleich zwei für jeden, damit du mir nicht immer wegrennst.“
Lehnert wartete, bis sich der Schaum gesetzt hatte, dann füllte er nach. Heute war mit Hahndorf nicht gut Kirschen essen. Während das Bier in das nächste Glas floss, griff er nach der Zigarrenkiste im Wandschrank. Der Regen wusch die Fenster.
Lehnert blickte zu Joachims Bild über dem Klavier. Dein Hotel geht pleite, Joachim. Wenn der Hahndorf nicht will, geht deine Kneipe pleite, wie du pleite gegangen bist. Und der alte Lehnert-Wirt mit. Dann ist es vorbei mit den Lehnerts. Er schloss den Bierhahn. Morgen schreib ich dem Ernst.
Als er zum Tisch ging, nahm er die Schnapsflasche mit.
Der Bürgermeister leckte sich die Lippen. „Du weißt noch, was gut schmeckt, Paul. Auf dein Wohl also.“ Der Schnaps feuerte in der Kehle. „Ah, Wacholder!“ Hahndorf schmatzte genießerisch. „So was ist gut bei Regen. Das wärmt von innen. So einen habe ich in Galizien getrunken, einen Borowiczka. Im letzten Krieg war das.“
Und dann erzählte Hahndorf, von der Kavallerie und den Tanks, wie schön die Weiber dort wären und wie bissig die Läuse.
Lehnert hing an seinen Lippen und sah in Hahndorfs tiefen Stirnfalten Schützengräben und in den grauen Bartstoppeln einen zerschossenen Wald.
„Ja, so war das“, nickte er ab und zu und gedachte der Zeiten, da er jung gewesen war und bei den Ulanen gedient hatte. Und so was wie ’nen Krieg hatte der Joachim gar nicht mehr erlebt.
Der Bürgermeister prahlte mit seinen Abenteuern und girrte sein hässliches Lachen, dass sein Gebiss bleckte wie bei einem Totenschädel. Lehnert lachte tiefsinnig in sich hinein bei diesen vielen Histörchen, Witzen und faden Pointen.
Einmal stand Hahndorf forsch auf, feixte: „Das Bier will wieder raus!“, und verschwand.
Als er wiederkam, sagte er leicht: „Ehe wir uns besaufen, mein Lieber, mal das Geschäftliche.“
Lehnert schrak aus einem Nickerchen. „Das Geschäftliche?" Er rieb sich die Stirn. „Ja, ja, du! Was wird denn mit der Post?“
Hahndorf sprach nicht von der Post. Hahndorf sprach von den Schulden, den verdammten.
„Die Summe der mir nicht bezahlten Hypothekenzinsen beläuft sich auf 387 Reichsmark.“ Hahndorf sprach das „Reichsmark“ so, als hätte Lehnert durch seine Schulden das Reich beleidigt, dessen Vertreter im Ort Hahndorf war. „Du weißt, Lehnert, dass ich dir daraufhin die Hypothek kündigen kann.“
Immerhin handelte es sich um dreitausend Mark. Der Wirt starrte auf die Tischplatte, hatte die Hände gefaltet und drehte nervös die Daumen. Was wird denn mit der Post …?
„Die Nationalsozialistische Partei hat dir solche Möglichkeiten gegeben. Die SA hat dir ’nen Saal hingebaut, Geld vorgeschossen. Du hast das nicht zu nutzen gewusst. Und obwohl du nicht zur SA gehörst, ja nicht einmal Parteigenosse bist, will ich dir helfen von Mensch zu Mensch.“ Er hob das Glas. „Hör zu. Dein Haus und mein Geld, das bleibt in der Familie. Ich pfeif auf die Hypothek. Ich heirate die Hannelore, und du überschreibst uns die Kneipe.“
Jetzt wurde Lehnert aschgrau. Er klammerte sich an den Tisch. Nach Worten ringend, stieß er hervor: „Das Haus bleibt uns, den Lehnerts! Das haben wir uns gebaut, Stück für Stück! Der Großvater hat das Bier noch im Flur verkauft. Und ich hab sogar einen Saal.“
„Durch wen!", warf der Bürgermeister zynisch ein.
„Das mit dem Mädel schlag dir aus dem Sinn. Deine Tochter könnte sie sein, da willst du sie heiraten? Dein Geld bekommst du auf Heller und Pfennig! Der Saal steht kaum drei Jahre. Glaubst du, dass sich da der Bau schon rentiert hat?“
„Na, na, na“, lenkte Hahndorf ein. „Du kannst ja als Wirt bleiben, bis du stirbst, und dein Name auf dem Schild auch. Der Joachim kann den Laden doch nicht mehr übernehmen. Was willst du also. Bar und Veranda – alles Flausen!“
„Der Joachim nicht mehr“, unterbrach ihn der Wirt, „aber ich hab noch den Ernst. Der Ernst kriegt die Schenke, da ruh ich nicht, bevor er sie nicht hat. Für den Ernst heb ich sie auf.“
Hahndorf lachte los.
Lehnert blickte stier in sein leeres Glas. An dem Ernst hatte er etwas gutzumachen; morgen schreibt er den Brief … Der Hahndorf, sein Schulkamerad, wollte sein Schwiegersohn werden. Das war Sünde wider die Natur. Seinen Lebensabend sah er vor sich. Er würde im Lehnstuhl hocken, zwei, drei Enkel um sich. Ernst stünde hinter der Theke. Die Bauern in Seifersdorf würden sich endlich das Saufen in Lehnerts Stall angewöhnen …
Hahndorf lachte immer noch. In der Bierlache auf dem Tisch schwamm Zigarrenasche.
„Erst jagt ihr den Ernst fort, kümmert euch nicht mehr um ihn, dann soll er den Karren aus dem Dreck ziehen.“
Sie starrten sich an.
„Behalt deine Schenke, gib sie dem Ernst. Aber …“, Hahndorf entblößte die Zähne, „bis zum Fünfzehnten bezahlst du die Zinsen.“
Lehnert stützte den Kopf auf. Das Geld beschaffte er, Tod und Teufel. Der Schädel schmerzte ihn.
Wieder schwatzte Hahndorf etwas. „Den Kerl sehe ich nicht gern bei dem Mädel. Man munkelt allerhand im Dorf.“
Lehnerts Gesicht glättete sich. Die Post …! „Der Bender kriegt die Hannelore auch nicht!“
Hahndorf knurrte: „Er soll öfter zur Moorschenke schleichen, als er Briefe mitbringt …“
„Hast du meine Eingabe erhalten?" Das musste Lehnert endlich wissen. Dann wurde noch alles gut. Er streckte den Kopf vor, den Bürgermeister erwartungsvoll anglupschend.
Hahndorf sah zum Fenster hinaus, auf die Abendschatten und die nasse Straße. Es regnete nicht mehr. „Im Gemeinderat sind sie auch der Ansicht, dass die Post neu besetzt werden muss, der Lehrer, der Ortsbauernführer, der Bäcker. Natürlich wird mein Wort ausschlaggebend sein. Ich hatte dich als Kandidat Nummer Eins ausersehen.“
Dann musterten sie sich gegenseitig, die wasserhellen Wirtsaugen und die bürgermeisterlichen Kuhaugen, und jeder suchte herauszufinden, was der andere dachte.
Lehnert aber sah die Rettung der Schenke vor sich. Gespannt hörte er Hahndorf zu.
„Wir brauchen einen zuverlässigen Mann. Bender ist unzuverlässig. Wir brauchen einen, der zum Beispiel nicht nur Briefmarken verkauft, sondern auch die Sondermarken loswird, der den Leuten erklärt, warum sie herausgegeben werden, die Parteitage, das Leben des Führers, so dass sie freudig danach greifen und die Zuschläge zahlen. Über die Telefongespräche muss genau Buch geführt werden …“
Und während der eine redete, sah der andere sie bereits den Berg heraufgezogen kommen zur Moorschenke, Briefmarken kaufen, Pakete bringen, telefonieren. Hinter der Gaststube in der kleinen Kammer würde er die Post einrichten, und jeder, der zur Post wollte, musste durch die Gaststube. Der Bürgermeister sollte sein Geld haben! Ein Briefkasten würde an der Schenkenmauer leuchten, ein Telefon käme ins Haus. Beamter würde er werden, sozusagen.
„Und denk an die Briefe. Den Biehl aus dem Unterdorf haben wir heute verhaftet.“
Lehnerts Gaukelbild verflog. „Na, so was!“
„Rote Agitation. Wir sitzen noch drin in der Wohnung, um zu sehen, mit wem er Umgang hat, kommt doch der Bender rein und hat ’nen Brief für ihn und will uns den Brief nicht geben, denn der gehöre dem Biehl.“ Er lachte. „Wir haben ihn festgehalten und ausgequetscht. Den Brief hat er uns lassen müssen.“
Lehnert lächelte.
„Den hätten wir eher haben können, den Biehl“, sagte Hahndorf. „Weißt du, wie? Wenn seine Briefe bisschen unter die Lupe genommen worden wären. Wem schreibt er, wer schreibt ihm? Das hätten wir wissen müssen. Wer sollte das besser wissen als der, der den Briefkasten leert oder Briefe austrägt. Da hätten wir auch gleich seine Komplizen gehabt. Aber da schau dir den Bender an. Und …“, setzte er nach einem Schluck seine Rede fort, „manchmal müsste man auch wissen, was die Leute schreiben.“ Das zischte er nur heraus, jetzt seinerseits den Kopf über den Tisch schiebend, so dass sich ihr Bieratem vermengte.
Die spärlichen Haare klebten Lehnert am Schädel, schwer lag er mit den Unterarmen auf der Platte. Das war keine angenehme Arbeit, die ihm da der Bürgermeister auseinandersetzte. Knifflig war sie. Wenn man Holz hackte, war hier das Beil und dort das Holz. Da brauchte man kein Versteckspiel, keine Winkelzüge.
Er hörte zu, rauchte und schwieg.
„Da wirst du manches verdienen können, wenn du bisschen bei den Leuten rumkommst.“ Hahndorf ließ sich vom Schnaps hinreißen. „Denkst du, ich hätt dir das Geld zum Saal geben können? Ich, ein kleiner Nadelstichler?“ Er lachte auf. „Woher sollte ich das Geld haben, he? Das will ich dir mal sagen, damit du weißt, was du als Briefonkel für Möglichkeiten hast, pass auf. Mein Meister hat mich immer nach Bruchstädt zum Einkaufen geschickt. Zu Samuel Kesselstein. So billige und gute Stoffe wie der Kesselstein hatte keiner. Wenn er auch Jude war. Dreiunddreißig hat man ihn gesucht. Sozialdemokratische Zeitungen hat er finanziert, das Schwein. Und ich hab ihn gefunden. Am Hochmoor. Zufällig. Er wollte in die Tschechei. Seine Reisekasse habe ich ein wenig erleichtert. Außerdem gab es bei der Kripo Finderlohn.“ Er stieß Lehnert an. „Na, wie ist es, bewirbst du dich immer noch um die Post?“
Der Wirt stierte vor sich hin. Der Kopf war ihm wirr. Den Saal wieder zum Stall machen, das ginge doch auch. Den Bierapparat verkaufen und die ganze Einrichtung. Eine Kuh anschaffen und ein Schwein, ein Stück Land pachten, wieder hinter dem Pflug gehen … Eigentlich war er gern hinter dem Pflug gegangen. Bis wann?
Bis Hahndorf gekommen war mit der SA.
Von Hilfert und Bachmann bekäme er die Äcker nie zurück. Alles verkaufen und woanders von vorn anfangen? Wenn man jung wäre … Felder verloren, Vieh verloren. Das Haus war geblieben, das Haus der Lehnerts.
„Bewirbst du dich noch um die Post?“
Er nickte schwerfällig.
„Bleibt bloß noch eins: die Kaution. Du bekommst Geld in die Hand, Postsparkasse, Postwertzeichen. Das ist ’ne Vertrauensstellung. Da muss eine Kaution eingezahlt werden von tausend Reichsmark.“ Er redete hastig. „Es wäre gut, wenn du bald bezahlst, damit dir niemand zuvorkommt. Am Freitag ist Gemeinderatssitzung.“
Lehnert sah sich gequält um wie ein gefangenes Tier. Seitdem Joachim verunglückt war, ging es bergab.
Nachdem Hannelore, beunruhigt durch Benders Worte, einige Zeit an ihren kopflosen Engeln gemalt hatte, fiel ihr ein, dass die Kaninchen versorgt werden müssten. Sie verließ die Oberstube, darauf bedacht, dass die Tür nicht knarrte, und schlich die Treppe hinunter. Vor der Gaststubentür blieb sie stehen. Da war Hahndorfs scheußliches Lachen. Sie sah förmlich seine gelben Zähne und die furchige Stirn.
„Borowiczka haben wir getrunken …"
Hannelore hatte einen widerlichen Geschmack auf der Zunge. Sie müsste hineingehen, den Vater an der Hand nehmen und hinausführen, dorthin, wo es schön war, in den Wald, damit er zur Ruhe käme und zur Einsicht.
Sie fuhr herum. Hinter ihr war die Tür ins Schloss gefallen. Das Mädchen starrte in den dämmrigen Flur.
Hinter der Treppe, vom Hof her, kam jemand.
„Rudolf“, flüsterte sie.
Durchnässt war er und halb wieder getrocknet; ein Fremder. Er blieb beim Anblick des Mädchens sofort stehen.
„Heil Hitler“, grüßte er leise. Er musste durchfroren sein oder krank, denn er zitterte. Seine Tasche stellte er gleich zwischen den Füßen ab.
Hannelore ging drei Schritt auf ihn zu, weg von der Gaststube. Kühl fragte sie: „Was wünschen Sie?“
„Ich hätt gern ein Zimmer für die Nacht.“
Sie wies auf die Gaststubentür. „Dort ist der Wirt. Da können Sie sich einen Harten geben lassen, der wärmt. Ich mache inzwischen das Zimmer zurecht.“
Er betrachtete aufmerksam Hahndorfs Motorrad. „Ich bin zu müde für Gesellschaft, leider …“
Er stand schon auf der Treppe. Sie wich ob dieser Hast einen Schritt zurück.
Er stieg eine weitere Stufe, winkte ihr. Sie stieß gegen die Wand, tastete nach der Klinke der Gaststube.
„Hannelore. Komm, schließ das Zimmer auf.“
Ihre Arme fielen herunter. Dann stand sie neben ihm auf der halben Treppe. „Ernst!“
Er presste ihr die Hand auf den Mund. „Vater darf nicht wissen, dass ich da bin.“ Er zog sie endgültig die Treppe hinauf. „Sag es ihm meinethalben morgen, da bin ich wieder fort.“
Sie stieg hinter ihm her und nahm nur die Hälfte dessen auf, was er sagte. Ernst war gekommen!
Im Fremdenzimmer hockte er auf dem Stuhl und sah ihr zu, wie sie seine nasse Joppe weghängte und die Waschschüssel füllte.
„Bist du krank?“, fragte sie besorgt. „Wie geht es dir, wohin willst du?“ Sie redete rasch.
Das Haar hing ihm wie früher strubblig um den Kopf.
Er saß mit geschlossenen Augen; sie sah seine Blässe, hielt inne im Aufschütteln des Deckbettes und ging zu ihm. „Sag bloß, was geschehen ist.“
„Du musst mir helfen. Sie sind hinter mir her.“
„Was hast du getan! Mein Gott, was ist das für eine Zeit!“
Der Mann schwieg. Dann sagte er: „Ich habe die letzte Nacht nicht geschlafen.“
Nebeneinander hockten sie auf dem Bett. In den Tropfen am Fenster blinkte die Abendsonne.
Er sah auf die Uhr. „Ich muss weiter, wenn es dunkel ist.“
Tonlos fragte sie: „Was kann ich tun?“
Er begann zu reden, als könne es sie beruhigen, wenn er ihr alles berichtete. „Wir haben Flugblätter gedruckt, über den Spanienkrieg. Mein Meister und ich. Ich bin ja sein einziger Gehilfe …"
Die Unruhe durchdrang ihren Leib.
„Heute Nacht haben wir gedruckt. Mit dem Frühzug habe ich sie nach Chemnitz gebracht.“
Sie presste die Hände zusammen.
Auf dem Bruchstädter Bahnhof, zu Mittag, hatte Ernst erfahren, dass sie einen vom Unterdorf verhaftet hätten.
Es war schwer, die Hände ruhig zu halten.
Ernst war dann nicht mehr in die Druckerei gegangen, sondern in ein Treppenhaus der Nebenstraße. Von dort hatte er in den Hof der Druckerei schauen können. Die Polizei war schon beim Ausräumen. Durch den Wald kam er auf Umwegen zur Schenke.
Im Gewitter, im Unwetter.
„Ich muss zu Rudolf. Sag ihm, gegen zehn will ich ihn sprechen, an einem sicheren Ort in der Nähe. Ich muss über die Grenze.“
„Zu Rudolf!“ Ihr Schrei erstickte unter seiner Hand. Sie saß wie erloschen, starrte auf die Tür, horchte nach unten. Es blieb alles still.
Es war ihr, als flamme ein Licht auf, das alles aus den Schatten herausriss. Rudolf hatte von den Hitlertruppen in Spanien gewusst. Warum, warum hatte er es gewusst? Weil es die Flugblätter gab, die auch die seinen waren.
Mit immer größerem Schrecken hatte Hannelore gelauscht. Rudolf und Ernst, darum kreisten ihre Gedanken. Ernst, der noch einmal zu Rudolf wollte, bevor er flüchtete.
Das Schicksal Ernsts, das Gejagtsein, Sichverbergenmüssen, das Schicksal eines Aussätzigen, Vogelfreien, Deserteurs, eines Verurteilten, der sich gegen die bestehende Ordnung, den Staat, vergangen hatte – dieses Geschick würde auch Rudolfs sein.
„Warum hast du das getan?“ Diese bebende Frage war Anklage und galt beiden: Ernst und Rudolf.
Die Schenke, der Saal voll SA, völkische Reden, Joachim grinsend hinter der Theke, eine erschlagene Ringelnatter unter dem Stock … Langsam löste sich ihre Erstarrung.
„Du musst jetzt schlafen.“
Aus dem alten Schrank holte sie Sachen von Joachim, damit er aus den nassen Kleidern käme.
Erschöpft lag Ernst auf dem Bett. Er versuchte zu lächeln. Dann schloss er die Augen, schlief.
Lange betrachtete Hannelore den Schlafenden, den letzten aus der Familie, auf den sie immer noch gerechnet hatte und den sie nun doch endgültig verlor. Sein Gesicht zuckte. Nicht einmal im Schlaf hatte er Ruhe. Angekleidet lag er da, jeden Augenblick bereit, die Flucht fortzusetzen.
Die Schuhe stellte Hannelore ihm gesäubert an das Fußende, seine Tasche auf den Stuhl am Bett, damit er rasch fortkönne, wenn Gefahr drohe.
Es nahte die Stunde, da sie zur Goldrinne aufbrechen musste. Ernsts nasse Sachen wickelte sie zu einem Bündel zusammen, das wollte sie im Schuppen verbergen. Die Gefahr bedenkend, öffnete sie die Tür. Doch ehe sie sie leise hinter sich schließen konnte, trat der Vater aus der Gaststube. Sie zuckte zusammen. Der Wirt starrte misstrauisch nach oben.
Energisch schloss sie die Tür und stieg hinab zu dem Alten. Ihr Herz hämmerte.