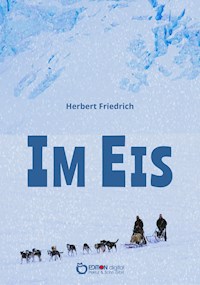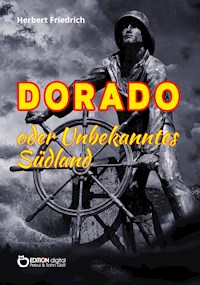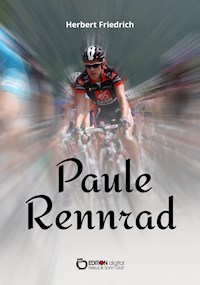7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In den 1970er Jahren schrieb der Schriftsteller Herbert Friedrich zwei Bücher über niederländische Seefahrer, die Java bereist hatten: „Dorado oder Unbekanntes Südland“, erschienen 1975, und „Der Vogel Eeme“, erschienen 1980. Im Buch „Der Vogel Eeme“ erreichen die Niederländer erstmals Java (1596), im Buche „Dorado“ sind sie seit 40 Jahren an Ort und Stelle, haben es längst kolonisiert und werden es bis 1945 als Kolonie betrachten, ausnutzen, beherrschen. (Von 1811 bis 1816 war es von den Briten besetzt, 1942 bis 1945 von den Japanern. Seit 1945 ist es Teil Indonesiens.) Insgesamt hat sich Friedrich beim Schreiben dieser beiden Bücher ca. vier Jahre ausschließlich mit Java beschäftigt und nur auf niederländische Quellen zurückgegriffen. Dabei stieß er auch auf den Titel „Javaansche Sagen, Mythen en Legenden verzameld door Jos.Meijboom- Italiaander, Zutphen – W.J. Thieme u. Cie – 1924“ In „Die Reise in das Land Kluwung“ hat Herbert Friedrich sechzehn dieser Sagen frei nacherzählt. In der vorletzten (Vom Fürstensohn, der Schmied wurde) weissagt ein Einsiedler dem Fürsten Mundang Wanggi, dass dieser drei Söhne bekommen werde. Jedoch der Erstgeborene werde ihn töten. Herbert Friedrich gestaltet daraus die Rahmenhandlung. Der Fürst, auf einer Reise durch sein Land, zwingt den Einsiedler nach dieser unheilvollen Weissagung mit ihm zu ziehen. In den vielen Tagen unterwegs erzählt der Einsiedler dann die Sagen. An seiner Seite ist der Tiger Menak Djinggah, ein verzauberter missgestalteter Prinz. Am Ende der Rahmenhandlung und damit dieses Buches erfüllt sich die Weissagung. Diese javanischen Sagen, die Meijboom-Italiaander gesammelt hat, erzählen von den Gegebenheiten des Landes (Sagen von Bergen, Tieren, Bäumen) wie auch von Herrschern und Geistern, Nymphen ebenso wie fliegenden Pferden, Riesen der Luft usw. Die alten Verbindungen Javas zu Indien wie auch zu Arabien brachten die Religionen der jeweiligen Länder mit, den Hinduismus wie den Islam. So finden sich in den Sagen und Legenden nicht nur die einheimischen Götter, sondern auch Brahma, Vishnu und Allah.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impressum
Herbert Friedrich
Die Reise in das Land Kluwung
Javanische Sagen neu erzählt
ISBN 978-3-96521-532-0 (E-Book)
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
Quelle: Javaansche Sagen, Mythen en Legenden, verzameld door Jos.Meijboom-Italiaander, Zutphen – W.J. Thieme u. Cie – 1924
2021 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
Die Weissagung
Vor langer, langer Zeit durchstreifte der Fürst Mundang Wanggi die riesigen Wälder an der Grenze seines Reiches. Da war es, als fahre der Sturm zwischen die Bäume. Sein Gefolge war kaum imstande, ihm auf den Fersen zu bleiben. Pferde führten sie mit sich. Sklaven schleppten eine Sänfte; leer natürlich lieber als mit dem beträchtlichen Gewicht des Fürsten. Haumesser schlugen Pfade durch unwegsames Geflecht, so dass die Holztauben und die langhaarigen schwarzen Affen flohen. Schweißnass war das breite, gelbe Gesicht des Fürsten, in seinen Augen glänzte der Eifer.
Zuerst hatte er einen Nashornvogel verfolgt, dessen rötliches Horn – o Wunder – in einer Spirale endete und dessen Gefieder in Farben schillerte, wie Mundang Wanggi sie noch nie gesehen hatte.
Kurz bevor er jedoch diesen unglaublichen Vogel erreichte, sprang vor ihm aus dem Bambus ein Tier, das es aller tausend Jahre nur einmal gab. Es war halb Antilope, halb Stier, ein Kenthus also. Dem hetzte er nun auf seinem weißen Pferd hinterher, während der Wundervogel verschwunden war und die Hohen des Hofes flehten, die Jagd aufzugeben. Aber dieser Kenthus zwischen Zuckerpalmen und Bambus war schon zum Greifen nahe und so schlapp, dass es nur noch eines Stoßes mit der Lanze bedurfte.
Als Mundang Wanggi mit der Waffe ausholte, war der Kenthus weg. Dagegen saß ein prächtiger Tiger auf dem Pfad und schaute den Fürsten an und schien es nicht einmal der Mühe wert zu finden, den Rachen fauchend aufzureißen.
Ein Mann aus seinem Gefolge, ein armer Teufel mit Namen Kario, sagte später, der Nashornvogel wie auch das Tier Halb-Antilope-halb-Stier sei schon der Tiger gewesen, nur verwandelt durch einen Zauber. Und es wäre besser gewesen, diesen Wald zu meiden.
Anders dachte der Fürst. Von Jagdlust gepackt, klatschte er seinem scheuenden Pferd auf den Bauch, so dass es vorwärtspreschte. Da sprang der Tiger mit einer Leichtigkeit davon, als fliege er. Seinen Leuten weit voraus, jagte der Fürst der Raubkatze nach. Der Wald tat sich zu einer Lichtung auf, und darauf stand eine Hütte und davor ein Mann. Dieser fragte: „Was begehrst du, Fürst Mundang Wanggi?“
„Walah!“, rief der Herrscher, was sein Erstaunen ausdrückte. Keuchend wischte er sich den Schweiß von der Stirn, während er den ausgemergelten Alten betrachtete, der nichts an Kleidung trug als einen Lendenschurz.
Der Erstaunensruf des Fürsten bezog sich weniger auf die unerwartete Lichtung und den einsamen Mann. Eher darauf, dass vor jenem wie ein friedlicher Hund der Tiger lag. Eines vor allem verwunderte den Herrscher: Dieser armselige Tropf kannte seinen Namen.
„Wer bist du?“, fuhr er den Mann an, während endlich sein Anhang auf die Lichtung drängte. Die vielen Leute, die Pferde, die Sänfte beeindruckten den Alten nicht.
„Man nennt mich den Tapa Gautama“, sagte er. Ein Tapa war ein Einsiedler. Dieser hier schien älter zu sein als die riesigen Bäume rings um die Lichtung.
„Du fragst, Einsiedler, was ich begehre. Ich sage es dir. Ich will den Tiger“, sprach der Fürst.
Ohne viel Ehrerbietung fragte der Tapa: „Wozu?“ Aus dem Tross sprang einer los, um den Frechen zu züchtigen. Mundang Wanggi winkte ab.
Der Einsiedler hingegen sagte: „Nimm dir den Tiger, Fürst. Halte ihn an deinem Hofe ohne Käfig. Lass ihn vor dir auf der Matte liegen, wenn du mit deinen Feinden aus den Reichen Ampal und Belis verhandelst. Sie werden sich gegenseitig in die Rippen stoßen und heimlich lachen. Das ist der Tiger, den der Einsiedler Gautama gezähmt hat. Mit diesem kirren Hündchen prahlt der Fürst; wie schwach ist er also. Oder töte den Tiger. Häng dir sein Fell auf. Jeder, der es sieht, wird wissen, dass du diesem königlichen Tier nicht im Kampf gegenübergestanden hast. Wie schwach ist dein Mut, wenn du einen Gefangenen erlegst. Also nimm dir ruhig den Tiger.“
So mit dem Herrscher zu sprechen, hatte noch keiner gewagt. Dessen Zorn mehrte sich, obwohl er sich eingestehen musste, dass der Einsiedler die Wahrheit sprach. Aber sollte er nach dem Nashornvogel und dem Kenthus auch noch den Tiger verlieren?
„Ich gebe dir etwas anderes für den Tiger“, sprach der alte Mann. „Ich sage dir, was auf dich zukommt.“
Der Fürst hatte von Männern gehört, die einsam in Wäldern hausten und mit den Göttern zu sprechen verstanden. Schon der Speichel, den sie versprühten, sollte heilkräftig sein. Je länger er diesen Tapa vor sich hatte, desto mehr war es ihm gewiss, dass jener zu den Zauberern gehörte. Das machte ihn beklommen, was ihm wenig behagte.
Vielleicht aber verschaffte ihm dieser Mann das Zauberöl Djajang Katong, das es ihm ermöglichte, in die Zukunft zu sehen. Das hätte ihn für die entgangene Jagdbeute entschädigt. „Also. Was kommt auf mich zu?“, fragte er lauernd.
Noch warnte der Einsiedler. „Bedenke, man kann den Speichel nicht mehr auflecken, wenn die Rede heraus ist.“
„Meinst du, ich habe Angst?“
„So höre. Du wirst drei Söhne bekommen.“
Mundang Wanggi sprang vom Pferd und warf das Halfter einem Sklaven zu, lachend. „Drei Söhne, drei helle Quellen.“ Vergnügt wandte er sich den Begleitern zu. Seine Frau, Dewi Sakira, war wirklich schwanger.
„Drei Söhne werden dir geboren“, wiederholte der Einsiedler. „Jedoch der erste wird dich töten.“
Eine harte Botschaft, fürwahr. Aber vielleicht lächelte der Fürst jetzt? Vielleicht ließ er sich nicht ins Bockshorn jagen? Vielleicht sprach er dies? „Willkommen, Sohn, werde ich sagen. Wenn du kein Herz im Leibe hast, dann nimm meines. Ich werde es mir aus der Brust reißen und in den Tod gehen, damit er leben kann. Wenn der Erstgeborene in den Fluss fällt, werde ich ihm nachspringen und über Wasser stemmen und dem Ufer zustoßen und selber ertrinken. Vor das Krokodilmaul, das nach ihm schnappt, werde ich mich werfen. Der Tiger im Wald soll sich an mir sättigen, damit er von meinem Sohn ablässt.
Mich schreckt deine Rede nicht, Tapa. Bringt mich das um, dass mein Sohn in der Welt ist, so lebe ich doch in ihm fort. Ich hätte auf Erden getan, was zu tun ist. Dann wird es an meinem Sohn sein, das seine zu tun.
Wäre er hingegen schlecht und verworfen, heruntergekommen zum Strauchdieb und würde so mein Mörder, nichts als auf das Erbe aus: Dann wäre es wahrhaftig gut, nicht mehr zu leben. Dann wäre es eine Wohltat, dass er mich tötet.
Sohn, sei willkommen, werde ich also sprechen. Und du, Tapa, der du mich nicht schreckst, gib mir zu essen. Denn ich bin hungrig nach allem auf dieser Welt.“
Sollten das die Worte von Mundang Wanggi gewesen sein? Allenfalls hätte ein guter Mensch wie der Prinz Djamodjaja so gesprochen, von dem später zu hören sein wird.
Denn da hatte der Einsiedler dem Herrscher geweissagt: „Drei Söhne. Und der Erstgeborene wird dich töten.“
„Wah!“, schrie der Fürst. Plötzlich war er aschgrau.
Der Tapa sagte: „Du hast es hören wollen.“
Mundang Wanggi stand wie vom Kot des Krokodils getroffen. Er sah auf den Einsiedler, diese Ameise, die den Elefanten herausforderte. Dieses Gesicht wie aus grobem Bambusgeflecht, ein dünner Mund, aus dem beruhigend die Stimme kam: „Das Wort ist im Wind und verweht mit dem Wind. Was ist denn ein Wort. Iss, Fürst Mundang Wanggi, von meinen Speisen.“
Betäubt von der Weissagung, fiel der Herrscher auf die Knie und saß dann auf plattgeschlagenem Bambus. Das Mahl war im Nu hergerichtet, als habe der Einsiedler den Fürsten erwartet. So sagte später der arme Teufel, der Sklave Kario.
Der Reis war mit Öl zubereitet, mit Zwiebeln schmackhaft gemacht, alles so, wie Mundang Wanggi es liebte. Sogar Ei und gehacktes Fleisch fand er. Also wusste der Gastgeber, was der Fürst gern aß. Aber die Weissagung stopfte jenem den Mund.
Der Einsiedler selber aß nicht. Er schob nur die Speisen zu und rückte Körbchen und Schalen heran. In einem Käfig nahebei saß ein Méntjo, ein sperlingartiger Vogel, der krächzte: „Lass es dir schmecken, großer Fürst Mundang Wanggi.“
Da kämpfte der Fürst schon gegen den Tiger, den der Einsiedler auf ihn losgelassen hatte. Das war ein anderer Tiger als jener, der wie ein Hund zu Füßen des alten Mannes lag. Das wühlte in seinem Herzen und wollte sein Blut, sein Leben. Aber der Vogel Méntjo sollte ihn nicht verdummen. Und das köstliche Wasser sollte ihn nicht berauschen.
Er sah ein Gefäß aus Messing, die bauchige Form, der schmale Hals nach oben abgeschlossen wie von einem Chinesenhut, das ganze über und über graviert mit Blüten und Blättern. Er war nicht einmal mehr überrascht: Es war sein Lieblingsgefäß von zu Hause. Er saß da, Mund und Bart mit Speiseresten verschmiert, überzeugt von der Zauberkraft des Tapas.
Und der, der ihn töten würde, wäre schon bald auf der Welt. Und der, der ihm das unverblümt gesagt hatte, stand gelassen vor ihm.
Da drängte es Mundang Wanggi, den Einsiedler auszutilgen und so dessen Rede ungesagt zu machen. Doch er konnte dem Mann nicht an die Gurgel. Er sah den Tiger und die Wasserkanne aus Messing. Und er hatte den Reis des Tapas gegessen und saß auf dessen Bambusmatte.
So saß er und sagte sich, er müsse einen besseren Zeitpunkt abpassen. Also hütete er seine Gesichtszüge. Nur die Stimme bebte ihm, als er äußerte: „Gut ist deine Prophezeiung nicht. Hast du mir nichts Besseres zu sagen?“
„Vielleicht willst du eine Geschichte hören? Sie wird dich zerstreuen.“
Der Fürst war kein Freund von Geschichten. Er hasste es, sich etwas vorerzählen zu lassen. Aber er dachte plötzlich, er müsse in der Geschichte hören, wie das vor sich ginge, dass ihn sein Erstgeborener töte. Da war er gierig darauf. Und es war lachhaft, dass er, der große Herrscher, Schauder vor einem Ungeborenen haben sollte.
Noch wartete der Tapa auf Antwort. Da hob Mundang Wanggi zum Zeichen des Einverständnisses die Hand. Sogleich schlug der Einsiedler an Bambusstäbe, die vom Ast eines großen Waringinbaumes herabhingen.
Wie der Gesang von Frauen tönte es da, und auf einmal saß Mundang Wanggi, als habe ihn ein süßes Gift gelähmt.
Der Tapa hingegen erzählte
Die Geschichte vom Baum, der Quelle und dem kleinen Vogel
(Quelle: De legende van den Waringin-boom)
Es war einmal ein Fürst, der regierte über eines der größten Reiche von Java. Dennoch ist sein Name nebensächlich. Eine Menge Kinder hatte er von seinen vielen Frauen. Doch alle gehen uns nichts an. Einzig und allein ist zu berichten von seinem Erstgeborenen, dem Prinzen Djamodjaja.
An Stärke und Verwegenheit glich jener dem Tiger, und er war flink und geschmeidig wie ein Zwerghirsch. Er besaß die Sanftheit der Waldtaube und die Treue eines Pferdes der edelsten Rasse. Überflüssig zu sagen, dass er gut und freundlich zu allen Menschen war und darum beliebt bei jeglichen im Lande.
Doch so viel Gutes dieser unvergleichliche Prinz auch in sich vereinigte – es gab jemand, der ihn aus tiefster Seele hasste. Das war Andana, die zweite Frau des Fürsten. Sie hatte nämlich auch einen Sohn. Und sie wollte, dass dieser den Thron bekäme, wenn der Fürst stürbe.
Der Schopf des Herrschers war schon sehr grau; viel Zeit blieb da nicht. Wenn eines Tages Prinz Djamodjaja das Reich übernähme, so würde er sie und ihren Sohn vom Hof vertreiben. So dachte sie Tag und Nacht. Und sie kam sich tausendmal schöner vor als die erste Frau des Fürsten, die Ratu Purwadadi.
Natürlich war Andana schön. Wer beschreibt ihre Augen. Ihr Haar war wie Seide, und ihr Mund konnte betörende Worte von sich geben, wenn der alte Fürst das Frauengemach betrat. Mit Haut und Haar war er ihren Reizen verfallen.
Eines Tages, als sie ihm kniend die Beteldose bot, hielt sie ihre Zeit für gekommen. Er fragte gerade: „Meine Liebe, begehrst du das goldene Armband, das uns der arabische Händler gestern gezeigt hat?“
Da schüttelte sie den Kopf so, dass ihr seidenes Haar ihn berührte. „Ich mag kein Geschmeide. Ich hege nur einen einzigen Wunsch.“
„Und wie lautet der, schönste all meiner Frauen?“
„Unser beider Sohn Semidjan möge einst über dieses Reich herrschen.“
Dem Fürsten klappte die Kinnlade herunter. „Das ist unmöglich, so lange mein Sohn Damodjaja lebt! Was soll seine Mutter, die Fürstin, sagen, wenn der Sohn meiner zweiten Frau mein Nachfolger wird?“
„Bin ich nicht die erste Frau eures Herzens?“
„Sicher, das bist du.“
„Wohl denn“, hob die Listige an. „Schickt Djamodjaja in die Berge. Sagt ihm, er müsse für alle Zeit fortgehen, da einer eurer Untertanen ihm ans Leben will. Das Gift für ihn stünde schon bereit. Euer Sohn wird also Angst bekommen und fortgehen. Bleibt er hingegen hier, wird das Volk vor dem Palast verlangen, dass ihr den Thron verlasst, noch bevor euer Rücken gekrümmt ist. Dann wird Djamodjaja mit harter Hand regieren und all eure Frauen vom Hof verbannen. Und nie mehr werdet ihr vor Augen haben eure liebste Frau, Andana.“
So also säuselte die Stimme am Ohre des Alten. Ihre Hand umkoste sein faltiges Gesicht.
Und er, der mächtige Herrscher über ein mächtiges Reich, dessen Leben wie brodelndes Reiswasser gewesen war; der mehr als fünfzig Pfeile mit seinen Händen aufgefangen hatte; der mit Schwert und Lanze und manchmal nur mit seinem geflammten Kris gegen die Feinde losgegangen war; dieser Mann stand nun mit Furcht im Herzen vor der schönen Frau. Und er, der am Hofe als hart galt und tausend Bitten und Begehren mit undurchdringlicher Miene abgeschlagen hatte, er unterlag jetzt dieser Stimme.
Er gestand alles zu, so wie Andana es verlangt hatte: Sein Erstgeborener sollte auf ewig in die Berge geschickt werden. Und nach des Fürsten Tod sollte kein anderer regieren als Semidjan, Andanas Sohn.
Noch am gleichen Abend beorderte er Djamodjaja zu sich und versammelte einige Große des Reiches dazu, damit die Sache den richtigen Anstrich bekäme. „Dir, unglücklicher Prinz, will man ans Leben. Deshalb fliehe augenblicklich ins Gebirge.“ Als hätte er keine andere Möglichkeit gefunden, ein bedrohtes Leben zu schützen. Dass Djamodjaja folglich verstoßen wurde, war für alle Anwesenden offenkundig.
Des Prinzen Blick schien mit einem Mal erloschen. Es half nichts, dass er auf die Knie stürzte und ausrief: „Vater, lasst mich doch hierbleiben! Ich fürchte den Tod nicht.“
Ein Wort nur sprach der Herrscher: „Gehorch!“ Sein Herz, das dem Wunsche seiner Nebenfrau offengestanden hatte, war dem Sohn gegenüber wie aus Stein.
Das Schicksal des Prinzen war besiegelt. Jeder, der davon wusste, war betrübt. Die Sonne würde mit Djamodjaja fortgehen. Die Götter würden ihre Hand von diesem Palast abziehen. Manch einer hätte sein Leben gewagt, um den Prinzen zu schützen.
Am traurigsten war unzweifelhaft Kesumo, die junge und schöne Frau des Prinzen. Ihr war völlig klar, dass er tun musste, was sein Vater verlangte. Jahrhunderte hindurch waren Kinder und aber Kinder bedingungslos den Worten ihrer Eltern gefolgt, wie es die Überlieferung verlangte. Auch Kesumo sah keinen Ausweg. „Wir müssen uns beugen, so wie sich die Palme beugt im Tosen des Orkans.“ Und dann flüsterte sie unter Tränen: „Was auch geschieht: Wir bleiben zusammen.“
Sie sah den Weg ins Gebirge vor sich, durch Dornen und Bambus und über Steingeröll. Ihre Füße würden bluten. Sie wusste nicht, welche Früchte sie essen, welche Bäche ihren Durst stillen würden. Die Sonne würde den Sand so erhitzen, dass man den nächsten Schritt scheute.
Das Herz des Prinzen schlug ruhig, als er vernahm, dass ihm in allem Unglück die Liebe seiner Frau blieb. „Wohlan, so folge mir ins Gebirge.“
Die böse Andana, die doch hätte zufrieden sein können, tat in dieser Nacht kein Auge zu. Mit jäher Gewalt war die Furcht über sie hergefallen, dass der alte Fürst bereuen könne, was er ihr zugestanden hatte. Was dann? Der Plan zunichte, der Alte tot, und Djamodjaja der Herr! Niemals würde diesem Prinzen verborgen bleiben, wer ausgeheckt hatte, ihn in die Verbannung zu jagen.
Selbst wenn der Fürst zu seinem Wort stand, blieben noch genug Schwierigkeiten. Ihr Söhnchen Semidjan war erst zehn Jahre alt. Stürbe der Fürst bald, dann müsste ein Knabe regieren. Dann käme aus den wilden Bergen Prinz Djamodjaja herniedergestiegen, quicklebendig, gestählt vom harten Leben in der Ödnis. Und trotz aller Ränke die Herrschaft an sich reißen.
Den Brei hatte sie angerührt, und dann fällt Sand hinein? Nein, schlafen konnte Andana diese Nacht nicht. Einem Versteck unter der Matte entnahm sie ein Büffelhorn, in dem sie ein starkes, doch langsam wirkendes Gift aufbewahrte.
Damit schlich sie zum Gemach des Prinzen. Neben dessen Bett stand ein Wasserkrug. Da hinein gab sie einige Tropfen von dem todbringenden Extrakt. Unglücklicherweise bemerkte das junge Paar sie nicht.
Noch in der Nacht trank der Prinz durstig. Lange lag er dann unruhig. Als er sich mit Sonnenaufgang erhob, fühlte er sich schlaff und taumlig. Er achtete nicht darauf. Kein Wort darüber verlor er vor seiner Frau.
Am Tage dann verließen Prinz und Prinzessin den Palast. Ohne auch nur einen Begleiter mitzunehmen, zogen sie in die schroffen Berge. Dornen stachen ihnen entgegen, Pfade schienen vor ihnen zuzuwachsen, Quellen zu versiegen. Es war viel ärger, als es Prinzessin Kesumo vorausgesehen hatte. Wiewohl sich der Prinz mehr und mehr elend fühlte, half er seiner jungen Frau über manchen Stein.
Endlich konnte er sein Leiden nicht länger verbergen. Noch schleppte er sich in ein Tal, das Schatten und Kühle bot. Dort fiel er hin. Keuchend stammelte er: „Meine liebe Kesumo, das Glück ist nicht mit uns. Ich glaube, ich sterbe …“
Wie ein Blitz traf es die Prinzessin. Ratlos, tief betrübt, warf sie sich neben ihren Mann und griff seine Hände, die kaum noch Wärme hatten. Ihre Tränen waren kein Lebenswasser für ihn. Mitten in der Wildnis war sie plötzlich allein. In letzter Not rief sie aus: „Große, mächtige Geister, helft mir doch! Rettet meinen lieben Mann …“
Kaum hatte Kesumo das gerufen, stieg aus dem Götterhimmel Kama Djaja hernieder, der Beschützer der Eheleute. Ein seltsames Licht umgab ihn. Es dauerte eine Zeit, bis Kesumo den Gott gewahrte, weil Tränen ihre Augen umflorten.
Voller Hoffnung rief sie aus: „Kama Djaja, ihr! Gebt meinem Mann das Leben zurück, ich bitt euch …“
Bei diesen Worten verdüsterte sich das Gesicht des Gottes. „Meine schöne Prinzessin. Eine böse Hand hat deinen Gatten vergiftet. Keine Macht der Welt kann die Wirkung dieses Todestrunkes aufheben. Aber ich will Djamodjaja auf Erden weiterleben lassen. Mensch allerdings kann er nicht mehr sein. Aber als ein schöner, kräftiger Baum soll er hierstehen, gerade an diesem Platz …“
Kesumo begriff erst die Worte des Gottes, als sie sah, wie sich urplötzlich ihr toter Mann aufrichtete und die Arme zur Seite streckte. Das Haar fiel ihm dabei über die Schulter bis auf den Boden und wurzelte ein. Mit Schrecken gewahrte sie, wie sich sein gesamter Körper mit Rinde überzog und wie aus seinen Armen Zweige sprossen, aus denen sich herzförmige Blätter schoben.
Kesumo rannte zum Baum, schlang die Arme um ihn und drückte das Gesicht gegen den Stamm. Voller Schmerz rief sie: „Was habe ich an diesem seelenlosen Gewächs!“
„Dieser Baum ist nicht seelenlos“, widersprach Kama Djaja. „Er ist heilig. Alle sollen ihn den ‚heiligen Waringin‘ nennen. Über ganz Java soll er seinen Schatten breiten. Selbst in den kleinsten Dörfern wird der stolze Baum wachsen. Reiche wie Bettler werden unter seiner Krone Opfergaben für die Götter niederlegen. Kinder werden unter ihm mit Reisfächern und Wasserschöpfern spielen und junge Paare sich an seinem Stamm ihre Geheimnisse zuflüstern. Fürsten, müde vom Kriegführen, werden sich unter dem heiligen Waringin ausruhen und vom Frieden träumen. Wehe dem aber, der seinem Sklaven befiehlt, einen Waringin zu fällen. Krankheit und Unheil werden über seine Kinder kommen und ihn selbst hinwegraffen.“
Dies alles sagte Kama Djaja zur Prinzessin Kesumo. Dann zog er wieder nach dem Kadewan, dem Sitz der Götter. Zurück blieb die traurige Prinzessin. Nicht einen Schritt ging sie weg von diesem Baum. Und nichts war um sie als der schwere, satte Geruch des Waldes.
Noch immer hielt sie die Arme um den Stamm geschlungen, den Kopf im Ausruhen dagegen gelehnt. Und schlief ein, um nie mehr zu erwachen. Ihre Seele wurde im Himmel der Götter aufgenommen. Ihr Körper aber verwandelte sich in eine Quelle, aus der kristallklares Wasser sprang. Wer hier seinen Durst stillte, lobte den Ort immer und ewig.
Schrecklich war es im Reiche des alten Fürsten, nachdem Prinz Djamodjaja verschwunden war. Zwar wussten die Hofleute von seinem Fortgehen. Aber das Volk, das diesen jungen Mann verehrt und geliebt hatte, war nicht unterrichtet.
Allerhand Sprüche gingen um. Wahres vermengte sich mit Falschem, und Kräfte erhielt das Gerücht durchs Laufen, bis dem alten Fürsten nichts anderes übrigblieb als den Landeskindern zu verkünden: „Nicht Djamodjaja wird nach meinem Tode regieren, sondern der Sohn meiner zweiten Gemahlin, Semidjan.“
Darüber erschrak jeder. Auf einmal – hatten es die Tiger erzählt oder die Raben – war allenthalben bekannt, dass der beliebte Prinz verbannt worden war. Da saß der Aufruhr vor dem Palast. Lauthals forderte die Menge, den Prinzen unverzüglich zurückzurufen.
Der schönen, verschlagenen Andana, der Giftmischerin, hätte das wenig angehabt. Hinter den Mauern fühlte sie sich sicher. Nur zu gut wusste sie, dass aus den Bergen niemals einer herniedersteigen konnte, der sie bedrohte. Unerwartet, wie der Biss einer Schlange, traf es sie in ihrem eigenen Gemach.
Ihr Sohn Semidjan, der zehnjährige Knabe, saß auf der Matte, nunmehr von Sklaven umgeben, was er nicht gewöhnt war. Jeglichen Handgriff nahmen sie ihm ab. An seinen Augen schienen sie zu erraten, wenn er zu essen und zu trinken begehrte. „Ich bin doch kein Prinz“, sagte der Kleine erstaunt. Ging er aus, trug man nun einen Schirm über ihm. Andere trugen ihm seine Amulette voran, damit ihm nichts Böses begegne. Wieder andere schleppten ihn auf ihren Schultern über Bäche oder setzten ihn in eine Sänfte, mit der sie durch die Straßen rannten. „Ich bin doch kein Prinz“, sagte Semidjan.
„Ihr seid wohl der Prinz“, entgegnete dann seine Mutter Andana. „Ihr seid nun der erste Sohn des Fürsten. Ihr seid der Thronfolger.“
Da stampfte Semidjan rot vor Zorn mit den Füßen auf. „Das ist nicht wahr! Das ist Djamodjaja. Wo ist er? Was habt ihr mit ihm gemacht?“
Nun hockte diese Frage tagtäglich am Ohre der Frau und peinigte sie. Und jener, der am heftigsten verlangte, dass Djamodjaja zurückgeholt werde, das war ihr eigener Spross.
Als Andana eines Morgens nach ihm schaute, da war er fort. Weg war er, verschwunden, unauffindbar, wie durch Mauern gesprungen, über Gräben geflogen.
Vierzig Tage und Nächte durchsuchten unzählige Leute Büsche und Berge. Keine Höhle ließen sie aus. Kein Fluss rann da, dessen Wasser sie nicht durchwateten. Semidjans Spuren auf dieser Erde waren ausgelöscht.
So erlitt Andana die härteste Strafe, die eine Mutter treffen kann: Sie verlor ihren Sohn.
Nie und nimmer nämlich konnte Semidjan gefunden werden. Als seine Kräfte auf der Suche nach dem geliebten Bruder immer mehr schwanden, als er gewahren musste, wie nutzlos sein Mühen war, bat er die Götter, ihn in einen Vogel zu verwandeln. Und dies geschah.
Nun konnte Semidjan fliegen, wohin er begehrte, von Nord nach West, von Süd nach Ost. Und so kam er schließlich auch – wen wundert es – zum Waringinbaum. Ermattet ließ er sich auf einen Ast nieder und rief, so wie er es schon über Schluchten und Wäldern gerufen hatte: „Kakagatot, Kakagatot! – Ich suche meinen Bruder.“
Hier hielt, so sagt man, der mächtige Baum mit dem Rauschen seiner Blätter inne. Und wisperte: „Ich bin dein Bruder.“
Der kleine Vogel verstand jedoch nicht die Sprache des Baumes. Und jeder Zweig raunte es ihm doch zu, solange er saß. Lange war das, viel länger, als man Betel kaut. Als er endlich aufflog, dann nur, um zu trinken. Vom Baum aus hatte der kleine Vogel die Quelle gewittert.
Von Stein zu Stein sprang er. Das Wasser besprühte ihn, so dass er sich rasch erholte. Wieder und wieder tauchte er den Schnabel ein, während die Quelle mit ihrem Plätschern nichts anderes sagte als: „Du bist bei deinem Bruder.“
Es wäre freilich ein glückliches Ende gewesen, wenn das Wasser nun bewirkt hätte, dass der kleine Vogel Quelle und Baum verstand. Das Vögelchen hätte ein Zuhause, Quelle und Baum sorgten für sein Leben. Und Semidjan dankte es ihnen, indem er zwischen ihnen hin- und herflog. Denn sie können ja ihren Platz nicht verlassen.
Dem war aber nicht so. Sobald er getrunken hatte, flog der Vogel Semidjan auf, taub für die Stimmen von Waringin und Quelle, so heftig sie auch riefen. Die Götter, die doch seinen Wunsch erhört hatten, ein Vogel zu sein, damit er seinen Bruder fände, hatten ihm seltsamerweise die Fähigkeit versagt, die Sprache von Quelle und Baum zu verstehen.
Und so flog er weg von diesem Ort, viel betrübter, als er gekommen war, immer weiter flog er. Und seitdem ist er Jahr um Jahr in ganz Java unterwegs mit seinem sehnsüchtigen Ruf: „Kakagatot – ich suche meinen Bruder.“
Und noch immer versteht er nicht die Stimme des heiligen Waringin, die ihm antwortet: „Ich bin dein Bruder …“
Wie der Einsiedler mit dem Fürsten mitzieht
So erzählte der Tapa dem Fürsten Mundang Wanggi. Schweigen trat ein. Das Gefolge hatte sich gelagert. Die Pferde standen im Schatten; Sklaven saßen zwischen den Holmen der Sänfte. Große rote Ameisen liefen über die Matte, und ein schwanzloses Huhn pickte nach Fressbarem. All dies sah der Fürst.
Vor allem aber sah er den Waringinbaum und die Quelle unweit davon, deren Plätschern herüberdrang. Und auch den Vogel Méntjo im Käfig sah der Fürst. Dieser Vogel sprach: „Bist du nun satt, Mundang Wanggi?“
Was aber hatte der Fürst gehört, was er der Geschichte entnehmen könnte? Ein Herrscher verbannt seinen Erstgeborenen. Das missfiel Mundang Wanggi keineswegs. Und der Fürst in der Geschichte hatte eine zweite Gemahlin; auch das dünkte ihm gut. Ja, diese Dewi Angana war nach seinem Geschmack. Er würde wie sie handeln. Er würde seinen Erstgeborenen töten, um jenem zuvorzukommen. Das sagte sich Mundang Wanggi, als er vor der schäbigen Hütte saß.
Dem alten Einsiedler, dessen Rippen wie ein Gambang waren, schrieb er all das Ungemach zu, mit dem er jetzt zu kämpfen hatte. Dieser Tapa sollte trotz seiner Zaubermacht nicht ungeschoren davonkommen. Solche Gedanken kamen dem Fürsten, hier am Waringinbaum. Er schob sich in die Höhe, was nach dem langen Sitzen Mühe verursachte.
„Schön hast du erzählt, Tapa“, sagte er. „Ich wollte, du könntest mich auf meiner Reise begleiten und durch Geschichten unterhalten.“ Sein Lächeln war falsch wie seine Stimme.
Mit aneinandergelegten Händen stand der Einsiedler vor dem Waringinbaum, sah dem ziehenden Rauch hinterher, als ob er davon Rat erwarte. Endlich kniete er neben dem Tiger nieder und legte das Ohr an dessen Maul. Dann erst sprach er: „Ich komme mit dir, Fürst.“
Er löschte das Feuer, ging in die Hütte und kam mit einem Bündel zurück. Keine Essensschale, keinen Becher räumte er von der Matte. Und dennoch war plötzlich die Messingkanne verschwunden. Vor dem Baum verbeugte er sich noch einmal, trank von der Quelle. Den Vogel ließ er frei. Dann wandte er sich und schritt inmitten des Gefolges hinter der Sänfte her, in der Mundang Wanggi nun saß. Der Tiger lief hinterdrein.
So zogen sie viele Tage durch den Wald. Mehr als einmal witterten die Pferde Gefahren. Irgendwo marschierten Einsiedler und Tiger mit, irgendwo ruhten sie am Abend. Aber niemals begehrte Mundang Wanggi, eine Geschichte zu hören.
Tapa Gautama in seinem Lendenschurz wusste sehr wohl, dass er mehr Gefangener als Reisebegleiter war. Manchmal zog die Furcht ein Stück mit ihm, doch er konnte sie stets noch vertreiben. Nachts legte er seinen Kopf auf den Tigerleib und schlief traumlos.
Endlich erreichte der Fürstenzug das Meer. Im weichen Sand unter Palmen war es angenehm zu laufen. Glatt lag das Wasser, ohne Wellen, von einer milchenen Bläue, die dem Himmel kaum nachstand.
Wie lange hatte der Einsiedler das Meer nicht mehr gesehen. Der Tiger wälzte sich im Wasser, was den Tross unterhielt. Sie lagen da von Morgen bis Abend und die Nacht hindurch und wieder den Tag. Da trat der Sklave Kario vor den Einsiedler und sprach: „Komm mit zum Gebieter.“
So wie er sich erhob, erhob sich auch der Tiger. Es gefiel ihm wenig, als ihm der Bote bedeutete, der Fürst möchte zu dieser Stunde kein Raubzeug sehen. Also ging Gautama allein.
Mundang Wanggi schaute belustigt auf den Mageren, ruhig nun, da er sich im Klaren war, wie er der Weissagung zu begegnen habe. „Hattest du einen guten Marsch zum Meer?“, rief er aus und musterte vergnügt des Alten wunde Füße. „Ich bin es müde, auf die Schiffe zu warten. Nun erzähl schon; ich vergehe vor Langweile.“
Eine Geschichte war immer gut, auch für den alten Gautama. Unweit des Fürsten setzte er sich nieder, gerade so, dass sein Speichel nicht unversehens den Mächtigen treffen konnte. Den Rücken lehnte er gegen eine Areccapalme, besann sich kurz und begann dann: „Ich erzähle die Geschichte von der Glücksblume.“
Die Geschichte von der Glücksblume
(Quelle: De sage van de Widjaja Kesoema)
Der Regent der Insel Nusa-Kembangan war gestorben, und nun kam sein Nachfolger; der war als böse und herrschsüchtig bekannt. Als er gekrönt werden sollte, sah er im Traum eine Felseninsel, auf der eine wundersame Blume wuchs. Ihr Duft betörte die Schmetterlinge; sie schillerte wie das feinste blauseidene Tuch, das sich eine Prinzessin um die Hüften schlingt. Sie glich einem Stern, der auf Erden niedergegangen ist.
Als er aus seinem Traum erwachte, sagte sich der neue Fürst, dass er diese Blume essen müsse, gerade an seinem Krönungstag. Das Unvergleichliche an ihr würde dann auf ihn übergehen und ihn zum mächtigsten Mann auf Java machen.
Er erinnerte sich der Insel, die er im Traum gesehen hatte. Der Form nach glich sie einem Tiger, der sich zum Trinken ins Meer beugt. Der Fürst kannte dieses Eiland sehr wohl. Sein Name war Karang-Bandong. Man konnte es im Meer liegen sehen, wenn die Sonne günstig stand.
Der Fürst ließ einen weisen Mann aus dem Wald holen. Jenem erzählte er von der Blume. Ja, der Einsiedler wusste davon. Tatsächlich wuchs sie auf Karang-Bandong. Aber diese Felseninsel wurde von bösen Geistern bewohnt. „Wenn du die Blume willst: Schick deine Leute hin, wenn die See glatt und der Himmel ohne Wolken ist“, riet der Einsiedler. „Dann schlafen die Geister. Bei Sturm aber …“
Der Fürst winkte ab. Nun wusste er genug von der Blume Widjaja. Er schickte den Einsiedler wieder in den Wald und eine Anzahl Leute an den Strand, damit sie zum Eiland Karang-Bandong übersetzten. Die Krönung des Fürsten stand unmittelbar bevor. Er konnte sich dieses Fest schon nicht anders denken als mit der ‚Glücksblume‘, wie er sie insgeheim nannte.
Als die Gefolgsleute an die Küste kamen, erschraken sie sehr. Die Wogen gischteten mit unbeschreiblicher Gewalt gegen die Felsen. Alles stand stumm, Hofmann wie Sklave, und starrte auf das weißgepeitschte Wasser, dem sie sich anvertrauen sollten. Es war unmöglich, bei diesem Wetter die Insel zu erreichen. Die bösen Geister waren alle erwacht.
Der Hofnarr stand auch dabei, wollte er sich doch das Schauspiel nicht entgehen lassen. Von Verstand war er so verkümmert wie von Gestalt. Dieser Narr rief: „Voran, ins Boot! Hat euch dieses Lüftlein den Befehl des Fürsten weggeblasen, heute die Glücksblume zu pflücken? Los also. Wer dem Gebieter nicht gehorcht, den kitzele ich mit dem Kris.“
Die Sklaven wussten sehr wohl, dass der kleine bucklige Mann tun würde, was er gesagt hatte. Also stemmten sie sich gegen das Boot, um es ins wogende Wasser zu bringen.
In diesem Augenblick kam ein Fischer vorbei, der fragte erstaunt: „Was tut ihr da?“
Das war rasch erzählt.
Der Fischer war ein armer Schlucker, der kurz vorher im Sturm Boot und Netze verloren hatte. Was also konnte er noch einbüßen. Er kannte das Meer, und er besann sich nicht lange. Er sagte: „Wenn ich so viel zum Lohn bekomme, dass ich mir davon Boot und Netze kaufen kann, dann will ich zur Felseninsel übersetzen und die Blume holen.“