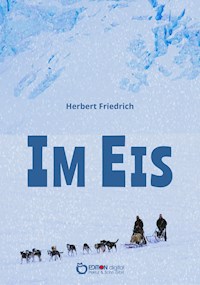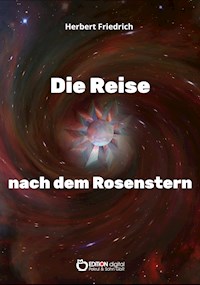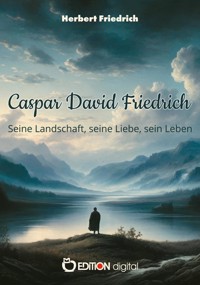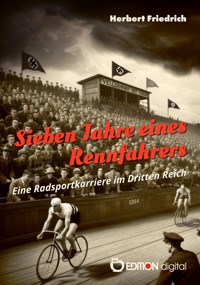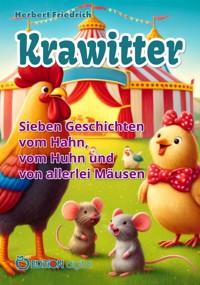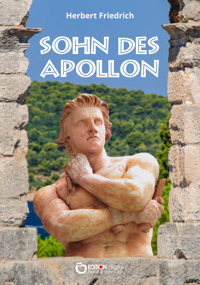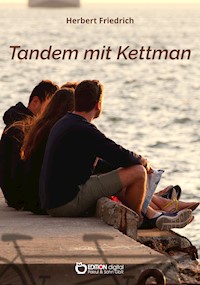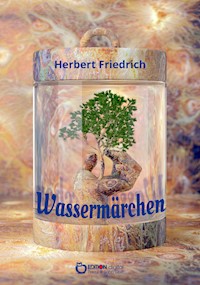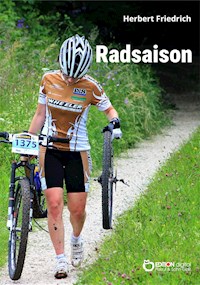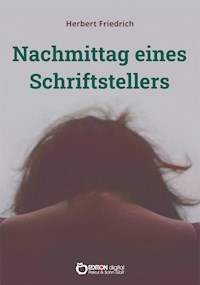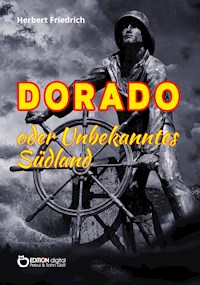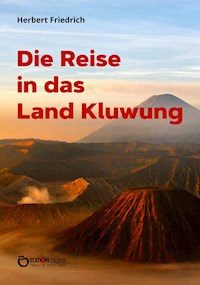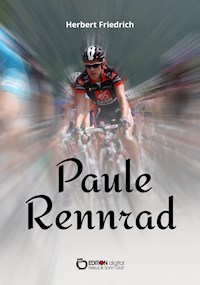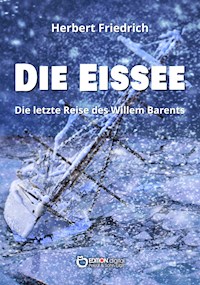
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die beiden holländischen Schiffe „Eissee“ und „Amstelredam“ waren unter dem Befehl des Willem Barents am 10. Mai 1596 von Amsterdam abgesegelt, vollgestopft mit Kaufmannsgut für China oder Japan. Sie sollen eine nördliche Durchfahrt nach Asien finden. Unterwegs gibt es Streit zwischen Barents und Jan Coreneliszoon Rijp, dem Kapitän der „Amstelredam“ über den richtigen Weg. Die Schiffe trennen sich und Barents segelt mit der „Eissee“ bis Nowaja Semlja, wo sie u. a. die Bäreninsel und Sitzbergen entdecken. Sie umrunden die Nordspitze der Insel und erreichen das Nordostkap, bis das Eis ihr Schiff umklammert. Sie bauen sich ein Holzhaus und sind die ersten Europäer der Neuzeit, die in der Arktis überwintern. Das Eis gibt auch im Sommer das Schiff nicht mehr frei, so dass sie auf zwei offenen Booten die beschwerliche Rückfahrt antreten müssen. Der überlebende Teil der Mannschaft erreicht nach mehr als einem Jahr die Halbinsel Kola, wo sie Rijp treffen und mit ihm nach Holland zurückkehren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impressum
Herbert Friedrich
Die Eissee
Die letzte Reise des Willem Barents
ISBN 978-3-96521-520-7 (E-Book)
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
Das Buch erschien 1968 im Verlag Neues Leben Berlin. Für das E-Book wurde die 8. Auflage von 1990 verwendet.
2021 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
DIE MANNSCHAFT DER „EISSEE“
WILLEM BARENTS: Oberster Pilot und Navigator der Expedition
JACOB VAN HEEMSKERCK: Schiffer und Commis
PIETER PIETERS VOS: Hochbootsmann
CLAES ANDRIES: Untersteuermann
MEESTER HANNS VOS: Chirurg
JACOB JANS VAN STERRENBURGH: Feuerwerker
JORIS CHRISTOFFEL: Zimmermann
GERRIT DE VEER: Volontär
LENAERT HENDRICKS: Koch
SIMON JAN REYNIERS: Bootsmann
FRANS VAN HAARLEM: Bootsmann
LAURENS WILLEMS: Bootsmann
CORNELIUS PIETERS: Bootsmann
DUNCKER JANS: Bootsmann
EVERT JACOBS: Bootsmann
CARSTEN HOOGHWOUT VAN SCHIEDAM: Bootsmann
JAN HILLEBRANTS: Schiffsjunge
ERSTES BUCH: Das Schiff
1
Die dritte Nacht lagen die Schiffe im Windschatten der Insel Vlie. Nebeneinandergelagert, glichen sie einer Stadt mit Türmen und Zinnen. Das ungewisse Nachtlicht, das Meer, das sie hob und senkte, täuschte über ihre Größe hinweg. Ebbe und Flut zerrten an ihren Ankern. Der Wind jagte durch die leeren Rahen.
Es waren die „Eissee“ und die „Amstelredam“. Unter dem Befehl des Willem Barents waren sie am 10. Mai 1596 abgesegelt von Amsterdam, vollgepfropft mit Kaufmannsgut, um nach China zu fahren. Oder nach Japan. Nördlich von Asien, durch Eis, Sturm, Ungemach, Gefahr. Es war eine glänzende Ausfahrt gewesen. Der Ehrbare Rat der Stadt hatte fast vollzählig auf dem Kai gestanden. Der Kosmograf und Prediger Petrus Plancius, der eifrige Verfechter dieser Reise, hatte von dem Giebelfenster eines Speichers aus der Ausfahrt beigewohnt, unter kluger Zurückhaltung, wie es sich für sein Amt geziemte. Dagestanden hatten vor allem die Kaufleute Pieter Hasselaer, Dirck von Os und Jan Janszoon Carel, deren Zinn und Sammet und Linnen die Laderäume der Schiffe füllten. Weiber hatten sich am Kai gedrängt, die Mütter der Abreisenden, dort unter dem Schreierturm auf der Buitenkant, Kinder, schaulustiges Volk. Viel Lachen hatte es gegeben, Singsang und Gebete. Und Tränen.
Und nun lagen die Schiffe fest. Es war, als habe man sich, auf große Reise aus, im Haus von den Lieben verabschiedet und sei in den Flur getreten und stünde mit gepackten Truhen an der Tür. So ging es den Schiffen im Schutze der flachen westfriesischen Insel. Sie konnten nicht hinaus auf das offene Meer. Sie lagen noch vor der Haustür, zwanzig kleine Meilen vom mächtigen Amsterdam entfernt, zweitausend Meilen vor dem Ziel. Oder wie viel wohl?
Sechs Tage lebten sie nun auf den Schiffen. Drei nur hatten sie segeln können, drei Tage mit geblähtem Tuch über die Zuiderzee, auf gischtendem Wasser. Dieser Schneckengang! Es war ein Kampf mit dem Wind gewesen. Mit unablässigem Kreuzen hatten sie ihm Meile um Meile abgeluchst, hatten sich durch die ganze Zuiderzee gepirscht und den dreifachen Weg gebraucht bis vor die Inselkette, die sie vom offenen Meer abriegelte. Nun hätten sie so dicht an den Wind gehen müssen, dass es geratener schien, eine Weile unter Anker zu liegen, bei aller Eile, die sie vorwärtstrieb.
Die „Eissee“ war das Schiff des Befehlshabers. Drei Stufen bildeten die Decks bis zum Heck. Die höchste war die „Hütte“. Hier saß Barents und schrieb. Breit saß er auf dem geschwungenen Hocker hinter dem Tisch. Eine Kerze brannte ruhig und stetig. Viele Stunden saß er schon so, hörte, wie die Wache draußen die Glasen schlug, und tauchte bedächtig den Gänsekiel in die Tinte.
Die „Hütte“ war klein, zwölf Amsterdamer Fuß lang und neun breit; eine Kerze genügte, sie zu wärmen. Barents lächelte. Er hätte die Staatskajüte haben können für die Reise, die unter der „Hütte“ lag. Sie besaß eine offene Galerie rings um das Heck und war prachtvoll ausgestattet. Vor ihrer Tür befand sich der Raum für den Rudergänger, was ein weiterer Vorzug war. Aber Barents hatte die „Hütte“ gewählt. Wollte er an Deck, brauchte er nur die Tür aufzustoßen und stand schon am Besanmast. Das ganze Schiff konnte er von hier übersehen. Und er wollte oft an Deck.
Er war ein ernster, selbstbewusster Mann Anfang der Vierzig. Alle anderen an Bord waren jünger. Allein er nahm es mit jedem auf. Sein straff nach hinten gekämmtes Haar war noch voll. Keine Falten durchzogen die eckige Stirn. Der dichte Schnurrbart unterstrich die ausgeprägten Linien, die von den Nasenflügeln abwärtsliefen, und ging in einen das Kinn bedeckenden Spitzbart über. Seine Kraft, seine Jugendlichkeit aber sprach aus den Augen, die groß und grau waren und unbeugsamen Willen verrieten.
Barents hatte nicht schlafen können in dieser Nacht. Die Unruhe hatte ihn hochgetrieben. Er hatte die Schläge der Schiffsglocke gezählt und gehört, wie die Mitternachtswache an Deck gekommen war. Er hatte die Kerze erneuert und hin und wieder geputzt. Nun saß er und blickte zum Fenster, hinter dem bald der Tag grauen würde. Er tauchte den Kiel in das Fässchen, und wieder trocknete die Tinte daran.
„Lieber, ehrenwerter Herr …“, hatte er geschrieben. Vor Stunden, schien es ihm. Er stellt ihn sich vor, diesen ehrwürdigen Herrn und Vater, der kaum älter war als er: Petrus Plancius, der Prediger. Wie er den Brief empfinge, am Morgen nach einer gut durchruhten Nacht. Wie er ihn läse. Sein dicklippiger, breiter, in den gekräuselten Vollbart eingebetteter Mund würde sich nicht verziehen. Seine steilen Brauen würden nicht zucken. Und doch würde er innerlich beben.
Es war seltsam. Von all den vielen Begegnungen mit Plancius drängte sich Barents nun hier in der „Hütte“ vor allem die erste auf: in dem Gemäuer der Alten Kirche, deren Turm nun längst hinter der Kimmung versunken war. Vor dem Altar der Priester Plancius, blass, noch gezeichnet von den Anstrengungen der Flucht aus Brüssel, noch erfüllt von dem eifernden Glauben, mit dem er in flandrischen Dörfern und Städten die Leute zur Lehre des Calvin bekehrt hatte, in den Augen noch einen Funken Hass gegen die Spanier, die ihn verfolgt hatten. Und Barents vor ihm, zwölf Jahre jünger als jetzt in der „Hütte“, mit Anna am Arme. Wiewohl an jenem Tag wenig mehr in ihm Raum gehabt hatte als das schöne Mädchen Anna, so war er doch auch freudig ergriffen davon gewesen, dass ihn gerade ein gehetzter, gepeinigter, von den spanischen Ketzergerichten gejagter Prediger der Anna zum Mann gab: eine nüchterne Vermählung, ohne Prunk, wie es in Calvins Sinne war. Annas schlanke Hand in der seinen; sie zitterte ein wenig, als sie neben ihm kniete. Und hinter ihm der Stadtschreiber Meynart, ihr Vater, gichtig schon, gebeugt, doch sehr glücklich, dass die Tochter den Barents bekam, den Ziehsohn des Handelshauses Os, das würdig vertreten war bei jenem Zeremoniell.
Der alte Os noch, die pfiffigen Augen auf das Paar gerichtet; der Mann, der ihm Vater gewesen war, nachdem der seine in der Stadt Gent als Ketzer hatte hängen müssen. Und daneben, in der Familienbank, der junge Os: Dirck, Spielgefährte und Freund aus der Knabenzeit, dann Bruder und Kamerad im Lernen bei den Magistern, der jetzige Herr des Handelshauses. Oh, die Tochter des Stadtschreibers hatte einen Würdigen zum Manne bekommen, einen Auserwählten.
Barents in der „Hütte“ des Schiffes lächelte. Aber es wirkte bitter. Zwölf Jahre waren lang. Es rieb sich viel ab in dieser Zeit. Bei Anna der Glaube an das Auserwähltsein. Bei Plancius Eifer und Hass.
Das Phänomen Plancius hatte ihn auch in der Folge angezogen, er konnte es nicht leugnen. Als er als Schiffer des Handelshauses Os im Mittelmehr kreuzte, das sich die niederländische Schifffahrt gerade erschloss, als ihn seine alte Leidenschaft ergriff, die von ihm bereisten Meere zur Karte zu bringen, hatte er sich von Plancius beraten lassen. Eines von dessen Werken lag in seiner Truhe, hier in der „Hütte“: die Bibel mit Spezialkarten des Gelobten Landes. Das war der Mann Plancius aus einem Guss, Gott und Natur, Religion und Wissenschaft. Spezialkarten der ganzen bekannten Welt hatte er herausgegeben, gestützt auf die Quellen jener, die ihn verfolgt hatten.
Plancius hatte Barents ermutigt, sein „Kartenbuch von der Mittelländischen See“ herauszubringen, und ihm empfohlen, sich nicht auf die Darstellung der Küsten zu beschränken. Das Hinterland war nicht minder wichtig für einen, der gut Handel treiben wollte; Und er wolle doch die Schiffe des Os zu guten Häfen navigieren, wie?
Barents hatte während der Entstehung des Kartenbuches Mühe gehabt, sich dem zwingenden Geist Plancius’ zu entziehen, der unablässig bestrebt war, ihn sich ganz unterzuordnen, die eigenen Vorstellungen auszulöschen. Er hatte gerungen, dass es seine Karten blieben, von den Ländern, die er bereist und die der Kosmograf Plancius nie gesehen hatte. Er hatte dem angesehenen Gelehrten Zugeständnisse machen müssen in der Art der Darstellung und in Titeln. Im Wesentlichen aber hatte er seine Auffassungen durchsetzen können. Wenn er es überhaupt geschafft hatte, dann hatte er es dem Onkel seiner Frau zu verdanken, der, halb gelähmt zwar, genug Witz besessen hatte zu verhüten, dass Plancius das Werk ganz an sich riss. Mit gutem Grund hatte jener Onkel Cornelius Claes dies getan, als Verleger des Buches nämlich. Fett durch das Unvermögen, sich ausgiebig zu bewegen, bequem, gemächlich, hatte er doch den richtigen Augenblick abgewartet und das Werk perfekt gemacht, schneller, als Plancius es gewollt.
Hatte Plancius damals gelächelt über die hintergründige Eile, mit der sie das Buch auf den Markt geworfen hatten, so würde er auch jetzt nicht zucken. Aber er würde ihn bei Gott und allen Heiligen verfluchen.
Barents legte den Kiel weg und stellte sich an das kleine schräggeschnittene Fenster. Draußen lag die flache Insel, die dunkel blieb, Stunde um Stunde.
Petrus Plancius hatte im Auftrag des Ehrbaren Rates von Amsterdam die Instruktion für die Reise ausgearbeitet. Und Barents, zwanzig kleine Meilen von der Stadt erst entfernt, stand im Begriff, ihm zu schreiben, dass er ebendiese Instruktionen nicht einhalten werde.
Barents griff sich an die Halskrause, die ihm zu eng und steif war. Er trug einen einfachen Rock. Er verzichtete auf die Staatskajüte, auf den Abschied durch den Ehrbaren Rat, auf alle Ehren und Würden. Monatelang hatten die Amsterdamer Herren gerätselt, wie sie diese Reise durchführen wollten. Herausgekommen aber war eine Dummheit.
„Die Schiffe fahren so nördlich wie möglich“, forderte die Instruktion. Das bedeutete praktisch: über den Pol!
Barents lächelte verächtlich. Er hatte keine Furcht vor dem geheimnisvollen Ort, der der Nordpol war. Er würde auch zum Pol fahren, wenn es gälte, den Pol zu suchen. Aufzufinden aber waren China und Cathay und die Japanischen Inseln. Wenn einer zu einem Ziel wollte und schlug einen Weg ein, der nicht zu diesem Ziel führte, dann war der Weg falsch. Zu viele Jahre schon war man falsche Wege gegangen. Barents konnte nicht der Instruktion „So nördlich wie möglich“ folgen. Er wusste den richtigen Kurs!
Nicht ohne Grund war er ausgewählt worden für die Reisen der Amsterdamer nach dem Norden. Er war beschlagen in der Kunst der Seefahrt. Der Herr des Handelshauses hatte damals für die besten Lehrer gesorgt.
Hoch angesehen war Barents bei den Räten der Stadt durch die Verbindung zu Os, wenn ihm auch Neider Halsstarrigkeit und Eigensinn nachsagten. Keinen Kundigeren als Willem Barents hatten sie in ganz Amsterdam gefunden für das gefährliche, fragwürdige Wagnis der Nordreise.
Und der Stapelplatz Amsterdam zählte etwas auf dem alten Kontinent. Seit zwanzig Jahren frei von den Spaniern, hatte sich die Stadt im letzten Jahrzehnt um das Doppelte ausgedehnt, hatte ihre Hülle gesprengt wie eine sich häutende Raupe, hatte sich gestreckt bis zur Heerengracht und schließlich ihre Befestigungen Gracht um Gracht vorgeschoben.
Amsterdam hatte lange im Schatten Antwerpens, der mächtigen Stadt an der Schelde, gestanden. Diese fiel nicht auf einen Schlag. Vor dreißig Jahren begann der Niedergang, als die Ketzergerichte Albas Tausende aus jener konkurrierenden Stadt vertrieben. Vor zwanzig Jahren starben siebentausend ihrer Bürger, als die spanische Furie die Stadt plünderte. Vor zehn Jahren nahm der spanische Regent Farnese nach vierzehnmonatiger Belagerung erneut Antwerpen und vernichtete ihre Blüte endgültig. Verstreut waren die fremden Handelsniederlassungen, zerrissen die so kunstvoll geknüpften Verbindungen nach allen Weltteilen. Lahmgelegt waren ganze Industriezweige. Die Seidenweber wanderten nach England aus, die Diamantenschleifer trugen ihre Kunstfertigkeit Amsterdam zu. Was des einen Tod, ist des andern Brot.
Ein glänzendes Erbe trat Amsterdam an. „Die Auserwähltheit eines Menschen zeigt sich an der Größe seines Arbeitserfolges …“ Man war schon zufrieden mit der Lehre des Calvin! Rührig sahen sich die eckigen, breiten Herren Os, Hasselaer, Carel nach neuen Verbindungen um, nach gewinnbringenden Stapelplätzen. Plancius hatte Erfolg mit seinen Karten; man riss sie ihm aus den Händen. Unbekannte Routen wurden geprüft, Pläne aufgegriffen, die seit einem halben Jahrhundert bestanden: Man wollte nördlich von Asien nach China und Japan segeln. Die Engländer hatten Geld und Mühe in das Unternehmen gesteckt. Vor vierzig Jahren scheiterte Willoughby; wer kannte sein Grab? Drei Jahre darauf gelangte Burrough hoch im Norden des asiatischen Kontinents, dem Lande Tatarien, an eine Meeresstraße zwischen einer öden Insel, Nowaja Semlja genannt, und dem Festland. Man besang diese Straße. Man schrieb Oden auf sie. Man hoffte, dass diese Straße Waigatsch, die man in ihrer Lage zwischen Insel und Festland noch immer nicht genau kannte, das Tor sei nach China.
Und unter den vielen Versuchen, das nördlichste Kap Asiens, Tabin, zu erreichen und dann stracks nach Süden zu segeln, Cathay zu, gab es den eines Holländers: Olivier Brunel. Er berichtete, dass er 1576 mit einer russischen Lodija durch diese winzige Meeresstraße bis zur Mündung eines gewaltigen Stroms vorgedrungen sei, den man Ob nannte.
Als Antwerpen noch nicht ganz am Boden lag, als es Luft holte, um sich wieder zu stärken, als es daranging, seine alte Größe zurückzuerobern – was alles misslang –, verpflichtete ein Antwerpener Kaufmann de Moucheron, die Mücke, den Seefahrer Brunel für eine Reise nach Cathay. Der Holländer gelangte nur bis Nowaja Semlja.
Der Kaufmann de Moucheron aber rettete sein Handelshaus aus dieser dem Untergang geweihten Stadt in die befreiten Provinzen. Er brachte seine Pläne mit. Er betrieb die Durchführung der ersten Nordreise.
Der Prediger Petrus Plancius und die Kaufleute in Amsterdam waren wach genug. Was sich das verhungerte Seeland und die Mücke vornahmen, musste Amsterdam erst recht möglich sein. Zwei von den vier Schiffen, die 1594 schließlich ausliefen, steuerte Amsterdam bei.
Willem Barents in der „Hütte“ der „Eissee“ schmunzelte, als er daran dachte, wie ihm die Herren vom Rat für beide das Kommando angetragen hatten. Damals vor zwei Jahren, Gott, war es schon so lange wieder her? Er kam gerade vom Mittelmeer zurück und hatte nicht recht anbeißen wollen. Sie hatten es verstanden, ihm beizubringen, dass er der Beste sei. Mit Schmeicheleien waren sie gekommen und mit Geschenken für Frau und Kinder. Und die Heuer war die doppelte einer gewöhnlichen Reise gewesen. Aber kaum dies, sondern das Unbekannte hatte ihn gelockt. Wie sah es im Norden von Asien aus? Wo kam das Eis her? Was war mit dem legendären Kältegürtel, den die Riesenströme passierten? Wo lag der Polus Arcticus und der Polus Magnetis?
Damals hatte er noch etwas auf die Instruktion des Plancius gegeben. Freiheit hatte sie ihm ermöglicht, so dass er sich nicht mit Haut und Haar der Seeländer Flotte jener Mücke Moucheron ausliefern musste. Er hatte seine eigenen Vorstellungen von dem Weg nach China gehabt. Er glaubte nicht an das Nadelöhr Waigatsch zwischen Insel und Festland. Wer wusste denn, ob nicht etwa hinter der Waigatsch eine Binnensee läge, rings eingeschlossen von Land, eine Mausefalle, wie? Wo gäbe es dann einen Durchschlupf nach China?
Er hatte auf jener Reise die Waigatsch den anderen überlassen, den Schiffen „Zwaan“ von Seeland und „Mercurius“ von Enkhuizen. Plancius’ Instruktion hatte ihm ermöglicht, mit seinem Amsterdamer Schiff und der alten Terschellinger Fischerjacht einen Weg zu suchen, an den noch keiner gedacht hatte. Dieser Kurs war die Umschiffung der Insel Nowaja Semlja.
Das war eine andere Insel als dies Sandkörnchen Vlie, hinter dem sie nun schon die dritte Nacht lagen. Man konnte sich wahrhaftig bekreuzigen, wenn man an ihren öden Küsten entlangsegelte. Zweihundert Meilen streckte sie sich aus in dem weiten Ozean, länger als die große Insel der Briten. Und immer nördlich.
So war er gesegelt, damals, mit dem Schiff und der Fischerjacht. Bis auf 77 Grad nördlicher Breite war er gekommen, bis zu einer Spitze, die sie das Eiskap nannten. Dort war das Land nach Süden abgebogen.
Barents schritt in der „Hütte“ auf und ab, stellte sich ans Fenster, hinter dem es schon dämmerte, hörte die Wache flüstern, sah auch die Rahen des anderen Schiffes drüben: „Amstelredam“. Ein zweites großes Schiff diesmal, keine Fischerjacht mehr … Barents schnaufte zufrieden.
Bis zum Eiskap war er damals gekommen. War es nun das sagenhafte Tabin? Ging es von hier geradewegs in die Straße von Anian nach China und Japan? Er wusste es nicht. Er hatte es nicht prüfen können. Eis hatte das Schiff bedrängt. Ich komme wieder, hatte er sich geschworen.
Es war auch an der Zeit gewesen festzustellen, was aus „Mercurius“ und „Zwaan“ geworden war. Und siehe da, man traf sie, weit im Süden, und sie konnten berichten, dass sie durch das Nadelöhr Waigatsch hindurch in offener, eisfreier See Meile um Meile zurückgelegt hätten bis hin zur Mündung Ob und darüber hinaus. Wie Brunel! Und wenn sie kräftig mit den Augen geblinzelt hätten, dann hätten sie beinahe schon Kap Tabin gesehen.
Er war damals nicht hart genug gewesen. Er hatte sich übertölpeln lassen. Der scheinbare Erfolg der anderen, die eigene Niederlage hatten ihm etwas vorgelichtert. Mit glücklicher Kunde war die Flotte nach den Niederlanden zurückgeschwommen. Aber die Kunde brachten nicht jene, die in Amsterdam beheimatet waren. Barents erinnerte sich nicht gern daran. Tief atmend stützte er die Hände auf den Tisch und blickte auf das Papier.
Die zweite Nordreise dann hatte unter einem Unstern gestanden. Es begann schon vorher, als ihm sein Kaufherr Os ein anderes Kommando auf „einem gewöhnlichen Schiff mit gewöhnlichem Kurs“ hatte aufschwatzen wollen. Er hatte trotz des lukrativen Angebots abgelehnt, um wieder nach dem Norden zu seinem Eiskap zu kommen. Als man die Nordexpedition endlich ausschickte, war es Juni! Eine Flotte von sieben Schiffen war es gewesen, vier genügten nicht. Und jedes beladen mit Ware. Zwei Amsterdamer wieder dabei, die „Winthont“ und eine Jacht. Er hatte auch für beide das Kommando bekommen, wie er es sich gewünscht.
Aber damit war es schon aus gewesen mit den Wünschen. Die neue Instruktion ließ keinen Raum mehr für Klauseln, Sonderrechte, eigene Forschung. Wo Seeland hinsegelte, hatte auch Amsterdam zu fahren, hatten alle schwer beladenen sieben Schiffe zu schwimmen. Und die segelten eben zu dem Nadelöhr zwischen der Insel Nowaja Semlja und dem Festland, zur Waigatsch. Es hieß freilich nun schon „Straße von Nassau“, benannt nach den durchlauchtigsten Fürsten und Herren, den Grafen von Nassau, die noch ein Dutzend weiterer Titel trugen und von denen Wilhelm der Schweiger die Niederlande im Kampf gegen die Spanier geführt hatte, bis er von einem Attentäter ermordet wurde. Sein Sohn Mauritius war jetzt Statthalter und Kapitängeneral der befreiten Provinzen und Admiral von der See.
Und wiewohl sie durch die neue Benennung des Nadelöhrs zum Ausdruck brachten, dass sie die Reise durchführten zu Ehren der Republik, dass sie zum Schaden der Spanier, die unersättlich auch Portugal an sich gerissen hatten, einen neuen Seeweg nach den begehrten Ländern suchten, so argwöhnte man doch gegenseitig und missgönnte den anderen Provinzen alleinigen Erfolg, den Nutzen des eigenen Handelshauses im Auge.
Mit Zähneknirschen war Barents mitgefahren, hatte an das „gewöhnliche Schiff auf gewöhnlichem Kurs“ gedacht, das er ausgeschlagen hatte. Es kam genau, wie er erwartet hatte. Das Nadelöhr Waigatsch, die Straße von Nassau im Süden von Nowaja Semlja, war verstopft mit Eis. Nicht eine Maus konnte hindurch. Aus war der Traum von der Reise nach China. Der Erfolg von „Zwaan“ und „Mercurius“ war ein Trug gewesen. Und er war darauf hereingefallen und um die Möglichkeit gekommen festzustellen, wie der Kurs nördlich von Nowaja Semlja in Wirklichkeit verlief. Es hatte ihn gebrannt, er hatte davon geträumt auf der beschwerlichen Heimreise. Und auch später, zu Hause. Er war froh gewesen, als er herausfand, dass sich der junge Os durch den neuerlichen Misserfolg nicht schrecken ließ.
„Fahren Sie ein drittes Mal, Barents? Als Befehlshaber zweier Schiffe?“ Von dem „gewöhnlichen Schiff auf gewöhnlichem Kurs“ hatte er nicht mehr gesprochen; es war zu dieser Zeit schon zehn Monate unterwegs.
„Fahren Sie ein drittes Mal?“ – Barents hatte zugesagt. Mit zwei Schiffen nach dem Norden; woran konnte ihm mehr liegen? Nicht mehr der kleine Schiffer und Steuermann eines Handelshauses; ein Admiral mit einer selbstständigen Flotte im Auftrag Amsterdams, wenn man es recht nahm. Dem Auserwähltsein ein Stück näher, so Anna, die es mit ihrem Gott hatte, wenn der Mann über die Wasser fuhr.
Wenn sich nun auch die anderen zurückzogen, wenn die Mücke abschwirrte mit all ihrem Geld, wenn Seeland verzichtete und Enkhuizen Zuschauer blieb: Die Kaufleute Os, Hasselaer, Carei an Amstel und Ij rüsteten zwei Schiffe neu aus, dauerhaft, solide gebaut, größer als die in den Vorjahren.
Denn da lagen ja die Länder von Tatarien, China und die Japanischen Inseln. Und sie waren reich an Gold, Silber, Seide, Zucker, Quecksilber. Und der Weg nördlich von Asien um Kap Tabin herum durch die Straße von Anian nach den begehrten Ländern sollte doch sechsmal kürzer sein als der der Portugiesen um das afrikanische Kap der Guten Hoffnung. Sechsmal kürzer und ohne Zwischenhändler – das lohnte, neue Schiffe in der Binnenamstel vorzubereiten.
Wie konnte man, nachdem so viel Mühe und Geld in das Unternehmen gesteckt worden war, so kurz vor dem Ziel aufgeben und die Früchte anderen überlassen, den Dänen vielleicht oder den Engländern. Oder auch den, Russen. Selber musste man fahren, sich rühren musste man, zumal man einen Mann hatte, der zweimal in jenen Gewässern gefahren war.
Leichter, als er geglaubt hatte, war alles nach seinem Wunsch gegangen. Da jedoch kam der „liebe, ehrenwerte Herr“ mit seiner neuen Instruktion: Finger weg von Nowaja Semlja! Fahrt über den Pol!
Klug hatte Plancius zu reden gewusst, im Rat und unter den Kaufleuten. Er hatte es verstanden, überzeugende Beweise ins Feld zu führen. Nachdem , sich gezeigt hätte, dass das Nadelöhr verschlossen war mit Eis, nachdem sich auch die Insel Nowaja Semlja spröde gezeigt hatte bei ihrer Umsegelung, gälte es nunmehr, einen dritten Weg zu prüfen. So nördlich wie möglich.
Barents wischte den angefangenen Brief vom Tisch. „Lieber, ehrenwerter Herr …“, hatte er schreiben wollen, „ich kenne den Weg. Um Nowaja Semlja herum geht der Kurs. Dort werden wir Erfolg haben. Über den Pol scheitert jedes Unternehmen.“
Es wurmte ihn, dass Plancius ihn wieder zu Zugeständnissen zwingen wollte wie beim Kartenbuch über die Mittelländische See. Nicht er war halsstarrig, eigensinnig, sondern jener, der in seinem wie geleckt sauberen Haus fantasievolle Pläne ersann, ohne jemals auf den Planken eines Schiffes gestanden zu haben.
Er hob den Bogen vom Boden auf, strich ihn bedächtig glatt und nahm seinen Rundgang in der „Hütte“ wieder auf, hin und her, die wenigen Fuß. Wenn der Schiffer Heemskerck unter ihm in der Staatskajüte einen weniger festen Schlaf gehabt hätte, dann hätte er die Nacht durch wachen müssen, wie sein Oberster Pilot und Befehlshaber.
Barents lächelte, ein wenig verschlagen, ein bisschen schalkhaft. Heemskerck schlief den Schlaf der Jugend. Keine dreißig Jahre war er alt, ein Mann mit vornehmem Charakter und einer ausgezeichneten Bildung. Der andere war nicht viel älter, Jan Cornelis Rijp, Schiffer der „Amstelredam“. Jung waren beide, junge Leute brauchte er für sein Wagnis. Wo Heemskerck vorsichtige Zurückhaltung walten ließ, dort setzte Rijp den Mut des Draufgängers ein, was nicht selten zum Erfolg führen konnte. Eine gesunde Mischung.
Barents war schlauer gewesen als Plancius, als der ganze Ehrbare Rat des mächtigen Amsterdam. Er hatte sie alle in die Tasche gesteckt, als sie mit ihrer Instruktion herausgerückt kamen. Und er hatte in einem ungeduldigen, sentimentalen Augenblick einen Brief schreiben wollen!
Er hatte Gelegenheit gehabt, Heemskerck und Rijp lange Zeit sehr genau zu studieren. Sie hatten sich schon den Eiswind um die Ohren sausen lassen und sich gut gehalten dabei, zwar nicht auf der ersten Reise mit all ihren Fährnissen. Beim zweiten Mal waren sie dabeigewesen, bei der Spazierfahrt in die Waigatsch. Es war noch genug Gelegenheit gegeben, dort zu zeigen, was in einem steckte, im Kampf mit Bären und auf der scheußlichen Rückfahrt, als der Winter schneller war als die Schiffe.
Barents lächelte schalkhaft-grimmig, wenn er daran dachte, was es doch für ein schlauer Griff gewesen war, diese beiden dem Konsistorium als Schiffer für die dritte Reise vorzuschlagen. Das war ein Schachzug gewesen, so recht nach seinem Geschmack. Heemskerck und Rijp waren in die Waigatsch nicht als Hochbootsmann, Steuermann oder Offizier gefahren, beileibe nicht. Als Commisse für die Kaufleute waren sie gesegelt, als Verwalter und Behüter der Waren, als Männer, die den Handel mit den Chinesen und Japanesen und Tataren in die Wege leiten sollten, wie sich die Gelegenheit ergab. Nichts hatten sie mit der Schiffsführung zu tun gehabt, keinen Einfluss auf den Kurs, keine Stimme im Schiffsrat.
Diese Männer nun hatte Barents für das höchste Amt auf den Schiffen vorgeschlagen, als Schiffer. Und zugleich als Commisse. Die Kaufleute Hasselaer und Carel hatte er so hinter sich gebracht, die Reeder, deren uneingeschränktes Vertrauen Heemskerck und Rijp besaßen. Auch der junge Os hatte geschmunzelt. Eine großartige Verbeugung, schien es, war das vor den Kaufleuten gewesen.
Es ehrte sie, dass ihre Commisse im Amt stiegen und die Schiffe in eigene Hände nahmen. Barents aber hatte seine Hände frei, hatte den Weg frei für alle Routen, ob sie nun in der Instruktion niedergelegt waren oder nicht.
Heemskerck und Rijp erhielten eine Chance, von der mancher geträumt haben mochte zwischen Amstel und Ij. Er hoffte, sie würden sie nützen mit dem ganzen Eifer ihrer jungen Jahre. Und Dank wissen.
Mit solchen Schiffern, unabhängig von Seeland, Enkhuizen, Rotterdam, fünf Wochen eher als im Vorjahr, lag Barents gut im Rennen. Und mit der verjüngten Mannschaft. Denn waren die Kapitäne kaum an die Dreißig, so zählten sie doch zu den ältesten an Bord.
Junge Leute hatte er anmustern lassen, die das Abenteuer liebten und die Gefahr nicht scheuten. Unverheiratete Männer, die nicht die Liebe zu Frau und Kindern davon abhielt, wenn nötig, das Leben in die Schanze zu schlagen.
Barents, am Fenster, sah auf die Masten des anderen Schiffes im Morgengrauen, hörte das Wasser schlagen, roch den Kerzendunst in der winzigen „Hütte“. Die Liebe zu Frau und Kindern …
Wer von den Ausarbeitern der Instruktion in den festen Mauern der Stadt hatte denn gewusst, wie oft er, Barents, sein Herz in die Hand hatte nehmen müssen. Einmal hatte ihn zwei Tage lang ein spanisches Kaperschiff gejagt, vor der Felsenküste Frankreichs, und nur der Nebel hatte ihn gerettet. An einem Riff im griechischen Meer mussten jetzt noch Planken liegen von der „Lerche“, die er nicht mehr hatte nach Hause steuern können. Die Ladung für Os verloren. Ein Sturm irgendwo hatte den Besanmast der „Wappen von Haarlem“ über Bord gefegt. Mit geprellter Schulter war der Pilot davongekommen. Auf der Waigatsch-Fahrt waren Galion und Bugspriet der „Winthont“ zersplittert beim Zusammenstoß mit dem Schiff „Hoop“ des Vizeadmirals.
Die Liebe zu Frau und Kindern. Und er hatte sein Herz in die Hand genommen, hatte – hinterher immer – an das winzige Backsteinhaus in der St.-Nicolaas-Straat gedacht.
Als er von seiner letzten Mittelmeerfahrt zurückgekommen war, hatte ihm Anna ein Medaillon gegeben, ihr liebes, stilles Gesicht mit großen Augen, die Schicksalsergebenheit ausdrückten, in einem Miniaturbildnis, ein Tuch über dem Haar, die Andeutung einer Haube nur. Wie das junge Mädchen, die Tochter des Stadtschreibers. Ihre Ersparnisse hatte sie zu einem Maler nach Leiden getragen, weil dort die beste Schule sein sollte, wie ihr kunstverständiger fetter Oheim Cornelis Claes wusste. Und damit nicht genug, hatte sie es endlich von dem buckligen Goldschmied in der Ridderstraat einfassen lassen.
Er war sehr gerührt gewesen damals, und er trug es bei sich, wenn er wieder hinauszog. Wer von den Männern, die die Instruktion ausgearbeitet hatten, konnte denn ganz erfassen, warum er vorgeschlagen hatte, nur unverheiratete Seeleute zu nehmen. Wer wusste denn von ihnen, dass er außer diesem goldgefassten Medaillon ein Lederbeutelchen bei sich trug mit den Locken von Dirck und von Jan und von Martin, auch von Neeltgen natürlich, die immer sein Liebling gewesen war, stupsnäsig und frech. Und schließlich eine seidige, ganz helle Locke von Symentgen.
Das waren sechs starke Anker, die ihn an Amsterdam ketteten. Sie hielten ihn zäh, und doch trieben sie ihn wieder hinaus, immer wieder. Ein Seemann war kein Goldschmied, ein Navigator kein Maler. Und der wohlhabende Verleger Cornelis Claes rückte keinen Stuiver heraus für die Familie seiner Nichte, wenn man ihm nicht um den Bart ging. Leiste was, dann hast du was.
Er hatte munkeln hören in all dem Wirrwarr der Vorbereitung dieser dritten Expedition, dass sich der Geograf und Prediger Plancius, der liebe ehrenwerte Herr und Vater, mit einhunderttausend holländischen Gulden an einer Indienreise beteiligen wollte. Barents in der „Hütte“ presste die Lippen zusammen, ächzte, starrte hinaus.
Wenn das mit den vielen tausend Gulden nicht stimmte, so war es doch möglich. Das war die Wahrheit.
Die Wellen des Mittelmeers waren nicht golden für ihn gewesen, das Westerfahrwasser kein großer Fischzug. Wenig genug hatte ihm sein Kartenbuch von der Mittelländischen See eingetragen. Der fette Claes jammerte ihm die Ohren voll, zugesetzt habe er, bei Gott!
Barents fragte sich jetzt in der „Hütte“, wie er nur auf den Gedanken gekommen war, in dieser dritten lausigen Nacht hinter der verdammten Insel herrisch und stolz einen Brief an Plancius zu schreiben: Ich befolge eure Instruktion nicht! – Wie hätte er dieses Schreiben dem Fischer aushändigen können, der schon am Abend zuvor einmal an Bord angelegt hatte, um dem Koch Steinbutte zu verkaufen. Plancius’ Mund über dem gekräuselten Vollbart hätte sich bestimmt nicht verzogen. Aber war es klug, ihn aufzubringen, da die Schiffe noch nicht einmal Holland verlassen hatten? Da man keinesfalls wusste, ob man den Kurs fand? Da auch ungewiss war, ob Neeltgen, Symentgen und die anderen Racker ihren Vater überhaupt wiedersahen?
Er konnte nicht schreiben. Wenn einer ihn als Pilot für die Amsterdamer Nordreisen ausgewählt und dem Rat der Stadt empfohlen hatte, dann war es Petrus Plancius. Wenn einer, nach dem Ausscheiden der anderen Provinzen, bei der Regierung dennoch eine Prämie von 25 000 Gulden für das Finden der Durchfahrt herausgeschunden hatte, dann war auch dies Plancius.
Über den Pol oder Umschiffung der Insel Nowaja Semlja, Instruktion hin und her – das war alles gleich. Nicht geschrieben, es musste gehandelt werden. Nur der Erfolg gäbe ihm recht, gleich, wie er fahren würde. Und wenn er durch die Hölle führe – wenn er so nach China gelangte, wer wollte dann noch mit ihm rechten.
Der untersetzte, gedrungene Mann, etwas zu schwer für sein Alter, setzte sich auf den Hocker und stützte das heiße Gesicht in die Hände. Anna, dachte er. Martin, Jan – alle sechs Namen dachte er. Ein Medaillon und fünf Haarlocken, seidig und blond.
Draußen lag grau der Morgen, das Wasser schwappte an die Schiffe, über der flachen Insel schrien die Möwen. Den Kopf in die Arme gebettet, schlief Barents am Tisch. –
In der Kuhl der „Eissee“ lag der Schiffsjunge. Unter offenem, regenverhangenem Himmel lag er, im Nachtwind, in der Maikühle. Für gewöhnlich schlief er in dem Aufbau, der die Kuhl bugwärts begrenzte, in der Back. Wenn er jetzt fröstelnd im Schutze der übereinandergestellten Beiboote hockte, dann deshalb, weil er Wache hatte.
Der Junge hieß Jan Hillebrants. Er war vierzehn und hatte Kälte nie gescheut, weder auf dem Amsterdamer Fischmarkt, wo seine Mutter feilbot, was die Küstenkähne gerade anlandeten, noch in der winddurchpfiffenen Mühle des Großvaters unweit der Stadt. Eislauf auf gefrorenen Kanälen hatte zu seinen Vergnügungen gehört, Wirbel um Kähne, die das Eis in Fesseln geschlagen hatte.
Sein Gesicht war knabenhaft weich, die Wangen rund, der Mund dicklippig und sein Blick oft verträumt. „Träumer“ hatte die Mutter ihn auch genannt. Sie hatte aber erzählt, bitter, traurig, von seinem Vater, der ein guter Bootsmann gewesen sei und den doch nichts gerettet hätte, als die Spanier das Schiff enterten. Er horchte auch auf, wenn die tuchverhüllten Weiber auf dem Markt davon schwatzten, dass die spanischen Reiter wieder auf Nymwegen zogen oder irgendeinen Flecken verwüstet hatten. Dann hatte er gebebt.
Geträumt aber hatte er von der See.
Was ging über den Hafen, die Schiffe! Vor zwei Jahren hatte er dagestanden, als die Barents-Expedition festmachte. Ein totes Walross hatten sie ausgeladen, ein Ungetüm mit beinernen Hauern, wie es noch keiner in der Stadt gesehen hatte. Schnell war die Kunde herumgelaufen von diesem Meerestier. – Die Wunder der Meere, er wollte sie sehen.
Still lagen die Decks. Das Schiff hob und senkte sich in der Dünung. Backbord, draußen über dem Wasser, pendelte eine Laterne, die am Heck der „Amstelredam“ hing. Nicht zufällig war der Junge dabei. Der Schiffer der „Amstelredam“ war Jan Cornelis Rijp, der Freund seines Vaters.
An einem Aprilsonntag, als sie aus der Alten Kirche in den mit Schnee vermischten Regen getreten waren, hatte seine Mutter gezögert und ihn dann aus dem Gedränge, an Bettlern vorbei, zu einem Mann gezogen, der im Windschatten des Westturmes stand.
„Das ist sein Sohn“, hatte die Mutter mit brüchiger Stimme zu dem Mann gesagt. Jan erinnerte sich gut, wie verwundert er gewesen war. Der Fremde, bärtig und wirrhaarig, hatte ihn bei den Schultern gegriffen und ihm ins Gesicht geschaut. Auch gesprochen hatte er und gelacht. Er war aber sonst sehr verschlossen gewesen.
Jans Mutter hatte sehr ehrfürchtig getan vor diesem Herrn. Allein erst in der niedrigen Kammer, die sie bewohnten, hatte Jan erfahren, dass dies auch ein Jan sei: Jan Cornelis Rijp, der mit dem Vater zusammen gegen die Spanier gekämpft habe. Seinerzeit war dieser Rijp der erste gewesen, von dem sie erfahren hatte, dass ihr Mann Hillebrant nicht mehr lebte. Erschlagen von den Spaniern auf glitschigen Planken in einer Sturmnacht auf dem Fluss Schelde …
Lag der Junge jetzt hier auf der „Eissee“, dann hatte er es Rijp zu verdanken. Der hatte die Zweifel der Mutter beschwichtigt, ihre Ängste zerstreut, sparsam in Worten freilich, aber treffend. Er hatte dem Jungen diesen Platz verschafft. Das war unendlich viel.
Auf dem Halbdeck vorm Großmast lagen drei Bootsleute, die Wache hatten wie der Junge: der knochige Duncker; Evert, der einem kleinen feisten Mönch glich; und Hooghwout, der jüngste nach Jan. Die Mitternachtswache, die schläfrige, schwere. Es galt kein Segel zu kontrollieren, keinen Kurs zu beachten. Nicht waren Riffe oder Kaps auszumachen. Nackt stachen die Masten in den Himmel.
Im Topp schlug die Amsterdamer Flagge. Es dünkte den Jungen, als ob sie schlaffer hinge, als hätte der Nordost nachgelassen. Er lächelte. Er wusste, sie würden bald segeln.
Einmal war ihm, als kämen Schritte. Er reckte sich lauschend, warf einen Blick auf die Laterne der „Amstelredam“, deren Licht ihn beruhigte. Dann stand er auf, mit den Bewegungen einer Katze. Wieder vernahm er das Geräusch, viel deutlicher schon. Er spähte über die Boote.
Auf der andern Seite der Kuhl, an der Reling, lehnte ein Mann. Einen Augenblick glaubte der Schiffsjunge, es sei der Hochbootsmann. Dann erkannte er jedoch Duncker.
Der Bootsmann wandte ihm den Rücken zu und schaute unverwandt über Bord. Aber nicht in die Ferne, sondern auf das leise anschlagende Wasser unter ihm. Er beobachtete etwas. Einen Fisch? Oder die Strömung? Vielleicht döste er auch bloß vor sich hin.
Des Jungen Verhältnis zu Duncker war nicht das beste. Jener war ein Bootsmann Anfang der Dreißig. Listig, verschlagen, berechnend, verstand er sich auf seine Arbeit. Jan hatte wenig Sehnsucht nach einem Schwatz mit diesem groben, mürrischen Mann.
Dennoch trat er entschlossen hinter den Booten vor.
Duncker fuhr auf. „Was schnüffelst du hier herum?“ –
„Ich habe geglaubt, hier ist ein Fremder.“
„Ich kenn einen Fremden an Bord, und das bist du, Jung.“ Dunckers Lachen klang wie ein Krächzen. Die Backenknochen an seinem schmalen Kopf traten stark hervor, seine Nase glich dem Schnabel eines Vogels.
Jan Hillebrants wusste kein Wort zu sagen. Der andere musterte ihn.
„Dachte mir, du schläfst. Habe mich geirrt, das war dein Glück.“
Der Junge fühlte sein Herz schlagen. Duncker gehörte zu jener Sorte, die das winzigste Vergehen eines anderen meldeten. Um zu bekräftigen, dass er keinesfalls geschlafen habe, sagte er rasch: „Der Wind hat gedreht …“
Duncker murrte: „Hab es dem Schiffer gemeldet. Geht alles seinen Gang. Verschwinde.“
Jan, halb im Gehen, griff an die Reling. Seine Finger krampften sich zusammen. Unten schaukelte ein Boot, in dem ein Mann saß. „Hier ist doch ein Fremder“, sagte Jan trotzig.
Duncker starrte ihn an. Dick waren seine Lider, halb über die Augen gezogen. Schläfrig sah Duncker aus. „Du bist mir recht laut.“
Der Alte unten stemmte eine Stange gegen die Bordwand, weil das Wasser ziemlich bewegt war. Er quengelte: „Hol endlich an.“
Duncker warf dem Jungen einen Blick zu. Dann zog er an einem Tau.
Unschlüssig stand Jan Hillebrants. Ihm war nicht sehr wohl. Er hätte ohne ein Wort gehen sollen.
Schläfst du auf Wache, wirst du bestraft. Lässt du ohne Kenntnis des Hochbootsmannes jemand an Bord kommen, geht es dir an den Kragen. Sie hatten auf die Artikel geschworen.
Ein Korb erschien über der Reling. Drei, vier Fische lagen darin. Der Junge atmete leichter. Duncker kaufte Fische.
Das Meergetier lag groß und schlagend im Korb. Das bewegte Wasser stieß das Boot auf die Schiffswand zu. Der Bärtige unten hatte zu tun, es von den Stückpforten abzuhalten. Sein Ruf trieb zur Eile.
Duncker schüttete die Fische in ein Tuch, lachte und ließ den Korb hinunter. Jan blieb beruhigt stehen. Er hatte den Fischer erkannt. Am Vortag hatte jener schon so an der Bordwand gelegen, als der Schiffer dem Koch erlaubt hatte, für die Mannschaft den Fang zu kaufen.
„Hast du noch keine Fische gesehen?“, murrte Duncker. „Du wirst noch Holz kauen auf der Fahrt, das sag ich dir. Du wirst mal nicht mehr wissen, wie frischer Fisch schmeckt, wenn wir erst oben stecken im Eis …“
Jan Hillebrants sah Duncker an. Der Bootsmann kam ihm in diesem Augenblick wie ein Vogel vor. Rasch drehte sich Dunckers Kopf auf dem dürren Hals.
„Was wird mit dem Brief?“, schrie der Fischer von unten. „Der Navigator will einen Brief mitgeben.“
Duncker, plötzlich besänftigt, beschwichtigte den Mann. „Gedulde dich, ruh dich aus. Ich wecke Willem Barents.“ Dies sagte er mit großartiger Gebärde, als sei er zumindest der Schiffer.
Duncker fasste den Jungen am Arm. „Trag die Fische zum Zimmermann. Aber lass dich nicht erwischen!“
Ehe es Jan Hillebrants recht bewusst wurde, hielt er das Bündel in der Hand. Der Bootsmann kletterte schon die Treppe zum Halbdeck empor.
In dem Augenblick schlug die Schiffsglocke. Grau war der Morgen. Acht Glasen. Weit hallten die Schläge. Die Wache war vorbei. Auf einmal fühlte der Schiffsjunge, wie müde er war.
Barents schlief noch immer am Tisch. Es war ein quälender Halbschlaf, ein Dämmern. Jedes Geräusch drang in sein überreiztes Hirn. Laut schlugen die Glasen, acht schmerzende laute Schläge. Vier Stunden nach Mitternacht.
Schritte, ein Klopfen an der Tür, vom Halbdeck her, ein Kratzen und wieder das Klopfen, eine Pfeife draußen, gellend. Dann das leise Schleifen der Tür, das Schnappen der Klinke.
Gerrit de Veer stand überlegend vor dem Schlafenden. „Kommandeur“, flüsterte er, „Admiral …“ Sein längliches Gesicht drückte Überraschung aus, weil er Barents nicht auf dem Lager fand. Er stand unbewegt, hörte auf die Atemzüge des Mannes, für den er sich persönlich verantwortlich fühlte.
Zum zweiten Mal reiste de Veer mit Barents. Im Vorjahr war er dabeigewesen, auf der „Winthont“, als sie die Waigatsch berannten. Barents hatte ihn überrascht, wie er versuchte, ein Tagebuch zu schreiben. Der Navigator, lächelnd über soviel Unbeholfenheit und Mangel an Erfahrung, hatte ihm das eigene Tagebuch der ersten Reise überlassen, und de Veer hatte es studiert, gründlich, in Kältenächten, bei blakendem Licht. Obwohl er kaum etwas verstand von Kartografie und Navigation, war er nun mit seinem Buch vorangekommen.
Aber von dieser dritten Reise, die jetzt verdammt noch mal endlich losgehen sollte, würde er jede herausragende Stunde beschreiben, damit die Nachwelt erfahre, wie sie nach China gelangt waren.
De Veers kleine, rasche Augen fanden den Bogen Papier. „Lieber, ehrenwerter Herr …“ Er war neugierig auf diesen Brief, neben dem Petschaft und Siegellack lagen, als seien sie eben gebraucht worden. Aber Barents’ Arme verdeckten die übrigen Zeilen.
Der kaum zwanzigjährige Mann rätselte, was jener zu Papier gebracht hatte. Mit der sanften Hand strich er sich das Haar zurück, was überflüssig war, da es fest und straff nach hinten lag. Sein Hals war lang. „Gänsehals“ hatten ihn die Jungen der Gasse genannt. Über de Veers schmales Gesicht huschte ein Lächeln. Jetzt weckte der Gänsehals den Befehlshaber der Expedition.
Er berührte Barents an der Schulter. Der Mann am Tisch war sofort munter. Er blickte so hellwach, dass de Veer sich fragte, ob Barents wirklich geschlafen habe.
Barents fühlte sich behaglich wohl. Da stand de Veer, einer der jüngsten, der nun einen Kniefall andeutete, als sei Barents ein Mann von Adel.
Vielleicht steckte in jenem unbekümmerten, unfertigen de Veer, der es trotz Verbotes nicht unterlassen konnte, ihn mit Admiral anzureden, auch ein kommender Kapitän. Einer für die nächste Reise.
„Was gibt’s, Gerrit?“
„Bootsmann Duncker von der Wache meldet: Der Fischer ist da.“
Barents griff sich, besinnend, an die eckige Stirn. „Der Fischer?“
„Der am Abend die Steinbutte gebracht hat. Sie hatten ihn hergebeten für heute früh …“ De Veer berichtete umständlich, obwohl Barents schon nach wenigen Worten im Bilde war.
Der Navigator schob den Hocker zurück und sagte gepresst: „Ich habe keinen Brief für ihn. Sag ihm, es hat sich erledigt.“
De Veer starrte ungläubig auf den Tisch, wo der Bogen lag. „Gut“, murmelte er, blieb jedoch an der Tür stehen. „Er ist eine Meile wegen des Briefes gerudert.“
Barents trat an das Schränkchen und holte einen abgegriffenen Sammetbeutel heraus. „Ist Heemskerck schon wach?“
In de Veers Augen kam Leben. „Der Schiffer weist die neue Wache ein.“ Er nahm die Münze und wandte sich zum Gehen. Da fragte Barents rasch: „Wie ist der Wind?“
„Nordwest …“
„Was!“, schrie Barents und funkelte ihn an. „Seit wann?“
„Seit einer halben Stunde …“
Barents presste sich an den Tisch. Noch nie war es de Veer so deutlich geworden, wie spitz Barents’ Wangen waren. Ein müder, aber zäher Mann, dessen durchdringenden Augen er jetzt gern ausgewichen wäre. Er fühlte sich rau gepackt und an die offene Tür gerissen.
„Da!“, schrie Barents. „Zeig mir die Segel am Mast. Wie viel Fahrt machen wir, he? Wie heißt die Insel dort drüben, wie?“
„Vlie.“
Barents stieß ihn von sich. „Dummkopf.“ Er atmete ruhiger. „Also. Warum wurde ich nicht geweckt? Warum segeln wir nicht?“
De Veer fasste sich an den langen Hals. „Der Schiffer hat gemeint, es ist zu dunkel für das gefährliche Fahrwasser. Auch der Strom läuft schon zu stark.“
Barents unterbrach grob: „Wann hat die Ebbe eingesetzt?“
„Als der Wind sich gedreht hat.“
Mit dem Ebbstrom hätten sie auslaufen können … Das war sein Kapitän Heemskerck, der Vorsichtige, der Zauderer.
Barents fluchte. „Schick den Schiffer zu mir.“
„Jawohl, Admiral!“ De Veer war verschwunden wie ein Hase.
Tief atmend sog Barents an der Tür die kühle Meeresluft ein. Drei Tage hinter Vlie war ihnen noch nicht genug. Sie hatten sich schon an das Faulenzen, an das Schlemmerleben gewöhnt. Steinbutt, frisch aus dem Meer – für den Bauch war das gut. Nach China kam man so nicht. Ungeduldig wartete Barents, bis Heemskerck erschien.
Jacob van Heemskerck, langjähriger Commis des Kaufmanns Hasselaer, neunundzwanzig Jahre alt, stand in der „Hütte“, die er nicht mochte. Die Hütte eines Bauern.
Wann sie segelten, brüllte jener, mit funkelnden Augen und feuchtem Mund.
Heemskerck gab gelassen Antwort. Er wirkte gepflegt mit seinem mageren, edlen Gesicht. Der lange, weiche Spitzbart, der zu den Ohren hin als Backenbart auslief, die hohe Stirn, die mandelförmigen Augen, das ganze selbstbewusste Auftreten des Mannes Heemskerck hatten die schöne Kaufmannstochter Gertrud Hasselaer bei einem der wenigen Empfänge zu jener Frage verleitet, die schnell die Runde gemacht hatte: „Sind Sie verwandt mit den Grafen van Heemskerck?“
Der Commis ihres Vaters, also angesprochen, war nicht verlegen gewesen. Er war alles, was sie wollte. Ein Graf in ihren wunderschönen Augen, bitte. Wer wusste noch etwas von dem alten Segelmacher Heemskerck, der das Tuch für die berühmtesten Schiffe gestichelt hatte?
Er war nach ihrem Willen auch Commis auf der Waigatsch-Fahrt. Sie hatte ihn schon in China gesehen. Als es um den Posten des Schiffers für die neue Reise ging, drängte sie den alten Hasselaer: „Nimm doch den Grafen.“ Und sie sah ihn abermals in China.
Einen launischen Willen hatte die Spröde, doch in seinem Falle eine wunderliche Zielstrebigkeit.
Er hatte auch einen Willen, der war, ihr Gatte zu werden und der Schwiegersohn Hasselaers. Heringsfischer waren Kaufleute geworden. Segelmachersöhne brauchten ihnen nicht nachzustehen. Gelangte er nach China, war er mehr als Graf. Wer wollte noch sagen, dass es eine Missheirat sei, wenn sich der Geldsack Hasselaer mit dem hergelaufenen Heemskerck verschwägerte.
Heemskerck hielt Barents’ Vorwürfen stand. Wann sie segelten? In zwölf Stunden, zur Westersonne, am hellen Tag, rechtzeitig bei auslaufendem Strom, mit einem Wind, wie er nicht besser sein könnte.
„Jetzt, jetzt segeln wir!“, schrie Barents, riss die Tür auf und brüllte den Hochbootsmann an: „Die Leute zum Spill. Anker hoch und ab!“
Heemskerck würgte die Wut hinunter. Die Knöchel seiner Hand traten weiß hervor, so krallte er sich in die Türkante. Jetzt war er nicht der Graf der schönen Gertrud. Jetzt war er der Segelmachersohn, dem ein Gassenjunge sein erstes selbstgetakeltes Schiff zerschlagen hatte.
Er sah Barents nach der Back gehen. Der Hochbootsmann Vos schaute herein. „Wie befehlen Sie, Schiffer?“
Heemskerck sagte tonlos: „Wir segeln.“
Die gellende Glocke schien das Schiff zu verwandeln. Pfiffe schrillten, Rufe hallten von der Backbordseite, wo die „Amstelredam“ lag. Der Junge Jan Hillebrants erschrak, wie schnell das stille Schiff Leben bekam. Er trug das Tuch mit den Fischen.
„Simon, Simon, hoho!“, sang einer. „Kommt raus, ihr Brüder, frische Luft erwartet euch.“
Die Tür der Back öffnete sich. Einer von der Freiwache steckte den Kopf heraus und blinzelte in den Morgen. Schritte polterten, eine Pütz klatschte ins Wasser, jemand lachte. Fern, sehr fern, von Möwen gefolgt, sah Jan den Fischer ziehen.
Als er sich umwandte, entdeckte er den Hochbootsmann. Vom Halbdeck aus beobachtete jener, wie sich die Leute aus der Back trollten. Unwillkürlich duckte sich Jan hinter den Beibooten. Keinen Schritt konnte er mit diesen verdammten Fischen auf Deck wagen. Er saß ganz schön in der Klemme.
Entdeckte Vos Dunckers Fische, waren sie weg auf Nimmerwiedersehen. Dann konnte sich Jan auf die Weiterreise mit Duncker freuen.
Auf einmal bohrte noch ein anderer Gedanke in ihm. Konnte er es überhaupt wagen, seinen Bootsmann Duncker bloßzustellen? Keiner sollte den Schiffsartikeln nach Speise und Trank außerhalb der Mahlzeit fordern! Die Gesetze gingen ihm heute nicht aus dem Schädel.
Kein Sterbenswort konnte Jan Hillebrants sagen, dass die Fische dem Duncker gehörten, diesem Raubtier, das mit ewig hungrigen Augen über die Decks lief. Da würde jener die Beute im Verschlag seines Kumpanen, des schweigsamen Zimmermanns, zubereiten, lecker, lecker, während die anderen auf den Schiffer fluchten, der schon jetzt mit den Rationen knauserte, als müssten sie tausend Tage von dem mitgeführten Proviant leben. Jan duckte sich noch tiefer, während schon das zum Beutel geknüpfte Tuch seinen Fingern entglitt. Mit einem geschickten Manöver hatte Dunker ihn nicht nur zum Mitwisser, sondern sogar zum Komplizen gemacht.
Er fühlte dumpf, dass dies eine Sache war, aus der ihn nicht einmal Jan Cornelis Rijp herausgehauen hätte, den er achtete wie nur einen und den er zum letzten Mal Auge in Auge gesehen hatte, als sie den Eid leisteten auf die verdammten Schiffsgesetze.
Der Junge horchte auf das Rumoren, auf die vielfältigen Geräusche, auf Pfiffe und Befehle und wunderte sich, dass ihn noch keiner hier unter den Booten entdeckt hatte.
Konnte er also bei einer Entdeckung Duncker nicht bloßstellen, dann bedeutete das, dass er als Besitzer der Fische galt.
Jan Hillebrants, Schiffsjunge, wie kam der zu den Fischen? Durch Kauf von seiner lächerlichen Besoldung? Das hätte nicht einmal ein Kind geglaubt.
Hoho, hatte nicht der Koch von einem Fischer am Vortag Ware gekauft? Hatte nicht der Junge zusammen mit Lenaert Hendricks die Körbe in die Vorratskammer unter Deck geschleppt? Jan Hillebrants wurde es heiß. Er schob das nun schon feuchte Tuch mit dem prallen Inhalt an einen Balken, auf dem die Boote ruhten. Wenn der Hochbootsmann den Jungen mit den Steinbutten sah, dann war nicht Gefahr für Duncker, sondern allein für Jan Hillebrants. Dann galt er als Dieb. Der Junge schob die Fische noch tiefer unters Boot und blieb geduckt hocken. Seine Lippen bewegten sich wie bei einem stummen Gebet. –
Der Bootsmann Simon Reyniers von der neuen Wache ging wiegend an den Beibooten vorüber auf die Back zu. Er war ein kräftiger Mann mit einer breiten, buckligen Stirn und Augen, die die Welt gesehen hatten. Er trug einen kleinen Bart unter der Kolbennase, und der Mund über seinem wuchtigen Kinn lächelte vergnügt.
Er beeilte sich nicht gerade, obwohl der Schiffer Heemskerck ihn angetrieben hatte wie einen Ochsen.
Der Hochbootsmann Vos trillerte wie verrückt mit seiner Pfeife auf dem Halbdeck herum.
Der Bootsmann Simon aber lächelte, weil Duncker in der Back noch nicht wusste, dass das Pfeifen auch ihm galt.
Er war Duncker nicht grün. Er mochte die ganze andere Wache nicht. Alles Mögliche hatte man aufgelesen rings um die Zuiderzee und auf diese Planken gestopft. Es gab genug Abenteurer, die die große Heuer reizte.
Mit Duncker war er schon am ersten Tag zusammengeraten, als sie anmusterten. Sie hatten ein Spielchen gemacht, um sich die Zeit zu vertreiben und sich ein wenig zu beriechen. Da hatte er gemerkt, dass Duncker mit gezinkten Karten spielte. Er war schweigend aufgestanden. Unter seinem Blick hatte Duncker die Karten zusammengeschoben und eingesteckt. Mit rauem Lachen hatte er das gewonnene Geld zurückgegeben, saftig scherzend, als fände er das alles sehr spaßig. Es war aber nichts weiter daraus geworden. Schon am nächsten Tag war das Kartenspiel verboten, weil es Streit und Unruhe mit sich brächte. Aber Simon war mit diesem Mann fertig.
Er war an der Back angelangt. Vor noch nicht einmal dem Viertel einer Stunde war Duncker hineingekrochen, um noch eine Mütze voll Schlaf zu nehmen wie die anderen von der Mitternachtswache. Simon öffnete leise die Tür, lächelte und rief behutsam in die Stille der Back: „He, Duncker, komm raus, Junge. Der Morgen ist so schön.“ Dann schrie er los: „Alle Mann an Deck! Wir laufen aus!“
Er hörte einen Fluch. Ein Stiefel schlug neben ihm gegen den Pfosten. „Langsam“, warnte Simon vergnügt, „sonst triffst du noch den Hochbootsmann.“ Dann schlenderte er zurück. Er dehnte die Brust. Die Fahrt begann. Die Reise ging los.
An den Beibooten gewahrte er erstaunlicherweise den Schiffsjungen. „He!“, schrie Simon, „runter zum Ankerspill! Mit Schlaf ist es aus!“
Der Junge sprang wie ein Wiesel von den Booten weg auf die Luke zu, die unter Deck führte. –
Die Ausfahrt belebte alle. Nach dem ermüdenden Segelflicken und Einstroppen von Blöcken und all dem anderen Kram hatten sie nun richtige Arbeit. Keuchend sangen die Männer im Dunkel des Artilleriedecks, als sie den Anker hievten. Schwer drehte sich das Spill. Die Pfeife des Hochbootsmannes Pieter Vos gellte. Die Stimme des Schiffers Heemskerck trieb sie in die Wanten. Heckwärts, vor der Tür der „Hütte“, stand Barents, breitbeinig, heiter. Auf nach China, auf in die Arktis! Jetzt packten sie es, jetzt ging es nordwärts.
Stolz erfüllte die Männer, als der Wind in das erste Segel langte und die „Eissee“ den Bug von der Insel Vlie abdrehte. Lange genug hatten sie hier gelegen.
Backbord schwamm die „Amstelredam“, neu gestrichen vom Heck bis zur Galion. Bei dem Anblick jenes Schiffes, das sie von der „Eissee“ aus in seiner ganzen Größe sahen, dreimastig und voll besegelt, schlugen ihre Herzen höher. Es war ihnen, als stünden sie wohl auf dem Schiff, zugleich aber außerhalb, als ferne Betrachter der Ausreise.
Die Schiffe liefen vor dem Wind auf den Vliestrom zu, der zwischen Vlie und Terschelling die Durchfahrt zum offenen Meer bildete. Groß und flammend stand die Sonne über dem Horizont, ohne Übergang, ohne Morgenröte. Dunkle Wolkenbänke lagen Burgwällen ähnlich darüber. Nachdem es tagelang aus dem Norden geweht hatte, kam nun der Wind vom Kanal her. Über den Atlantik war er gestrichen, hatte sich voll Feuchtigkeit gesogen. Schwer hing es vom Himmel hernieder.
Aber die Schiffe boten einen prachtvollen Anblick. Kastanienbraun schimmerten ihre Körper. Hell hoben sich die Linien der Berghölzer ab. Bauchig wie die Leiber von Fischen, verjüngten sich die Schiffskörper nach oben, trugen die Back und hinter der Kuhl das schmale Halbdeck und darauf, noch höher, ganz am Heck, die „Hütte“.
Die Galionsfiguren wiegten sich rot und gelb über dem Wasser, der schreitende goldene Löwe der freien Provinzen. Bräunlich standen die Segel an den Masten. Man hatte viel Kunst darauf verwendet, die Schiffe zu Ehren des Landes zu verzieren, durch Bemalung und durch Schnitzwerk. Die Kleidermacher hatten neue Flaggen mit den drei silbernen Kreuzen Amsterdams angefertigt.
An alles war gedacht worden, damit diese herrliche Ausfahrt zustande kam. Kein Holznagel, kein Bootshaken war vergessen worden. Suppenkessel gab es und Lunten, Fischpfannen und lange Spieße, Kabel aus bestem Rigaer Hanf. An Musketen hatte man gedacht und an Esslöffel.
Und griff sie ein Kaperschiff an, so konnte man schießen, aus sechs Eisenschlangen und aus vier Steinstücken. Und waren die Fischfässer leer, aß man Pökelfleisch. Und genügten die hervorragenden neuesten Karten nicht mehr, weil sich der Kurs im Dämmer des Unbekannten verlor, dann hatte man jenen unbezahlbaren Mann an Bord, der breitbeinig und guter Dinge vor der „Hütte“ auf dem Halbdeck die herrliche Ausfahrt verfolgte.
Der Tag lag nun grau unter schwammigen Wolken. Das bisschen Streifen Sonne war zu grell. – Allein zwei Glasen nach Ende der Mitternachtswache war die herrliche Ausfahrt vorbei.
Es geschah aber, dass es wie ein Zittern über die „Amstelredam“ lief. Einen Augenblick flatterten die Segel. Zum Entsetzen der Männer drehte sie jäh auf die „Eissee“ zu. Jemand schrie. Im letzten Moment wurde sie von einer riesigen Kraft zurückgehalten. Eine Glocke schlug unablässig. Mit leichter Krängung lag sie im Wasser wie in einem Sturm. Und als dieses Schrägliegende Schiff immer mehr zurückblieb, ohne ihnen zu folgen, ohne seine Lage zu verändern, begriffen die von der „Eissee“: Die „Amstelredam“ saß fest.
Barents umkrallte das Geländer des Halbdecks. „Beidrehen, rasch!“ Heemskerck stand schlank und schmal unweit von ihm, doch erriet er mehr, was Barents herausgestoßen hatte, als dass er es bewusst aufnahm. Mit zwei Schritten war er am Ausguck des Rudergängers, beugte sich hinab und schrie: „Ruder nach Lee!“
Dann winkte er heftig dem Hochbootsmann.
Die „Eissee“ fiel ab. Der Wind traf die Segel schon dwars. Die Bootsleute hetzten. Der Schiffsjunge wurde gegen die Beiboote gestoßen. Er war hilflos in diesem Gewirr. Wie benommen war er, weil ihn hier zum ersten Mal die Furcht anrührte, die „Eissee“ könne ohne die „Amstelredam“ davonsegeln, weiter, immer ferner.
Endlich brassten sie die Großrah. Der Hochbootsmann schimpfte, gelb im Gesicht. Die Fock schlug einen Augenblick, dann griffen auch hier die Taue an und holten sie über. Das Schiff drehte, bis es auf neuem Bug am Wind lag. Die „Eissee“ hielt gerade auf die unbewegliche „Amstelredam“ zu, näherte sich vorsichtig und wendete abermals.
„Loten!“ Unablässig gellten die Befehle. Sechs Faden Tiefe nur noch, fünf Faden, vier. Die „Eissee“ ließ den Bug durch den Wind laufen, wendete erneut. Dann strich sie die Segel. –
Wieder stand Heemskerck vor Barents in der „Hütte“. Der Oberste Pilot hatte ihm nicht erst einen Sitz angeboten. Mit einem Wink hatte er de Veer hinausgeschickt, der gegangen war mit einer tiefen Reverenz, aber mit Unmut im Blick.
Höflichkeit war fehl am Platze. Es gab nicht viel zu reden. Es gab nur zu sagen, dass nichts auf die Vorschiffe, in die Backs zu dringen habe an Gerüchten und Mutmaßungen, wie das Unglück geschehen sei. Ein Unglück, ja, aber ohne menschliches Versagen. Ohne Schuld des Kapitäns Rijp. Darüber mochten sie schwatzen. Mehr war von Übel.
Barents hatte es gesagt, und Heemskerck stand vor ihm und wartete auf Weiteres. Und doch höhnte es in ihm: Rijps Schuld? Menschliches Versagen? Er schaute den Navigator aufmerksam an.
Jetzt war ein wenig Triumph in dem Manne Heemskerck, ein kleines Rechten, ein Quäntchen Schadenfreude. Aber er ließ diesen Triumph, dass man mit der Abreise lieber doch gewartet hätte, nicht in seine Mandelaugen vordringen. Er atmete nicht schneller. Er musste sogar wider Willen jedem Wort Barents’ zustimmen.
Er war lange genug als Commis des Hasselaer auf der Nordroute gefahren, nach dem Stapelplatz Wardhuys und auch ins Weiße Meer, um zu wissen, wie sich Uneinigkeit der Schiffsführung auf den Erfolg der Reise auswirkte. Einheitlichkeit der Leitung! Darum ging es. Der Alte machte es ihm sauer. –
Barents blickte Heemskerck spöttisch an. Das waren sie, seine jungen Kapitäne. Der Zauderer verzögerte die Ausfahrt. Der Draufgänger lief, um als erster den Vliestrom zu gewinnen, so dicht unter Land, dass er strandete.
Schweigend standen sie sich gegenüber, musterten sich. Und in beiden erhob sich die gleiche Frage: Was wird sie uns erst bescheren, die Arktis, die eisige See?
Heemskerck unterbrach endlich die lastende Stille. „Das kleine Boot wird schon zu Wasser gelassen.“
Es waren zwei Beiboote in der Kuhl, die größere Pinasse und dann noch das kleinere Boot, das irgendeiner Bock getauft hatte. Der Name hing ihm nun an, immer und ewig. Man hatte sie ineinandergestellt, um Raum zu sparen, und auf Pfosten gehörig festgezurrt. So lagerten sie breit auf der Gräting, dem Gitter, durch das der Pulverdampf aus dem darunterliegenden Artilleriedeck und der Rauch der Kombüse abziehen konnte.
Die Boote waren bereits etliche Jahre an der Küste Hollands entlanggeschwommen, waren Scharen von Heringen und Schollen zum Verderben geworden. Keiner wusste, durch welche Verwicklungen, Schachzüge, Pläne diese alten Fangboote an Deck gekommen waren, warum man den Holzbildhauer für die Galionsfiguren reichlich entlohnte und an den Booten knauserte.
Der Bootsmann Simon riss die geteerte Leinwand herunter, die die Boote abdeckte. „Du fährst mit hinüber!“, schrie der Hochbootsmann. „Wohl, wohl“, gab Simon zurück, bereitwillig, obgleich er nicht gerade ein Freund des Hochbootsmannes war.
Trocken, ausgemergelt, saftlos war der Hochbootsmann Vos. Ihm schien es die Galle unter die Haut getrieben zu haben bei den vielen Flüchen, die er sein Leben lang ausgestoßen hatte.
Dass Simon mit hinüberpullen konnte zur „Amstelredam“, war fast eine Auszeichnung. Er merkte es an den Augen der anderen. Tätig sein musste man. Die Tage hinter Vlie hatten auch ihn gelähmt.
Er sprang von dem oberen Boot herunter und zerrte die Persenning hinter sich her. Sein Blick fiel gerade auf Jan, den Schiffsjungen.
„Pack zu“, knurrte Simon.
Jan Hillebrants bückte sich nach der Persenning, sie aufzuwickeln.
„Warum bist du nicht am Spill?“, wollte Simon wissen.
„Ich war in der Kombüse.“ Es klang aufsässig.
„Na und? Läufst am Spill vorbei, wenn du an Deck steigst. Und am Spill wird jede Hand gebraucht.“
Der Junge arbeitete schweigend.
Simon herrschte ihn an: „Schlepp das zur Reling. Aus dem Weg damit!“ Unwillig packte der Junge zu.
Der Hochbootsmann Vos fing den Jungen ab. „Ladetakel los!“ „Ladetakel los“, wiederholte leise Jan Hillebrants.
Simon war versöhnt mit dem Hochbootsmann Vos. Den Jungen kurierte man nicht mit Schlägen. Vos hätte den Jungen mit einer Handbewegung zum Spill jagen können. Aber er war schlauer. Er sagte einfach: „Ladetakel los!“ Und bewies damit dem Jungen, dass er ein Taugenichts war, der nicht das Salz aufs Brot verdiene. Denn find mal das Takel!
Jan Hillebrants sputete sich. Er sprang an die Bordwand und schaute in die Wirrnis des Tauwerks hinauf. Zwischen Fock und Großmast musste sich das Takel spannen. Es hielt in der Mitte einen großen Doppelblock. Aber viele Blöcke hingen in diesem Netz wie gefangene Fliegen. Die Brassen und die Schote der Fock und die Halsen des Großsegels führten an die Reling der Kuhl, an die Kreuzhölzer und Nagelbänke zu beiden Seiten. Ladetakel dagegen gab es nur eines. Es kam darauf an, aus diesem Spinnennetz den richtigen Faden zu greifen.
„An der Treppe“, zischte der Untersteuermann Claes Andries neben dem Jungen.
Jan warf dem Vorgesetzten einen schnellen Blick zu, in dem sich Dankbarkeit und Erstaunen mischten. Im Nu stand er an der Treppe zum Halbdeck, fand den unteren Block des Takels, hakte ihn aus dem Ringbolzen und zog das Tau zu den Booten. Das alles war das Werk weniger Augenblicke.
Der Untersteuermann hing das Takel in das kleine Boot ein, stolperte bei seiner Turnerei, fing sich, lachte. „Fertig.“
Jetzt kam Leben in das bartlose Gesicht des Hochbootsmannes. Er kniete sich auf das Deck und schrie durch das Gitterwerk zum Spill hinunter: „Anziehen!“ Rauch aus der Kombüse waberte um ihn.
Langsam straffte sich das Takel. Das kleine Boot ruckte und stieg dann aus dem großen heraus. Heemskerck und Barents beobachteten von den Schotten des Halbdecks aus das Manöver. Der Zimmermann stellte den Werkzeugkasten ab. Duncker, Simon, alle schauten hinauf. Der Bock hing schon drei Fuß über der Pinasse.
Zufällig streifte Simons Blick den Jungen. Jan Hillebrants, mit seinem unschuldigen Kindergesicht, sah nicht auf das Boot. Er beobachtete die Männer.
Erste Tropfen, vom Wind gepeitscht, klatschten auf das Deck. Der schwebende Bock schaukelte sanft.
Simon presste sich an die Pinasse, um den Bock wegzudrücken. Er stemmte die Knie gegen die geklinkerten Planken, stieß mit dem Fuß nach, um das Gleichgewicht zu bewahren. Rot lief sein Gesicht an. Langsam bewegte sich der Bock an dem Takel.
Simon trat einen Schritt weiter, vorgebeugt, um die schwebende Last neu zu fassen. Da zog er den Fuß jäh zurück. Etwas Weiches, Nachgiebiges hatte sein Fuß berührt. Etwas Ekles.
Simon hielt inne. Er trat einen Schritt zurück, da ihm die bauchige Pinasse den Blick nach unten versperrte. Was lag unter der Pinasse? Was hatte seine Stiefelspitze berührt? An der Bohle, auf der die Pinasse lastete, lag etwas Blaues, ein Tuch, wie er bei näherem Hinsehen gewahrte. Ein prall gefülltes Tuch, dessen einer Zipfel aus der Verknotung gerutscht war. Ein Tuch mit Fischen.
Falten gruben sich in Simons Gesicht. Der Junge sah auf ihn, angstvoll. Nur der Junge stand mit Simon auf dieser Seite der Pinasse. Nicht zufällig also hatte sich der Schiffsjunge hierher gestellt.
„Weiter“, drängte der Hochbootsmann von der Back aus.
Simon richtete sich auf. „Es ist verdammt warm“, sagte er durch die Zähne. Er knöpfte die Jacke auf, zog den einen Arm heraus, dann den anderen, langsam, bedächtig, überlegend. Dann warf er die Jacke vor den Kiel der Pinasse, an die Bohle. Auf die Fische.
Erneut stemmte er sich gegen das schwebende Boot, mit offenem Hemd, im Wind, im Nieselregen.
Der Bock an dem Takel rutschte langsam über die Reling. Duncker griff zu, auch der Zimmermann. Endlich hing das Boot über dem Wasser. „Ab!“, schrie der Hochbootsmann.
Wiegend ging Simon zur Pinasse zurück. Der Junge stand wie vordem. Jetzt erinnerte sich Simon, dass sich der Junge schon am Morgen an den Booten herumgedrückt hatte, als er gegangen war, Duncker aus der Back zu treiben.
Simon fröstelte. Sein Hemd war nass am Rücken. Kühl blies der Wind. Er bückte sich nach der Jacke, schlug sie um das Tuch mit den Fischen und hob alles auf.
Langsam ging er zur Backbordseite, abgewandt von den Männern und dem zu Wasser gelassenen Bock. Er schob, von seinem breiten Kreuz gedeckt, die Jacke über die Reling. Der Beutel glitt heraus und platschte ins Meer.
Ein wenig blieb Simon noch stehen, die Arme auf die Jacke gestützt, fröstelnd. Er spie in das Wasser. Von den Fischen und dem Tuch war nichts mehr zu sehen.
„In den Bock, Simon, los!“, gellte es hinter ihm. Verdrossen fuhr der Bootsmann in die Jacke, die nach Fisch roch. Der Junge war aus der Kuhl verschwunden.
Gelassen schwang sich Simon in den Bock. Er legte sich kräftig in die Riemen, und das Boot schnitt durch die Schwappwellen und brachte Barents und Heemskerck an Bord des gestrandeten Schiffes.
Spät kam Simon Reyniers zurück auf die „Eissee“. Die Männer löffelten die Abendsuppe, viel Wasser, wenig Fleisch, weil da irgendeiner die Hand auf den Fresstonnen hatte in der Meinung, wenn die Schiffe stilllagen, konnten auch die Mägen ausruhen. In der Kuhl saßen sie, den Rücken an die Back gelehnt.
Sie murrten, weil sie den Bock wieder an Deck hieven sollten, und schlangen hastig. Die Dunkelheit drohte ihnen über den Hals zu kommen. Der Koch räucherte die am Vortag gekauften Fische; der Duft war im ganzen Schiff.
Der Hochbootsmann trieb sie weg vom Essen; sie trabten ums Spill. Das Takel zurrte den Bock aus dem Wasser. Triefend hing er daran, und die Blöcke knirschten.
Als sie weiteressen wollten, war die Suppe kalt. Claes Andries, der Untersteuermann mit dem schönen Gesicht, dessen Haut frauenhaft zart war, ging verlegen vor ihnen hin und her, fluchte auch, was im Kontrast zu seinem Äußeren stand, und der Junge Jan trug die Suppenschüssel weg.
Sie murrten und schielten zu Andries, und sie wussten doch, dass dieser keine Schuld trug, ja, dass er oft ausglich, wo der Hochbootsmann Vos, dieser gelbe Fuchs, zu scharf war. Doch musste die erste Wache schon antreten.
„Sie sind erst von der ,Amstelredam‘ gekommen, Reyniers“, sagte Andries langsam. „Ich stecke Sie diese Nacht in die Mitternachtswache, und der Junge geht jetzt für Sie …“
Simon lachte verächtlich. War er etwa so schlapp, dass er weniger taugte als der Junge? – „Nein“, sagte er, „nein“. Die Stunden auf der „Amstelredam“ hatten ihn Kraft gekostet, bei Gott. Er hatte tauchen müssen, um zu sehen, ob das Ruder unter Wasser Schaden erlitten hatte. Aber er sagte: „Nein!“ Auch ging die See grob, als sie zurückpullten, und die „Eissee“ hatte noch einmal ihren Standort gewechselt, um nicht zu nahe bei dem auf Grund gelaufenen Schiff zu liegen.