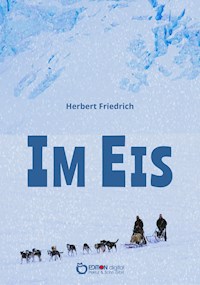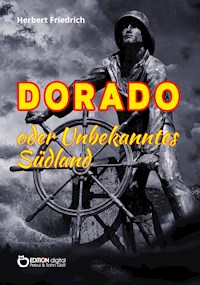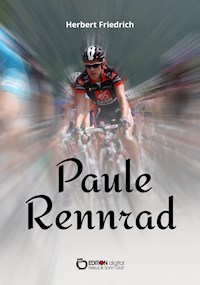7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Eine dramatische Geschichte um den sportlichen und sozialen Aufstieg des Radrennfahrers Otto Pagler in den 1930er Jahren - packend verwoben mit dem unaufhaltsam sich ausbreitenden Spinnennetz nationalsozialistischer Machtentfaltung. Reales Vorbild ist der Kölner Bahnrennfahrer Albert Richter (1912-1940) - Weltmeister 1932 im Sprint der Amateure, als Berufsfahrer dann siebenfacher Deutscher Meister und zweifacher Vizeweltmeister -, der seinem jüdischen Manager die Treue hielt und der für seine Standhaftigkeit mit dem Leben bezahlte. Ein tiefgründiger, vielschichtiger Roman, der die bis tief ins Private vordringende Indoktrination durch die Nationalsozialisten begreifbar werden lässt, der viele nicht standzuhalten vermochten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Herbert Friedrich
Sieben Jahre eines Rennfahrers
Eine Radsportkarriere im Dritten Reich
ISBN 978-3-68912-020-7 (E-Book)
1971 erschien im Kinderbuchverlag Berlin „Der Kristall und die Messer. 7 Jahre eines Rennfahrers“. Der vorliegende Roman ist eine vom Autor selbst überarbeitete Neuausgabe, basierend auf seinem 1971 erschienenen Titel.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta unter Verwendung eines von der KI erzeugten Bildes.
2024 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
Mit einem Nachwort von Elmar Schenkel
DAS BUCH KRONE: September 1932 bis Februar 1933
1 KRONE TELEFONIERT
Dieser Septembertag hielt für Simon Krone alles bereit, das große Glück und die tiefe Niedergeschlagenheit. Es begann schon am Morgen, als er sich rasierte. Da klopfte es an die Badtür. Gleichzeitig gellte die Stimme seiner Wirtin: „Herr Krone, für Sie.“
Krone fühlte sich unausgeschlafen. „Bin gleich fertig“, brummte er, wobei er Seifenschaum in den Mund bekam. Er wischte sich die Lippen und wollte wissen, ob es die Post sei.
„Das Telefon!“ – Es klang, als wolle die alte Brettschneider ihn verspotten. Die halbe Nacht hatte er herumtelefoniert, hatte eine komplette Armee in Bewegung gesetzt, die ganze Stadt auf die Beine gebracht, hatte einen Mokka getrunken, um sich munter zu halten, und hinterher natürlich nicht schlafen können. Das Herz! Wenn man über die Fünfzig war, wurde diese Hetzjagd ganz einfach zu viel.
Und nun hatte er das Klingeln gar nicht gehört. Zwei Stockwerke tiefer rasselten Straßenbahnen, Autos hupten da Pferde an; es war eine belebte Ecke, Köln, Poststraße 1.
Krone ahnte Unheil an diesem sonnigen, geräuschvollen Septembermorgen. Dabei konnte jeder seiner gestrigen Gesprächspartner eine harmlose Rückfrage haben. Er wischte sich den Schaum aus dem Gesicht, das Bärtchen unter der Nase kam zum Vorschein. Eilig trat er in den langen, nach Mottenpulver riechenden Flur. Frau Brettschneiders runzliges Gesicht drückte Zufriedenheit aus, als sie ihm den Telefonhörer hinhielt. Sie bemutterte ihn seit fünf Jahren.
„Krone“, sagte Krone, rieb sich den haarlosen Schädel und starrte Frau Brettschneider an. Unter diesem Blick schlich sie zurück in ihre Küche, auf Zehenspitzen, als ginge sie auf Stelzen.
„Nun, was ist“, zischte er ins Telefon. Auf der Zunge schmeckte er immer noch Seife. Eine Frauenstimme sprach auf ihn ein; es kratzte in der Hörmuschel. Dann redete ein Mann. Erst beim dritten Satz bekam Krone mit, dass es der alte Petraschke war, der Rennbahndirektor, hoho!
Krone legte los, noch ehe der andere zum Zuge kam. „Wenn was schiefgeht morgen, dann fang lieber gar nicht erst an zu reden. Morgen Nachmittag Punkt 16.15 Uhr rollt der Schnellzug Rom-Köln in den Hauptbahnhof, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und darin sitzt Pagler. Du hast doch über Nacht noch nicht vergessen, wer Pagler ist, wie? Das ist der Weltmeister, sag ich dir, Weltmeister“, Krone kostete das Wort aus. „Das ist der, der dir die Butter aufs Brot verdient und noch ein Säckel Geld bringen wird. Und ich als sein Trainer, ich alter Ochs, der drei Tage eher von Rom zurückgekommen ist, damit hier alles klargeht, ich alter Esel, ich sage dir: Wenn das nicht ein picobello Empfang wird morgen für unseren Weltmeister, den Otto, dann hat es gehagelt.“
„Beruhige dich“, schnaufte es vom anderen Ende der Leitung.
„Fahnen, Blasmusik, Menschen, alles muss her.“
„Wird alles, wird alles“, ächzte die Stimme.
„Reporter, Zeitungen, Fotografen. Es ist eine Schande, wie man hier rumhetzt.“
„Natürlich. Du hast ja recht.“
„Ich habe den Oberbürgermeister überzeugt, dass er seine Sitzung morgen Nachmittag vertagt, damit er zum Bahnhof kommen kann. Da können nicht bloß zehn Leute auf dem Vorplatz rumkrauchen. Zehntausend! Es gibt ja genug Arbeitslose in dieser schönen Stadt. Aber heute, heute muss es rein in die Zeitung, dass Pagler morgen kommt.“ Krone holte Luft und fuhr sich über die halb rasierte Wange. Der eintrocknende Seifenschaum juckte ihn.
„Ich bitte dich, ich beschwöre dich“, ächzte Petraschkes Stimme aus dem Hörer, „wir haben alles getan, was wir nur konnten, und es würde ja auch alles klappen morgen …"
„Es würde klappen?“, warf Krone drohend ein. „Das heißt …?“
„Pagler kommt schon heute.“
Krone hielt den Hörer von sich ab und starrte darauf. „Brettschneidern, einen Stuhl.“ Ächzend saß er da, schob ihren mütterlichen mageren Arm weg, der ihm ein Glas Wasser reichte. „Ach, Brettschneidern, man ist ganz einfach für so eine verdammte Hatz zu alt.“
Dann sprach er mit der ruhigsten Stimme ins Telefon: „Sag das noch mal, Fritz. Er kommt schon heute? Wie hängt denn das Ganze zusammen?“
2. EIN ZUG FÄHRT DURCH DAS LAND
Der Rom-Express fegte inzwischen bereits durch die Oberrheinische Tiefebene kurz vor Rastatt, elf gut gefederte, wunderbar schlanke D-Zug-Wagen. Der Kaffee in den Tassen im Speisewagen stand dort ebenso ruhig wie etwa auf dem breiten Tisch des Gastwirtes Ludwig Schopp im Kölner „Goldenen Anker“. Der Weltmeister Otto Pagler schlürfte mit Behagen das heiße, starke Getränk.
„Verschütten Sie Ihr Bier nicht, Keßmeier“, sagte er zu der offenen Zeitung ihm gegenüber. Riesenformat! Keßmeier tauchte dahinter auf, wettergebräunt, lächelnd. „Lesen ist meine alte Leidenschaft.“ Er zog die Lippen zu einem Grinsen breit und rettete sein Bierglas. Zwei seiner Schneidezähne waren aus Gold.
„Was gibt’s Neues?“, wollte Pagler wissen.
„Von jedem etwas. Kraut und Gemüse.“ Keßmeier lachte gern, man sah es ihm an. Pagler schätzte ihn auf dreißig und hatte anfangs gedacht, Keßmeier sei auch Sportler, Ruderer etwa, schlank, muskulös. Nur passten die goldenen Zähne nicht dazu, obwohl nicht einzusehen war, warum ein Ruderer nicht auch einmal ein schadhaftes, goldausgebessertes Gebiss haben konnte.
Keßmeier trank das Bier aus. „Im Grunde steht nie was Neues in der Zeitung. Tausend Mark Strafe für Hitler oder vierzehn Tage Haft, weil er die Zeugenaussage in einem Meineidsprozess verweigert hat. Einfach nicht geantwortet hat der Bursche auf die Fragen des Verteidigers. Der war nämlich Jude.“ Keßmeier lachte. „Na, ist das was Neues, wenn Hitler gegen die Juden ist? Das ist nichts Neues, denk ich.“
Belustigt hörte Pagler auf Keßmeiers leichten Plauderton wie auf eine angenehme Begleitmusik zu dieser Fahrt. Er blickte über die wenigen Mitreisenden, ein Dicker mit Schnauzbart in der Ecke, zwei sportliche junge Damen, sah hin und wieder in der Scheibe sein mattes Spiegelbild, rundköpfig, mit straff gescheiteltem Haar.
Je weiter er in dieses Deutschland hineinfuhr, desto unwirklicher erschien es ihm, dass er in der Ewigen Stadt Rom auf der Radrennbahn die Elite der Welt geschlagen hatte. Mit neunzehn Jahren! Es war, als hätte ihn der gewaltige Wall der Alpen, den er diese Nacht durchquert hatte, von jenem Ereignis abgeschnitten.
Keßmeier schimpfte auf den Eisenbahnfahrplan, der ihn zwänge, zwei Landesgrenzen in einer Nacht zu überschreiten. Diese ewigen Störungen durch den Zoll; er sei hundemüde. Dann las er weiter.
Pagler stellte schmunzelnd die Tasse ab. Er war froh, dass er mit Keßmeier reisen konnte. Keßmeier war der erste Journalist gewesen, der es fertiggebracht hatte, ihn nach dem Sieg zu interviewen. Das Regenbogentrikot hatten sie ihm übergestreift, der Siegerkranz hatte noch nicht einmal richtig auf seinen Schultern gelegen, da hatte Keßmeier schon seinen Bericht auf dem Block gehabt, für die „Allgemeinen Neuesten Nachrichten“, eines der größten Blätter Deutschlands.
Keßmeier schlug mit der flachen Hand auf seine Zeitung. „Wissen Sie, wie lange Griffin und Mattern über den Ozean geflogen sind? Achtzehn Stunden von Harbour Grace quer über den großen Teich bis nach Berlin. Und wir hier in diesem Zug …" Er hob das Glas. „Die doppelte Zeit für ein Fünftel der Strecke. Sein Fluchen wirkte wie Spaß. Er trank. „Na, Sie sind auch Flieger, Pagler, Flieger auf der Radrennbahn. Den Fliegern gehört die Zukunft.“ Er haschte dem vorbeischlingernden grauköpfigen Kellner zwei Kognaks vom Tablett und stellte einen vor Pagler. „Auf die Flieger.“ Sie tranken, der Kellner runzelte die Stirn, und da er stehen geblieben war, bediente sich Keßmeier noch einmal vom Tablett. Diesmal tranken sie Brüderschaft. „Prost, Hermann!“ „Sehr zum Wohl, Otto!“ Schnaps am frühen Morgen, er brannte in der Kehle, der Zug sang, der Dicke in der Ecke rief gell nach dem Kellner.
Pagler fühlte sich sauwohl. Mit fröhlichen Augen schaute er zu, wie Keßmeier den Kellner begütigte; das Trinkgeld war hoch.
Keßmeier ist ein Glück, dachte Pagler, ein Glücksfall sondergleichen, einen solchen Mann zu treffen, wenn man am Anfang einer Laufbahn stand. Ein aalglatter Hund, denkt Pagler, aber ein Reklamemann durch und durch, der nützt mir, der bringt mich weiter.
„Rastatt.“ Der Journalist wies auf die Häuser draußen, Gärten mit Obstbäumen, weit hinten irgendwo der Rhein und blass in der Sonne die Höhen.
Keßmeier schaute ihn forschend an. „Wie fühlst du dich, du Heimkehrer, ehrlich. Wie du so heimkommst als Held, was, Junge, großartig. Du bist zu beneiden.“ Er rieb sich die Hände, die Stadt Rastatt huschte hinter den Scheiben vorbei, Festung und Kirche, ein halbes Dutzend Fuhrwerke an einer Bahnschranke.
In dieses Rastatt war einer heimgekehrt, kürzlich, alle Zeitungen hatten es gebracht; heimgekehrt von dort, wo der Pfeffer wächst, von der Teufelsinsel Cayenne nach vierzehnjähriger französischer Kriegsgefangenschaft. Er hatte, auf Korsika geboren, auf deutscher Seite gegen Frankreich gekämpft, was ihn vierzehn Jahre gekostet hatte.
Der Rennfahrer und der Journalist dachten daran, als jenes Rastatt vorbeiflog, als da ein gewisser Pagler heimkehrte, ein Weltmeister.
Hatten sie jenen armen Hund empfangen wie den lieben Gott selber – was er verdiente –, so würde heute keine Menschenseele in Köln auf Pagler warten. Denn er war trotz der Instruktion des alten Haudegens und Trainers Krone einen Tag eher in den Zug gestiegen. Keßmeier hatte weiß Gott wo den letzten Schlafwagenplatz für ihn aufgetrieben, ein Wunder ohnegleichen. Und dann waren sie gefahren.
Pagler hatte es in Rom nicht mehr ausgehalten. Reisen wollte er, Bewegung brauchte er; Rennen wollte er bestreiten, seine Kräfte messen. Noch diese Woche startete er in England. Oder in Belgien. Krone würde es klären.
Er lachte sich ins Fäustchen, weil er ihr gestrenges Protokoll durcheinanderschüttelte. Ehrung wie ein Fürst nach einem minutiös eingeteilten Zeremoniell! Vor einer Woche noch hatte sich kein Mensch nach ihm umgeschaut. Sieben Monate lang hatte ihm keiner vom Arbeitsamt auf sein ehrliches Gesicht hin eine Stelle verschafft. Ein Stempelbruder wie Millionen. Wie Millionen, dachte Pagler. Und nun wollten sie jubeln, wenn sie nur seine Nasenspitze zu sehen bekamen.
Er schaute Keßmeier an. Jener zog lachend die Lippen breit. Die Goldzähne blitzten. „Kein Mensch weiß, dass ich komme“, sagte Pagler.
Grinsend stopfte Keßmeier die Zeitung in den Abfallkorb. Die Stadt kannte Paglers Ankunft genau. Der Journalist Keßmeier hatte am frühen Morgen von der Grenzstation aus mit Rennbahndirektor Petraschke telefoniert.
Der Zug stieß gegen den Main vor. Eine lange Reise hatte er hinter sich. Die Lokomotiven hatten gewechselt. Mit doppelter Bespannung hatten sie die Wagen über Alpenpässe, durch stickige Tunnel gezerrt. Ein Tag war darüber hingegangen, eine Nacht, und immer noch rollte der Zug.
Indessen beschwor in der Stadt, der der Zug zustrebte, der Trainer Krone, schlank, schmal, sehnig trotz seiner fünfzig, den Gastwirt Ludwig Schopp, den Saal mit sechzig Tischen und das entsprechende Essen einen Tag eher zur Verfügung zu stellen. Der schwammige Schopp mit dem Stiernacken strich sich über die Schürze und schüttelte immer nur den schweren Kopf. „Mann, wie du dir det so denkst. Du kommst geloofen, und der Schopp hoppt. Heute ist Versammlung hier im Saal, heute wird nischt mit deinem Fest. Morgen, ja. Morgen geht alles in Butter.“
Krone fluchte, was nichts für empfindliche Ohren war, und jagte zum Rathaus. Natürlich sagte auch der Oberbürgermeister ab.
Krone hätte sich die Haare gerauft, hätte er noch welche besessen. Der ganze Radklub „Blitz“ stand kopf, weil sein Mitglied Pagler den höchsten Titel geholt hatte.
Rennbahndirektor Fritz Petraschke, mit Vollbart, in dunklem, zweireihigem Anzug, die Hände vor dem Bauch, diktierte der knochigen Sekretärin die letzten Sätze seiner Begrüßungsrede.
Der Zug mit Pagler glitt längst durch das Engtal des Rheins unterhalb Mainz und folgte akkurat jeder Flusswindung. Die Stunden flogen. Krone telefonierte, lief sich die Hacken ab, Blumen, Presse, Sportverband. Das war eine Hatz! Er lachte, nahm den Strohhut ab und wischte sich die Glatze. Es war alles in Fluss.
Robert Wendel, an der Stadtgrenze, der ehemalige Schrittmacherkönig, zwängte sich hinkend aus der Enge seines Fahrradgeschäftes, schloss die Tür ab und nahm die nächste Bahn zum Hauptbahnhof.
Der Rennfahrer und arbeitslose Schlosser Krickow holte die Vereinsfahne aus dem Schlafzimmerschrank.
Sioux Kaufmann flimmerte noch einmal die Trompete.
Als der Zug Bonn passierte, setzten sie sich schon in Gang, aus den Vororten kamen sie, aus den umliegenden Gemeinden. Wie zu einer Prozession zogen sie aus, wie zu einem Rosenmontagszug waren sie auf den Beinen. Im Schneckengang passierten die Straßenbahnen den Bahnhofsplatz. Zwanzig Minuten vor Ankunft des Zuges leitete die Polizei die Kraftwagen und Pferdefuhrwerke über die Marzellenstraße um, weil die Menge auf dem Platz beängstigend wuchs. Dann setzte Kaufmann im Blasorchester die Trompete an die Lippen. Nach anderthalbtausend Kilometer Fahrt fuhr der Zug in den Bahnhof ein, pünktlich auf die Minute.
3 ANKUNFT
Als Otto Pagler in dem einrollenden Zug mit seinen beiden gelben Lederkoffern in der Nähe der Tür stand und die Menschen draußen sah, ahnte er noch nichts. Das änderte sich schlagartig, als die Kapelle einsetzte, dröhnender Marsch unter den Stahlrippen der Halle. Durch das Rumpeln der Wagen und die blecherne Musik hindurch hörte er sie schreien. „Allheil!“ „Hurra!“ Sie hatten ihn erspäht, bevor der Zug stand.
Pagler schlug das Herz im Halse. Er schluckte und setzte die Koffer ab; er taumelte einen Schritt nach vorn. Da wurde die Tür schon von draußen aufgerissen. Urplötzlich saß er auf ihren Schultern. Er konnte nicht mehr denken. Er lachte, schrie selber, wie sie schrien, winkte hoch von ihren Rücken herunter mit beiden Händen, in denen er auf einmal Dahlien hielt, riesige Sträuße. Er konnte nicht einmal denken, wie sie es fertiggebracht hatten, seine Ankunft zu erfahren.
Die Pauken dröhnten, der Radfahrerwalzer schmetterte durch die Halle, Lokomotiven pfiffen und Polizisten. Blumen flogen ihm entgegen. Er gelangte wieder auf den Boden, stand unversehens drei Schritte vor Petraschke, der mit prachtvollem grau meliertem Bart und Schirmmütze würdevoll dreinblickre.
„Im Namen des Deutschen Rennfahrerverbandes begrüße ich den Mann, der für unser Vaterland, für unsere Vaterstadt das schönste Geschenk aus Italien mitbringt: den Titel eines Weltmeisters.“ Dann kamen aus Petraschkes redegewohntem, breitem Mund alle jenen schönen gedrechselten Sätze, die er der Sekretärin diktiert hatte.
Hundert Hände drückte Pagler währenddessen, verlor seine Dahlien, erhielt neue. Hoch über den Köpfen der sich drängenden Menge schwankten Blumensträuße, halb zerdrückt, reif für ein Herbarium.
Mensch, Mensch, dachte Pagler, lächelnd mit seinem kindlichen Gesicht, neunzehnjährig, übervoll von einem unbeschreiblichen Glücksgefühl.
Einer stieß ihn an, buschige Brauen unter einem Kahlkopf. „Da bist du, Junge, verdammt, das Ohr reiß ich dir ab. Kaum hat er den Titel, da hat er schon Allüren wie ein Star.“ Glücklich wandte sich der Trainer an die Umstehenden, dann schloss er Pagler in die Arme.
Der sagte: „Ach, Simon, ihr seid ja alle toll.“
Er fand sich in einem Auto wieder, ein hochfeiner Kutschwagen ohne Pferde, Kopf an Kopf drängte sich die Menge um den langen Kühler, klopfte an die Scheiben. Der Fahrer hupte, der Motor vibrierte. Krone sagte: „Nischt wie fort, Mann, gib Gas.“
Etwas Feuchtes fuhr Pagler übers Genick, er betastete unwillkürlich die Stelle, da fasste er eine Hundeschnauze. Das Tier lag fiepend hinter ihm. „Benimm dich, Hasso“, sagte Krone.
Da merkte Pagler – das Gefährt ruckte schon an –, dass er nicht in einer x-beliebigen Kraftdroschke saß. Hasso war der legendäre Windhund des ebenso berühmten Stehers Kurt Nagel. Und Nagel, die eine Hand am Lenkrad, die andere auf der Lehne vor Paglers Nase, schimpfte auf die Leute. „Der Ruhm ist unser Brot“, ächzte Nagel und wedelte mit der Hand; ein Stein blitzte an seinem Finger.
Nun fährt mich sogar Nagel, dachte Pagler, Krönung des Empfangs sozusagen, der Sieger unzähliger Rennen hinter Motoren, der in allen Ländern Europas Gefragte. Die Freunde mehrten sich schlagartig.
Die Straße war nun weniger belebt. Nagel fuhr den Wall entlang, am Gefängnis vorbei und dann auf den Ring. „Jetzt haben wir es geschafft“, krächzte er. Es bezog sich nicht auf die Menschenmassen oder auf die Flucht in diesem Automobil. Es war die Gratulation des erfolgreichen Stehers.
Pagler schob geduldig die Pfote des Hundes zur Seite. „Wohin fahrt ihr mich eigentlich?“
„In der ‚Pappschachtel‘ haben wir ’ne kleine Zusammenkunft organisiert, weil das Bankett im ‚Anker‘ ausfallen muss. Du machst einem schon Arbeit.“
Pagler schwieg mit einem leisen Bedauern. Dann bat er: „Bringt mich erst mal nach Hause.“ Unerwartet rasch stimmte Krone zu. Ehe man die wichtigsten Leute in der „Pappschachtel“ zusammengetrommelt hatte, floss noch allerhand Wasser den Rhein hinunter.
„Wo wohnst du?“, knurrte Nagel am Steuer.
„Richtung Viersdorf, an der großen Weberei, Straße Am Werk.“
„Auf der Salatgasse wohnt er“, witzelte Krone.
Nagel lachte. „Salatgasse, wieso?“
„Dort schießen die Kinder nur so empor. Wie die Salatköppe, verstehst du.“
,Arbeiterviertel also“, sagte Nagel.
Pagler gab zurück: „Was denkst denn du?“
Krone kicherte. „Auf der Salatgasse werden die Eierkuchen nur auf einer Seite gebacken.“
„Quatsch“, sagte Nagel und hupte eine Katze an.
„Auf der anderen Seite stehen nämlich keine Häuser.“
Krone riss einen Witz nach dem anderen. Der Hund fiepte in Paglers Nacken, 1a-Stammbaum. Über Kopfsteinpflaster ging es, an einem Dutzend Pferdewagen vorbei. Jetzt bin ich daheim, dachte Pagler glücklich. Der allerletzte dieser vielen Hundert Kilometer. Jetzt bin ich da. Herrgott, wo sind denn bloß meine Koffer.
4 DIE SALATGASSE
Im Erdgeschoss eines Mietshauses, das Zigarettenreklame quer über dem Giebel zeigte, zwischen schadhaftem Putz und Haustür lag ein älterer Mann auf einem Kissen im Fenster und starrte auf die schwarz lackierte Droschke. Er blinzelte gegen die Sonne, dann verschwand er so hastig, dass das Kissen in den winzigen Vorgarten fiel.
Pagler schaute hoch im Aussteigen; hinter allen Fenstern standen sie jetzt. Das Auto wendete, geriet um ein Haar in den Landgraben, der Rückwärtsgang krachte, der Windhund stieß die Schnauze gegen die Scheibe. „Vergiss die ,Pappschachtel‘ nicht!“, brüllte Krone. Dann knatterte das Automobil davon.
Als Pagler auf die Haustür zuging, stand dort schon der Mann vom Fenster. „Junge, dass du schon da bist.“ Sein schmaler Mund zitterte.
„Komm rein, Vater.“ Pagler nahm den Mann am Arm. Tausende hatte man auf die Beine gebracht am heutigen Tag. Aber dieses Haus in der Straße Am Werk, in der schäbigen Salatgasse, war allen schnuppe gewesen. „Na, komm schon“, sagte er rau und trat durch die Haustür.
Es roch nach Wäsche in der Wohnküche; Frieda Pagler rannte aus dem Bad herbei, wo Wasser dampfte. In ihrem blutvollen, runden Gesicht lächelte der Mund; sie wischte sich eine Träne aus den Äugelchen. „Sag bloß, bist du‘s wirklich.“
Pagler hockte auf dem Holzstuhl, die Hände auf der Wachstuchdecke, Müdigkeit in den Beinen, als hätte er die Alpen zu Fuß überquert. Er äugte umher, als habe er all dies noch nie gesehen; der Kachelherd, das Rohr über der Tür, das in den Schornstein führte. Ein Topf mit Kaninchenfutter kochte, der Geruch widerte ihn an.
Das Gesicht des Alten war durchsichtig blass, das Haar ging ihm aus, die Schläfen waren ergraut. Sechsundvierzig Jahre zählte Kurt Pagler. „Ich dachte, ihr seid gar nicht da“, meinte Otto.
„Wo sollen wir sein, Junge? Däumchen drehe ich den ganzen Tag.“
Otto taute auf, er sah der Mutter zu, wie sie hantierte. Die ewig geschonten Hochzeitstassen stellte sie auf den Tisch; es roch nach Bohnenkaffee, und sie entschuldigte sich, dass nun freilich der Kuchen noch nicht gebacken sei. „Däumchen drehen wir“, wiederholte der Vater. Dann schlurfte er hinaus, um das Kissen aus dem Vorgarten wiederzuholen.
Mutter sagte, während sie das Butterpapier abkratzte: „Nun hast wenigstens du es geschafft mit deiner Radrennerei. Vielleicht geben sie dir nun ’ne Arbeitsstelle, wo doch dein Bild in allen Zeitungen war.“
Frieda Pagler war versöhnt mit dem Radsport; das viele Geld hatte sich ausgezahlt.
Sie schob ihrem Mann Kaffee hin. Der Alte trank gierig.
Seit vier Jahren hockte der alte Pagler zu Hause, Möbeltischler war er gewesen vor dem Weltkrieg, kaiserlicher Soldat sodann, in Frankreich und Russland. In einer Baumwollweberei hatte er sich anlernen lassen; zehn Jahre Weber. Und jetzt zu allem zu alt.
Vater saß ihm gegenüber, dünn und hustend. Er stand nicht einmal auf, als es klingelte, sondern ließ Mutter wetzen. „Das ist Christian.“
Pagler war neugierig auf den Bruder, jetzt, nachdem auch er etwas geworden war. Aber nur Blumen brachte die Mutter, rote Astern von Schneiders gegenüber, und einen Napfkuchen von der alten Klipphahn, die ihn gebacken hatte, weil sie den Besuch ihrer Tochter erwartete. Eine kleine Geburtstagskarte, billiger Druck, darauf mit Bleistift: Das Haus grüßt den Weltmeister. Pagler strich über die Schrift.
„Siehst abgespannt aus“, sagte Frieda Pagler besorgt, „leg dich nur bald bisschen hin.“ Der Mann gab ihr heimlich Zeichen, den Jungen nicht zu bemuttern.
„Ich muss dann bald fort“, entgegnete Pagler und dachte an die „Pappschachtel“. Frieda Pagler fielen die Hände herab. Sie ging gleich nach ihrer Wäsche schauen.
„Läufst fort, kommst wieder“, brummte der Alte und rückte den Kaninchentopf vom Feuer. „Bist ein Zugvogel, bist du, wirklich.“
„Ich bliebe heute lieber hier, ich kann aber den Krone nicht sitzenlassen. Die Beine hat er sich wegen mir abgelaufen. Das Bankett im ‚Anker‘ habe ich ihm schon vermasselt.“
„Der ,Goldene Anker‘!“ Kurt Pagler kam sichtlich in Fahrt. Darauf sprang er an, das war sein Stichwort! „Das ist schade, dass du nun nicht dort sitzen kannst.“ Er lachte auf. „Kreuztürken, Bankett dir zu Ehren in dieser verfluchten Kneipe. Und damals haben sie uns dort rausgeschmissen, mit Kind und Kegel.“ Er trat ans Fenster und fluchte auf den beleibten Tronicke, der damals Ankerwirt gewesen war.
„Suflknodde hat uns das bisschen Gerassel gefahren, auf seinem dreckigen Kohlenwagen. Nicht mal abgestaubt hat er’n für uns, nicht mal das waren wir noch wert. Die ältesten Gäul hat er vorgespannt, ein blindes und ein lahmes. Und die Leute haben gestanden. Ab ging die Fuhre.“
Frieda Pagler, eintretend, musterte misstrauisch ihren Mann. Dann räumte sie das Geschirr vom Tisch.
„Was, Muttern, hast dich zu Tode geschämt; geheult hat sie, wahrhaftig. Nun lach, nun lach; nun ist er Weltmeister, der Otto. Nun machen sie für ihn ein Bankett, dort, wo sie uns rausgefeuert haben.“ Der alte Pagler kicherte und hatte vor Erregung völlig vergessen, dass das Bankett eben nicht stattfand. Auch wusste er kaum, was das war, ein Bankett; ein noch nie dagewesenes Fest jedenfalls, eine Sühne für tausend ertragene Schmähungen.
Kurt Pagler war noch nicht am Ende. „Schau dir die Fenster über’n Saal an, wenn du dort vorfährst. Das waren unsere.“ Lange war’s her, noch während der englischen Besetzung, Tommys auf den Straßen, Krieg verloren, Inflation mit Millionenmarkscheinen für jeden Bettler. „Schau sie dir an!“
Ein Glas zerklirrte. Zornig wandte sich Frieda Pagler um. „Du schwatzt wieder, Mann, du greinst immer noch den beiden winzigen Löchern hinterher. Jeden Abend Bumstrara von unten aus dem Saal, Pauken und Trompeten, wie hast du geflucht. Und die Betrunkenen grölend durch die Straßen. Und jetzt greint er immer noch wegen der Wohnung im ,Anker‘.“ Sie schob die Scherben zusammen.
„Zankt ihr euch?“, fragte es von der Tür her. „Oder seid ihr taub, dass ihr so brüllen müsst?“
„Christian, du“, sagte Otto erleichtert. Der Bruder trat herein, dürr und hakennasig. Er blickte von einem zum anderen. „Besuch aus Italien“, scherzte er. Dann knipste er das Licht an, mit der Sicherheit des Mannes, der die Rechnung bezahlt.
Er gratulierte Otto ohne viel Worte; das war diesem am liebsten. Seine Hand war rissig von der ständigen Berührung mit Zement und Kalk. In irgendeinem Park baute er eine Villa für einen Pelzhändler.
Er griff Ottos Tasse, schlürfte den lauen Kaffee und sagte angesichts des Kuchens: „Hier geht’s zu wie auf ’ner Hochzeit.“ Er packte die Thermosflasche auf den Abwaschtisch. „Mit all dem Krach wie bei ’ner Hochzeit. Dabei weißt du, Vater, dass du dir’s selber eingebrockt hast, wenn du nicht mehr im ,Anker‘ sitzt. Du hast die Fahne rausgehängt, fünf Jahre Oktoberrevolution, rote Fahne am ,Goldenen Anker‘; wie hast du gewienert und gesägt an dem Messingstern. Ich habe immer gedacht, wozu der Stern, und dann saß er auf der Fahnenstange.“ Es klang alles wie Hohn.
Dennoch kicherte das dürre Männlein Pagler. Eine vergnügliche Erinnerung war es für ihn. Kein Autobesitzer hatte an jenem weit zurückliegenden Tag vor dem „Anker“ gehalten, kaum eine Droschke. Die rote Fahne hatte die Gäste davongetrieben.
„Und dann hat er uns wegen Geschäftsschädigung den Prozess machen lassen, der Hund“, fluchte er erneut los. Er überwand es nie. Am Abwaschtisch goss er sich den Rest Kaffee ein. Einen ehrlichen Menschen vor Gericht gezerrt, aus der Wohnung gewiesen, die Tommys hatten gelacht. Aber nun, aber nun kam man wieder in den „Anker“, Otto voran, hoch soll er leben. Nun wurde alles weggewaschen. „Hol ein Krügel Bier, Frieda, wir heben einen, wenn der Otto im Anker“ sein Bankett hat. Nun verzeih ich sogar dem Tronicke.“
Otto lachte, aber es würgte ihn dennoch. „Tronicke ist lange unter der Erde. Und im ,Anker‘ ist das Bankett nicht, zum Donnerwetter. Und wenn du Durst hast, Vater, ihr kommt doch alle mit in die ‚Pappschachtel‘; ihr seid dazu genauso eingeladen wie ich.“
Draußen flammten Gaslaternen auf. Der alte Pagler wirkte plötzlich noch kleiner. „In deine ,Pappschachtel‘ geh mal allein. In den ‚Anker‘, ja, da hätt ich mich hingesetzt, so breit wie ich bin.“ Er drückte die dürftigen Schultern vor.
Kauend sagte Christian: „Im ‚Anker‘ seid ihr alle nicht gefragt. Da gehen heute ganz andere Leute hin, ganz andere.“
Pagler sah von einem zum anderen, und als er in ihre Gesichter blickte, spürte er, dass keiner von ihnen mit in die „Pappschachtel“ käme. Es verdross ihn, sie noch einmal einzuladen. Die Mutter rannte nach der Wäsche, der Vater schlurfte nun selber mit seinem Bierkrug davon, zur „Eiche“ an die Ecke.
Er musterte den älteren Bruder. Fremd war ihm auch der.
Resolut sagte er: „Ich geh jetzt mal los.“ Halb im Zorn hängte er sich den Sakko über.
Christian stürzte den Kaffee hinunter. „Ich muss auch fort.“
„Ist das eine Zeit“, barmte Frieda Pagler, als sie kam, das Kaninchenfutter zu holen.
Bis zum Fleischer Kasparek gingen sie in der aufkommenden Nacht gemeinsam die Salatgasse vor.
Otto sah des Bruders hageres Profil. „Warum packst du das auf Vaters Kreuz, verdammt, dass wir damals aus dem ,Anker‘ ausziehen mussten?“
„Das habe ich ihm nicht vorgeworfen. Ich habe ihm vorgeworfen, dass er die Fahne vergessen hat, für die er dort rausgeflogen ist.“
„Die Fahne, die Fahne“, höhnte Pagler in plötzlichem Ausbruch. „Die Fahne kann er auch nicht fressen!“ Er ging grußlos davon.
5 DER „GOLDENE ANKER“ STEHT NOCH
Pagler lief an kleinen, in Gärten stehenden Häusern vorbei. Die Straße war aufgerissen, Pflastersteine lagen da, am Absperrbock brannte eine rote Laterne. Es war schön, so durch den Abend zu gehen und die kühle Luft zu atmen, und es war bedrückend, in jener Wohnküche in der Salatgasse zu sitzen. Die Baustelle nahm kein Ende.
Vielleicht sollte er hier einmal den Polier abpassen, ob er ein paar Tage mitschaufeln dürfe. Keinen Groschen haben, dem Bruder auf der Tasche liegen, es war bitter.
Sandhaufen bedeckten den halben Fußweg. Langsam stieg Pagler über das Geröll. Er hatte Christian nicht gefragt, was jener heute Abend vorhabe, Tanz oder ein Mädchen oder irgendwo Skat. Aber es kränkte ihn maßlos, dass Christian an seinem Ehrentag andere Dinge für wichtiger halten konnte.
Er erreichte den Königsplatz und hätte sich nun eigentlich nach links wenden müssen, um über den Gondelweg die Rennbahn und die Sportkantine zu erreichen. Er ging aber kurz entschlossen in entgegengesetzter Richtung. Dort lag nach wenigen Schritten hinter einer Biegung das Gasthaus „Goldener Anker“.
Es streckte sich behäbig mit seinem dreieckigen Giebel, auf dem eine Steinkugel thronte. Die Rollläden der Fleischerei waren herabgelassen, doch die Fenster des ebenerdigen Saales waren erleuchtet. Blasmusik drang heraus, gelles Lachen, und dann die Strophe eines Frontliedes, ein wüstes, unverständliches Geschrei. Weiter hinten, unter Bäumen, abgerückt von der Straße stand das Kino an der Wiese, durch die der Landgraben floss. „Anker-Lichtspiele“ flammte es über den Plakaten. „Der Herr der Wildnis“ spielten sie; einen Film über einen Gorilla.
Pagler stand auf der gegenüberliegenden Straßenseite unter Bäumen in der Dunkelheit und schaute auf jenes lebendige Haus hinüber. Vater und Bruder hatten sich an der Fahne erhitzt, die einst über dem Saal gehisst worden war, ein fünfzackiger Stern aus Messing. Aber für Otto hatte der „Anker“ eine völlig andere Bedeutung gehabt. Film um Film hatte er in diesem Kino gesehen, Pat und Patachon und Charlie Chaplin, den Forscher Livingstone im afrikanischen Urwald und den Boxer Tom Jordens in amerikanischen Kampfringen. Ohne einen Groschen hatte Otto die Filme zu sehen bekommen, von den besten Plätzen aus, Loge ganz hinten. Weil der Pächter des Kinos, Ludwig Schopp, einen Sohn besaß, der mit Otto zusammen die Hosen auf der Schulbank abgewetzt hatte. Ein Bürschlein, mit dem man Pferde stehlen konnte. Livingstone am Landgraben waren sie gewesen und Tom Jordens auf der Aschengrube.
Vor den „Anker-Lichtspielen“ standen Leute, schwarz gegen die erleuchtete Fassade; aus dem Saal drang unentwegt Gesang.
All das gehörte dem Ludwig Schopp, nachdem Tronicke kurz nach der Inflation pleite gegangen war. Hochgerappelt hatten sich Schopps, kein Forscherruhm für den Freund Erich, kein Tom Jordens in ruhmreichen Kämpfen. Aber eine solide Grundlage: Hausbesitz, Geld, Ansehen.
Otto löste sich vom Zaun, trat in den Lichtkreis der Laterne und überschritt die Straße. Ein Mann in Hitlers brauner Uniform, die Daumen unter dem Koppel, stand breit in der Eingangstür und musterte Pagler.
„Hast du mal Feuer, Kamerad?“, fragte der SA-Mann und rückte zur Seite.
„Ich rauche nicht“, gab Pagler zurück. „Ziemlich kühl heute, was?“
„Uns wird noch heiß werden“, lachte der braune Mann. Er wippte auf den Zehen und blickte an Pagler vorbei auf die Straße. Drei abgerissene Burschen schlenderten heran, sie sangen schon jetzt.
„Rechts, rechts die Stufen hoch, dort ist der Saal“, rief der SA-Mann. Doch Pagler betrat die Gaststube.
Nur wenige Tische waren besetzt, der Ventilator summte, der Raum war dennoch verräuchert. Pagler hasste diese Luft, die einem den Atem nahm. Er schaute sich um. Weinreklame, gute Gewächse, Scharlachberger, Bocksteiner, Girlanden mit Papptrauben. An drei Tischen saßen Männer. Sie spielten Karten, die Mützen aus der Stirn geschoben, Pfeifen im Mund. Pagler kannte keinen.
Er trat zum Ausschank, wo ein Junger in blauem Strickwams und Leinenschürze Bier aus einem Fass zapfte: Erich. Nicht Livingstone, nicht Tom Jordens – ein Brauknecht bist du geworden, dachte Pagler, als er den Freund in der alten Tracht sah.
Der Wirtssohn hob den Blick, ein verschmitztes Gesicht. „Was wünschen Sie?“ Und im gleichen Atemzug: „Ja, das ist doch die Höhe, der Otto!“ Erich drehte das runde Tablett am Griff und ließ eines nach dem anderen der darauf stehenden zylindrischen Gläser volllaufen, während er zugleich an dem Bierfass vorbei Pagler die Hand schüttelte. „Welch Glanz in unserer bescheidenen Hütte! Ludwig! Der Weltmeister ist da!“
Pagler hörte belustigt, wie Erich den Vater mit Vornamen anredete. Der Wirtssohn drehte den Hahn ab und schwenkte den Bierkranz hinüber zum Skattisch. „Leute, schmeißt die Karten hin! Trinkt ’nen Schluck auf den Weltmeister.“
Die Männer lärmten; Otto hatte auf einmal auch ein Stangenglas in der Hand, stieß mit jedem an, trank.
„Hast ihnen gezeigt, wie man im Rheinland Rad fährt, wie?“
„Was mir met die Händ mach, das macht Otto met die Been.“
„Und mit dem Kopf“, spottete Pagler.
Er war froh, als sie von ihm abließen, und hockte sich an den runden Tisch in der Ecke. Erich ließ Bier Bier sein und setzte sich dazu, wobei er die Augenbrauen hochzog. „Ich habe es im Radio gehört“, sprudelte er heraus. „Ludwig hat so’n Ding gekauft, Blaupunkt, 186 Märker. Es hat geknackt in dem Kasten, halb verrückt hat es mich gemacht. Und du warst doch im Endlauf. Ich hab nicht gewusst, hat der Mozzo dich geschlagen, oder hast du den Mozzo geschlagen. Da habe ich die Italiener pfeifen hören, da konnte der Mozzo nicht gewonnen haben. Am nächsten Tag war dein Bild in der Zeitung.“ Erichs Gesichtsausdruck verdüsterte sich. „Mich frag nicht, Otto, es geht, wie es geht.“ Er rieb die schwarzen Knöpfe an seinem Wams.
„Lass dich ans Herz drücke“, dröhnte es hinter ihnen. Ludwig Schopp stand da, der Wirt, in ebensolchem Strickwams wie der Sohn, mit einer gleichen Schürze, nur dicker.
Pagler stand auf. „Ist schon gut, Herr Schopp.“
Der Wirt balancierte eine Platte. „Hier, von der Frau. Du musst bei Kräfte bleibe, Jung, willst noch viel Renne fahre.“ Kalter Braten, ein halbes Schwein.
„Das schaff ich nie“, warnte Otto. Dann begann er zu essen.
Schopp entschuldigte sich, dass er dem Krone den Saal hatte verweigern müssen, wo es doch ein Höhepunkt gewesen wäre in der Geschichte des ,Ankers‘, Bankett für einen Weltmeister. Aber nun jage ja eine Versammlung die andere, vom Bienenzüchterverband bis zu den Soldatenvereinen. Ludwig Schopp lachte meckernd, Erich zog ein saures Gesicht.
Pagler hob den Blick von seinem Schweinebraten. Martha Schopp stand, die Hände vor der fleckigen Schürze, in der Küchentür. Fröhlich grüßte er hinüber. „Sie füttern mich fett!“ Martha gab den Scherz zurück, wackelte zum Ventilator und stellte ihn ab. Vom Saal herüber drang der Lärm umso lauter.
„Gerade ist der Redner gekommen“, erklärte Martha, als sie das Geschirr vor Pagler abräumte. Ihr graues Haar war sorgfältig gelockt und mit einem winzigen Häubchen gekrönt. Marschtritt dröhnte, als zögen ganze Heere in die Stadt. Im Saal trampelten sie mit den Füßen. „Die sind wieder ganz närrisch“, tadelte der alte Schopp.
Martha Schopp rief dem Mädchen etwas zu, das aus der Küche herüber nach dem Kellerschlüssel fragte. Sie schimpfte auf das Personal und hippelte davon. Erich sprang weg, um erneut Bier einlaufen zu lassen. Der alte Schopp, das spärliche Haar strähnig über die Glatze gekämmt, ärgerte sich über den Krach und bangte um sein Gestühl. „Die Nazis sind im Kommen. Ihr Göring ist schon Reichstagspräsident. Und alle Monate eine Wahl. Wir habe die letzte zehn Jahr mehr Regierunge gehabt als ich Finger an meine Händ. Nun wollen auch die Nazis mal ran.“
„In Italien“, sagte Otto, „sind sie auch dran, die Faschisten.“ Und Italien war ihm lieb, seitdem er dort den Titel geholt hatte.
Der alte Schopp rannte weg, mit dem Bier in den Saal, während Erich wieder auf einen Sprung herüberkam. „Das ist unser Leben“, sagte er und blähte die Nasenflügel.
„Weißt du noch: Tom Jordens.“ Auf einmal schwelgten sie in Erinnerungen. Drüben im Kino: Tom Jordens im Ring, zwölf Runden gegen den Mestizen, herrliche Fäuste, Kampf Mann gegen Mann. Er hat einen Leberhaken weg und schlägt ihn dennoch k.o., kurz vor dem Gong.
Sie sahen Tom Jordens vor sich, die gedrungene, muskulöse Gestalt, die vorgewulsteten, oft geöffneten und wieder vernarbten Brauen, die breit geschlagene Nase, die zerfranste Lippe. Tom Jordens, Weltmeister im Schwergewicht, ein Mann, dem man seinen Beruf ansah.
Pagler spürte die alte Sehnsucht in Erichs Worten, Träume, die nie verwirklicht worden waren. Tom Jordens sein, der Kraftmensch, der sich durchsetzt in dieser Zeit der Unsicherheit. Hunger und Not, Versicherungsbetrug und Kindesentführung, Räuberbanden, Falschspieler und Falschmünzer, wohin man blickte. Lawinen von Totalausverkäufen, Bankzusammenbrüche, Zeppeline am Himmel und Tauchkugeln in der Tiefsee, Weltflieger über den Meeren, Beleidigungsprozesse und Riesenfilmschinken. Tom Jordens sein, Weltmeister mit Boxerfäusten. Ja, Pagler hatte es geschafft. Er ahnte, dass in Erichs Worten mehr mitschwang als nur Bewunderung, und das war Neid.
Wer hätte das damals auch gedacht, als er mit Erich zum ersten Mal im Leben überhaupt eine Rennbahn zu Gesicht bekommen hatte. Ludwig Schopp hatte für den „Großen Sommerpreis“ mit Konzession der Stadt einen Bierstand eröffnet gehabt, als der Kantinenwirt Alfons Quandt von der „Pappschachtel“ gestorben war, was zur zeitweiligen Schließung der Kantine geführt hatte.
Ludwig Schopp, schlau und berechnend, hatte sich das Geschäft nicht entgehen lassen, und die Jungen Erich und Otto hatten Bierkästen gestemmt, sich aber beizeiten an die Bewehrung gedrückt und Mund und Nase über die flitzenden Fahrer aufgerissen.
Schopp kam wieder, schwitzend. „Sie saufen wie die Löcher. Und ihr sitzt hier trocken.“
„Ich mag nichts mehr“, wehrte Pagler ab.
Schopp grinste. „In Ordnung, Junge. Halt auf deine Form. Die Konkurrenz ist groß.“
Sie lachten und schwatzten, bis das Mädchen aus der Küche herantrat. „Die Frau lässt fragen, ob Sie mal könnten nach dem Hans sehen. Er ist so unruhig.“
Schopp stieß den Stuhl zurück. „Es kommt einem doch alles auf einmal übern Hals. Erich, lass den Saal nicht verdursten.“ Er winkte Pagler. „Komm mit in den Stall. Wir schauen uns den Hans an.“
6 KRONE IM SAAL
Simon Krone lief durch die Vorstadt. Es war Wind aufgekommen, doch einige Sterne glänzten, und ab und zu sah er hinter den Pappeln die Sichel des Mondes.
Krone kam sich vor wie ein Marathonläufer beim Training. Das war ein Tag, ein Tag war das gewesen, angefangen beim Telefongespräch im stickigen Flur der Frau Brettschneider bis zu diesem Herumirren durch die nächtliche Stadt. Der Teufel hole den Sport im Allgemeinen und Pagler insbesondere. Hätte er nie den Pagler aus Nagels schöner Limousine aussteigen lassen. Oh, als Rechtsanwalt hätte er ein ruhigeres Leben geführt; der alte Sam müsste ihn sehen, wie er hier schnaufte.
Die Praxis des Samuel Krone war bekannt gewesen in ganz Berlin, und wer einen guten Anwalt brauchte, der holte den Sam. Der kam steif und würdig und hieb einen wieder heraus.
Dies Leben war Krone zugedacht gewesen, kein schlechtes Leben, mit Dienstboten und Hausmädchen. Tausend Abenteuer steckten in den Gerichtsakten, in den Menschenschicksalen, Ganoven und Unschuldigen. Es war Krone dennoch zu wenig gewesen; da gab es den Siegeszug des Fahrrads. Krone war nicht der schlechteste Sprinter zu seiner Zeit, auch als er Rechtswissenschaft studiert hatte, wie der alte Sam es sich wünschte. Eines Morgens, im Sommer 1900, war Sam hinübergeschlummert, hatte nie eine Akte mehr gebraucht. Der beste Rechtsanwalt der Stadt war dahin. Und auch das Geld. Die alte Dame hatte nie wirtschaften können.
So pfiff man auf das Studium, so kam man zum Radrennen, der Krieg zerschnitt die Laufbahn, und hinterher war man zu alt. Ein bisschen Trainer, nicht leben können und nicht sterben, keine Frau, keine Kinder, ein möbliertes Zimmer bei der lieben Brettschneidern, und immer unterwegs. Das war Krone.
Dann geriet einem Pagler unter die Finger, und der Junge entpuppte sich als der Schlager. Ein begabter Kerl, ein Genie auf dem Rad, wenn man so wollte; ein Held in den Augen der Jugend. Nur musste man ihm das beibringen.
Vor einer Stunde war Krone in der „Pappschachtel“ aufgekreuzt, kein Pagler hatte dort gesessen, obwohl die Kantine brechend voll gewesen war. In die Salatgasse war Krone marschiert. Weglotsen wollte er den Jungen von den Eltern, den alten Pagler mitnehmen; der Christian konnte auch einen Schluck vertragen, und die Mutter Pagler, na. Aber die Alten hockten allein zu Hause, bei Wäsche und Bier, der Weltmeister war ausgeflogen. „Da haben Sie sich verfehlt“, tröstete Frieda.
Nun trabte Krone immer noch durch die Straßen, fluchte, weil er nicht wenigstens versucht hatte, noch einmal Nagels Limousine zu erwischen. Er stolperte über die Baustelle, die sie besser hätten beleuchten können. Er nahm den Hut ab und trocknete sich den Schädel. Das war ein Tag! Der Trainer Krone trabte durch die Stadt.
Am Königsplatz stoppte er, stieß einen Pfiff aus und wandte sich nach rechts wie ein Jäger, der eine Fährte aufnimmt. Zwei Minuten später stand er vorm „Goldenen Anker“.
Hast ihn mir nicht etwa doch noch ausgespannt, Schopp, fluchte er insgeheim. Natürlich war ihm bekannt, wie Pagler zum Radrennen gekommen war; er hatte auch Erich drei Monate lang um die Bahn trudeln sehen. Aber Erich war für so was nicht geschaffen.
Krone überschritt die Straße, aus den Saalfenstern rauschte es dumpf. Der SA-Mann unter der erleuchteten Tür knurrte: „Kommst spät, Kamerad.“
„Mein Kamerad ist woanders“, gab Krone zurück.
Der SA-Mann nahm die Daumen aus dem Koppel. Krone beschleunigte den Schritt. „Rechts die Treppe hinauf!“, schrie es hinter ihm her. „Aber geh leise!“ Wie unter dem Zwang dieser Stimme erklomm Krone die fünf Stufen. Den Blick des SA-Mannes spürte er im Rücken.
Er öffnete die Saaltür, es gab leisen Luftzug. Auch hier standen drei, die ihn musterten, breitrückig, uniformiert, mit Riemen über den Schultern. Er blieb zwischen ihnen stecken. Vor der Bühne stand ein Rednerpult, der Mann dahinter schrie: „Wir werden Deutschland aus dem Chaos erretten!“
Bombenvoll war der Saal, an langen Tischen saßen sie, die meisten in braunen Hemden. Bier stand vor ihnen; hinten zwängte sich Schopp mit dem Tablett durch die Reihen. Das hier also hast du eingetauscht für uns, Ludwig.
Der Redner ereiferte sich, gestikulierte. Stramm standen zwei Männer neben einer Fahne, die das Hakenkreuz zeigte. „Nun setz dich schon hin“, murrte einer Krone an. Und auf einmal bekam Krone Angst.
Er stand da, kahlköpfig, den Hut in der Hand. Unnahbar schien er hier an der Saaltür, ein wenig hochmütig, obwohl er doch die erbärmliche Angst verspürte.
Er hatte Angst, seitdem er wusste, wer draußen an der Eingangstür Posten schob. „Kommst spät, Kamerad.“ Krone hatte sich insofern geirrt, als dieser SA-Mann doch sein Kamerad war, sein ehemaliger zumindest. Karl-Heinz Kasparek hieß er, Krümelkarl genannt. Dem hatte er einmal den Tipp gegeben, das Bahnrennfahren Besseren zu überlassen und dafür Straßenrennen zu bestreiten, was Krümelkarl prompt getan hatte. Allerdings auch da ohne Erfolg.
Dieser Krümelkarl versuchte es nun bei den Braunen. Krone wischte sich schon wieder die Stirn. Der Redner sprach eindringlich wie zu einer Kirchgemeinde. Krone hätte etwas darum gegeben, sich unbemerkt fortstehlen zu können. Krümelkarl mit dem nackten Gesicht, der Mund dünn eingekerbt, der abwartend lauernde Blick. „Kommst spät, Kamerad.“ Und Krone, eingekeilt von der Saalwache an der zugigen Tür, fragte sich, ob Krümelkarl ihn erkannt hatte. Wenn ja, dann hatte sich Krümelkarl keinen geringen Scherz geleistet: Er hatte einen Juden in den Saal geschickt, mitten unter die Nazis. Krone klebte der Kragen am Halse. Der Jude war er.
Er stand und wagte sich nicht zu rühren. Die neben ihm hatten ihn vergessen oder hielten ihn umso fester, je weniger sie sich anmerken ließen. Es war ihr Mordsspaß. Es war das Martyrium des Simon Krone, er trug die Qual aller Judenverfolgungen in sich, dieser Instinkt, der Unheil witterte und der von den Vorfahren auf ihn überkommen war. Nichts mehr da von den Stunden in Rom, die ihn hochgetragen hatten und von denen er hatte zehren wollen bis ans Ende wie von einer Rente. Für diese hier war er eine Ratte.
Krümelkarl hatte einstmals zusammen mit einigen Arbeitslosen dem Bauern Fritsche den Ochsen von der Weide weggetrieben, die Salatgasse entlang. Das verstörte Tier hatte die Männer in den Landgraben gerissen. Nicht losgelassen hatte Krümelkarl, hatte den Ochsen wahrhaftig in die Metzgerei seines Vaters geschleift, der ihn schlachten sollte für alle. „Fleisch für die Armen!“, hatte Krümelkarl gebrüllt, hatte sich als Kommunist gefühlt, aber er war nur ein zügelloser Umstürzler gewesen. Der Ochse war nicht geschlachtet worden, der Vater hatte dem Krümel verziehen, hatte ihn selber ausgebildet zum Metzger. Ein tüchtiger Metzger war Krümelkarl nun und SA-Mann. Und Rennfahrer einmal gewesen.
Jetzt hatte er den Ochsen Krone der Meute zugetrieben. Krone stand im Saal. Zwei spöttische Augen, ein dicker Hals vor ihm. „Sie haben den Hut fallen lassen.“ Der bullige Saalwächter kitzelte ihm die Nase mit der Hutkrempe. Mechanisch griff Krone zu.
„Dr. Steyer versteht’s“, brummte der SA-Mann zufrieden. „Da vergisst man alles um sich, wenn der nur redet.“
Krone staubte den Hut ab, sah auf den Doktor, den Redner Steyer, der den knorrigen Schädel vorstieß. Er bekam wieder etwas mit von dem Geplärr, aber unentwegt dachte er an Krümelkarl draußen auf der Straße.
„Es gibt keinen Zweifel“, rief der Redner, „dass ihr alten Kämpfer hier im Saal alles daran setzen werdet, Adolf Hitler zur Regierungsmacht zu verhelfen. Ich kann euch versichern …“ Krone, plötzlich hellwach, hörte die bedeutsame Pause. „… Die Nacht nach dem Sieg gehört euch SA-Leuten. Sie wird die Nacht der langen Messer sein!“ Krone duckte sich wie unter einem Schlag. Der Saal toste. „Sieg Heil!“, brüllten sie, stießen die Stiefel aufs Parkett, schwenkten die Fahne. Krone erschauerte. Da waren sie, diese Wolfsherden, Raubtiere, ausgehungert, aufgepeitscht, gierig, seit Jahren vertröstet, auf nichts anderes gedrillt. Endlich wollten sie die Messer ziehen können, abrechnen mit allem, was nicht braun war; losziehen gegen die Juden, weil man einen Popanz brauchte, gegen den man die Massen hetzen konnte. Der da ist schuld an Hunger, Geldentwertung, Mord und Totschlag, am verlorenen Krieg, der Jude ist unser Unglück, Weltfeind Nr. 1, haut ihn, brennt ihn aus.
In dieser mörderischen Direktheit hatte Krone es bislang nie vernommen. Der Saal war ein Hexenkessel. Krone kam sich vor wie der letzte übriggebliebene Jude Deutschlands. „Die Nacht der langen Messer!“, brüllten sie im Chor. Sie wollten Blut.
Leise drückte Krone die Tür auf, er gelangte ins kühle Treppenhaus, ohne dass sich eine zupackende Hand auf seine Schulter legte. Er zitterte am ganzen Körper.
7 KRÜMELKARL
Krümelkarl, der Posten, blickte in die Septembernacht.
Er stand wie auf einer Bühne auf dem steinernen Tritt, beschienen von der insektengefüllten Lampenglocke über dem Eingang. Auch hatte er sich kostümiert wie ein Schauspieler; zum ersten Mal trug er die Uniform, bei Kleider-Dietrich hatte er sie geholt, am gleichen Tag, weil der Sturmführer der Meinung gewesen war, diese Kundgebung mit Dr. Steyer wäre ein bedeutendes Ereignis.
Das Hemd war ihm zu lang, 8,50 Mark mit Schlips, dazu Mütze und Sturmriemen für 3 Mark, 1a-Kernlederkoppel und Schulterriemen. Felltornister und Brotbeutel brauchte er noch. Und die Stiefelhosen kosteten 11,50. Und alles hatte er heute dem Dietrich auf den Ladentisch geblättert.
Er sprach jovial mit den Leuten, die in den Saal wollten. Er fragte den einen nach Feuer. Er pfiff hinüber zum Kino, wo sich einige Bengel herumdrückten. Er stand hier, ausstaffiert von seinem eigenen Geld. Und das war etwas völlig Neues in Krümelkarls Leben.
Er hatte einen Strich gezogen zwischen sich und dem Metzger Kasparek. Eine Tür hatte er zugeknallt. Nie verziehen hatte ihm der Alte den Ochsen von der Salatgasse. Unter die Knute hatte Kasparek den Sohn haben wollen. Deshalb hatte er den Krümel im eigenen Laden ausgebildet. Keinen Pfennig ließ der Alte aus dem Auge. Kost und Logis hast du, und gekleidet wirst du auch; so gut wollt es mancher haben.
Krümelkarl fühlte seine Arbeit damit lange nicht bezahlt. „Kommst spät, Kamerad“, brummte er den Glatzkopf an und dachte gleichzeitig: Mein Alter müsste mich so sehen. Er wippte auf den Zehen, allein mit seinen Gedanken, in seiner ersten eigenen Kleidung. Er hatte ohne Wissen des Metzgers Kasparek das Rennrad verkauft und besaß 42 Mark bares Geld. Kreuzfidel stand Krümelkarl unter der Lampe.
Er hatte noch mehr getan. Wenn man Geld in der Hand hatte, konnte man sich die Welt kaufen. Er war am Nachmittag im Stadtzentrum gewesen, in der Redaktion des Naziblatts. Dort hatte er dem blond gelockten Mädchen einen Zettel zugeschoben und gesagt: „Das können Sie doch drucken?“ Das Mädchen hatte sich Mühe gegeben, seine Klaue zu entziffern.
„Ein an sauberes Arbeiten gewöhnter Metzger (SA-Mann, 21 Jahre) sucht sofort Stellung, Hessen und Bayern bevorzugt. Angebote unter A 462 an die NSDAP …“
Dies würde in den nächsten Tagen in der Zeitung stehen. Hessen und Bayern! Krümelkarl stemmte grinsend die Arme in die Seiten. Er war auf dem Sprung in die Welt.
8 DAS KRIEGSPFERD HANS
Krone riss die Gaststubentür auf, in verdächtiger Hast.
Aber er hatte keine Kraft mehr, anderen Theater vorzuspielen. Auf Krümelkarls braunen Rücken dort am Eingang fiel der Lampenschein.
Er lehnte sich von innen gegen die Tür, horchte, schnaufte. Den Hut hatte er noch in der Hand. Der Kragen war ihm zu eng, er nestelte nach dem Knopf, die schwarze Schleife rutschte herunter.
„Ist Ihnen nicht gut?“
Krone hörte die Stimme, Frau Schopp stand vor ihm, die Martha, grau gelockt, erschrocken lächelnd. Sie rief nach Wasser, führte ihn an den Tisch, wo noch Paglers leeres Glas stand. Er kippte auf den Stuhl, als hätte er keine Muskeln. „Es ist das Herz“, sagte er.
Das Mädchen brachte ein Glas. Martha Schopp nahm es und setzte es ihm an die Lippen. Krone ließ das kalte Wasser hinunterrinnen. Er hätte doch nicht mehr anfangen sollen mit dem Rennfahren, als er aus dem Krieg nach Hause gekommen war. Zu alt war er dazu gewesen, untrainiert durch die Jahre in westlichen Schützengräben. Er hatte sich das Herz ruiniert.
„Herr Krone!“ Die Wirtin blickte besorgt in sein rotes, so fremdes Gesicht. „Ich hätt Sie fast nicht erkannt.“
Krone konnte nicht sprechen. Drüben wetzten sie Messer. Gesund, gesund müsste er sein. Nachdem die Schwäche in ihm langsam abklang, stieg nun der Zorn herauf, auch keine Medizin für sein Herz, er wusste es nur zu gut. „Man sollte sie alle …“
„Legen Sie sich bisschen rüber, Herr Krone. Im Wohnzimmer haben Sie Ruhe, da ist kein Mensch.“
In Krones dröhnendem Kopf wurde es klarer. Kein Mensch hier? Er schaute sich wie betrogen um. Er war doch auf der Jagd nach Pagler.
„Wollen Sie zu meinem Mann? Er ist hinten im Stall, ich hol ihn. Der Hans ist auch krank …“
„War Pagler nicht hier?“, presste er hervor.
„Pagler ist auch im Stall, mit dem Erich und dem Ludwig.“
„Wo ist der Stall?“
Er stand jetzt, das Zittern hatte sich gelegt, nur Schweiß perlte ihm noch auf dem Schädel. „Es geht wieder, Frau, nun zeig mir endlich den Stall.“
Martha Schopp glaubte weniger seinem Aussehen als vielmehr seiner rauen, drängenden Stimme, dass er wieder auf der Höhe sei. „Mich nimmt Gewitter immer mit“, klagte sie, „es hat jeder das Seine.“ Unter ihren Augen hingen blaue Säckchen.
Sie ging vor ihm her, zwischen den Tischen durch, und stieß eine Tür auf. Diese führte in einen kalten, mit Bierfässern vollgestellten Flur. Endlich erreichten sie den Hof. „Dort drüben, wo das Licht brennt“, erklärte Martha Schopp.
Krone stand allein, schaute das Geviert des Hofes ab, die Sterne glänzten noch immer. Die Luft erfrischte ihn mehr als das Glas Wasser.
Er atmete tief. Noch hatten sie die Macht nicht. Noch träumten sie nur von ihren Räubereien. Aber welch ungeheure verbrecherische Dreistigkeit, sich in aller Öffentlichkeit mit kommenden Morden zu brüsten. Das Handwerk muss man euch legen, hinter Schloss und Riegel gehört ihr. Er schaute zum Himmel. Welch eine Nacht.
Krone stieg über eine Wagendeichsel und trat in den Stall. Stickiger Tiergeruch schlug ihm entgegen.
„Krone, du“, staunte Ludwig Schopp, der dem Pferd den Hals tätschelte. Erich und Pagler lehnten an der Barriere.
„Deine ‚Pappschachtel‘ habe ich ganz vergessen!“ Pagler fiel aus allen Wolken, als er Krones finstere Augen sah.
Krone trat heran, der knochige Gaul schnob über seine Hand, die sich auf die Absperrung stützte.
„Er ist krank“, erklärte Ludwig. „Er legt sich nicht, er frisst nicht. Er denkt, er kommt nicht mehr hoch, wenn er einmal liegt.“
„Dem geht’s wie uns allen“, schnaufte Krone. Über das mit weißen Haaren durchsetzte Fell des Tieres lief ein Zucken.
Schopp redete mit dem Pferd wie mit einem kranken Kind. „Mach mir keine Geschichten, Hans. Lass den Kopp nicht hängen, es geht allens weiter. Bei Verdun hatte ich ihn vorm Bagagewagen, in Bomben und Granaten, zwei Kriegsjahre lang Schlamm, Frost, Feuer, ’nen Balken als Rad, das waren wir schon gewöhnt. Einmal sind wir bloß mit der Deichsel zum Unterstand gekommen, der Wagen war im Eimer. Das hat gepfiffen und geschossen. Und nie nischt ist ihm was passiert. Und nun frisst er nicht mehr, der Hans.“
Verdun, das kannte auch Krone, EK 1 für Tapferkeit, ein Heldenpferd für Kaiser und Reich, das nun sein Gnadenbrot fraß. Am liebsten hätte er sich ins Stroh fallen lassen.
„Ich komm dich holen, Pagler“, knurrte Krone. „Wird zu alt sein, dein Gaul, hat genug Hafer geschluckert auf dieser Welt. Willst du noch lange hier bleiben, Otto, da kann ich ja gehen.“
„Er ist siebenundzwanzig Jahre“, meinte Otto, „siebenundzwanzig, so ein Pferd. Wenn wir erst siebenundzwanzig sind … wir stecken die Welt ein bis dahin.“
„Du ja“, murrte Erich, „ich nicht. Ich versumpf hinterm Bier.“
Der alte Schopp streichelte stirnrunzelnd dem Pferd die abgewetzten Flanken. „Na, Hans, friss doch, friss. Das Leben ös noch lang.“
„Hol den Rossschlächter“, stichelte Krone. „Da draußen steht einer vor deiner Saaltür, der versteht sich aufs Abschlachten. Na, dann macht es gut. Ich gehe jetzt in die ,Pappschachtel'.“
Als er wie betrunken durch den stockdunklen Torweg zur Straße stolperte, holte Pagler ihn ein. Schweigend gingen sie Schulter an Schulter, ihre Schritte hallten auf dem Pflaster. Vor dem Kino drängten sich Leute, als sollte heute noch eine Vorstellung beginnen, Gorilla oder Schlacht vor Verdun, mit dem Kriegspferd Hans vor dem Bagagewagen. Die Eingangstür zum „Goldenen Anker“ war ausgefüllt von Krümelkarls breiter Gestalt.
9 IN DER „PAPPSCHACHTEL“ WIRD GEFEIERT
Die „Pappschachtel“ streckte sich am Gondelweg vor der pappelgesäumten Rennbahn, ganz aus Holz gebaut und flach wie eine Baracke. Hier ging es ruhiger zu als im Saal des „Goldenen Ankers“, doch erhob sich großes Hallo, als Krone endlich Pagler hereinschob. Zwei Dutzend Menschen saßen an den Tischen, die Augen ihm zugewandt. Im Nu war er umringt.
„Tag, Wüste Weißwange“, Pagler schüttelte dem Jungen die Hand. Auch Kaufmann war da, lauter gute Sprinter; alle hatte er geschlagen. „Robert, du auch. Hast du deinen Laden dichtgemacht?“
„Es werden wohl keine Räuber kommen.“ Robert Wendel, bebrillt und riesenhaft, drückte Pagler die Hand. Als er noch Schrittmacher gewesen war, hatten seine Fahrer einen guten Windschatten hinter ihm gehabt.
Petraschke trank ihm vom Ofen her zu. „Lasst mich mal durch“, rief resolut die Mutter Quandt. Sie drückte Pagler schmatzend einen Kuss ins Gesicht. Die Arme in die Seiten ihrer stämmigen, etwas aufgeschwemmten Gestalt gestützt, drohte sie spaßhaft, weil er so spät kam. Dann griff sie nach einem Hammer.
„Jetzt wird’s ernst“, witzelte einer, während Mutter Quandt einen Nagel in die Wand hieb. Er saß mit drei Schlägen. Sie hielt ein Bild hoch, und darauf war Pagler.
Er saß am Tisch zwischen Wendel und Krone und sah sein Bild in den Händen der Mutter Quandt; das große Kind, dieser Riesensäugling, die Augen, die eine Spur Staunen widerzuspiegeln schienen, das glatt anliegende, gescheitelte Haar. Es war nicht seine beste Aufnahme, etwas verwischt das Ganze, etwas wie ein schmutziger Schimmer über dem Gesicht sozusagen. Da war er, mit Blumen im Arm, von südlicher Sonne beleuchtet.
Unter dem Beifall aller hängte Mutter Quandt das Bild an die Holzwand. Pagler war aufgenommen in die Galerie der Großen. Er hing zur Rechten von Alfons Quandt, der vor der Jahrhundertwende die Zeitungen mit Schlagzeilen gefüllt hatte. Es war Quandts berühmtes Bild, wie er 1895 in München zum Zweikampf gegen das Trabrennpferd Flora angetreten war. Und Alfons Quandt hatte dieses Rennen gewonnen. Ein Mann gegen ein Pferd! Was Pferde alles so mitmachten.
Hedwig Quandt rannte längst wieder umher, schleppte Wein herbei und sang die rheinischen Karnevalslieder mit, die Weißwanges Bruder auf dem Schifferklavier spielte.
Pagler wusste diesen Ehrenplatz an der Wand und im Herzen der Mutter Quandt zu schätzen.
Auf einmal war er mitten im Erzählen, von Rom natürlich, vom Kampf seines Lebens. Dreizehn Vorläufe, drei Hoffnungsläufe und acht Zwischenläufe waren notwendig gewesen, um aus dem Heer von Sprintern die letzten acht Teilnehmer auszuwählen.
Eine Nervenprobe ohnegleichen. Schon im sechsten Vorlauf wurde ein Italiener disqualifiziert, weil er seinen Gegner behindert hatte. Die fünftausend Zuschauer rings um die Holzbahn pfiffen das Renngericht aus, weil sie ihren Mann wieder im Rennen haben wollten. Apfelsinen, Stöcke und Hüte regnete es auf die Bahn. Erst nach einer halben Stunde gelang es, das Rennen wieder aufzunehmen. Pagler, dem Außenseiter, war also bekannt, was ihm bevorstand.
Er hatte im Viertelfinale den Franzosen Gerard bezwungen, den Meister von Frankreich, den sagenhaften Jungen von Saint-Denis, und schließlich in den Vorentscheidungen den Österreicher, den niemand anderes hatte niederhalten können. Endlich hatte er sich zu den alles entscheidenden Läufen dem Italiener Mozzo stellen müssen. Er hatte ihn nicht gerade stehengelassen auf der Bahn, er war im zweiten Lauf gegen Mozzo sogar langsamer gefahren als jedes seiner anderen Rennen in Rom. Er war mit Taktik gefahren, mit Kopf und nicht mit robuster Kraft. Er hatte Mozzo getäuscht, an der Nase herumgeführt, zum Ärger des Publikums. Antritte hatte er vorgespielt und sich gestellt wie eine flügellahme Vogelmutter, die den Fuchs vom Nest weglocken will. Und als der Fuchs Mozzo zupacken wollte, da war Pagler mit einer Kraft davongeflogen, die nicht einer im weiten Rund mehr in ihm vermutet hatte.
Glücklich saß Pagler zwischen Krone und Wendel, diesen beiden alten Hasen, denen bei diesen Erzählungen die Erinnerung an eigene Kämpfe in die Augen stieg. Der eine hatte ihn trainiert und rechtzeitig in Höchstform gebracht; der andere hatte ihm die erste Bahnrennmaschine geschenkt, als er gesehen hatte, welch Talent in jenem unscheinbaren Dreherlehrling Pagler steckte, der da mit einem rostigen Drahtesel auf dem Betonband seine ersten Runden versucht hatte.
Pagler trank Wendel zu, und Robert Wendel stieß überaus zufrieden mit ihm an. Keine andere Rennmaschine aus Wendels Laden hatte solchen Erfolg gebracht wie jene, die er verschenkt hatte.
Pagler fühlte sich in einem großen Taumel. Der Tagesanbruch hatte ihn noch in der Schweiz gesehen. Zugfahrt und Empfang auf dem Bahnhof, Nagels Limousine und die Wohnküche in der Salatgasse, der „Goldene Anker“, das Kriegspferd Hans und nun die „Pappschachtel“.
Vergnügt hörte er zu, wie der kleine Sprinter Krickow Anekdoten erzählte. Krickow, Krücke genannt, hatte am letzten Sonntag beim Rennen in Dortmund dem Kampfgericht Schlafpulver in den Kaffee gemischt. Die Herren hatten vor Schläfrigkeit kaum noch die Köpfe heben können. Tosendes Gelächter.
Es lockte Pagler, selber zu schwatzen, Unfug anzustellen. „Ihr sollt alle leben!“, schrie er und schenkte den anderen ein. „Nun spiel was Flottes, Junge“, herrschte er den Mann mit dem Schifferklavier an. Und mit einem Blick auf dessen Matrosenhemd: „Spiel von der See, wenn du ein Seemann bist.“
Er war Matrose, Weißwanges Bruder, der Kurt. Er griff in die Tasten, dass die Wände wackelten. Die See brach herein, das schäumende Meer. „Auf Matrosen, ohee!“ Eine freche Locke in der Stirn, lachte der Matrose Weißwange, der auf seinem schnittigen Frachtschiff „Elsa“ nicht anders als Blaubacke genannt wurde.
„Hast uns ’ne tolle Stimmungskanone mitgebracht, Wüste“, lobte Pagler, und Weißwange blinzelte vergnügt. ,Aber, Wüste, du“, der Übermut stieg Pagler in die Stimme, „bist ganz schön dick geworden während meiner römischen Tage. Hat keiner ein Bandmaß für Wüstes Bauch?“
Krücke war schnell zu haben für einen solchen Spaß, aber Wüste stieß ihn weg; ihm war das Lachen vergangen. Er hockte sich an die Tür, weit entfernt von Pagler, und trank.
„He, du Weltmeister!“, rief Wüste über die Tische. „In Rom, dein Gerard, den du im Viertelfinale ausgebootet hast …“
„Nun was?“, fragte Pagler zurück und gewahrte erst jetzt den Umschwung in Wüstes Stimmung.
„Dein Gerard hatte doch vor dem Kampf in den Straßen von Rom einen kleinen Verkehrsunfall, wie? Hat er nicht mit dem Rad ’n Taxi gestreift?“
„Hat er“, gab Pagler bereitwillig zu. „Es war aber zum Glück nicht schlimm.“
„Und die drei dänischen Kandidaten?“, fragte Wüste weiter. „Hatten diese Dummköpfe nicht die Reise Kopenhagen-Rom in einem winzigen Auto zurückgelegt? In einem offenen Auto, liebe Leute, da lacht mal! Die waren fertig, als sie ankamen.“
Pagler erhob sich, finster. „Willst du stänkern?“
Die Gespräche verstummten, das Schifferklavier brach ab. In der Stille trat Pagler an Wüste heran.
„Und dein Österreicher aus der Vorentscheidung? Ein feiner Sieg war das für dich, Otto Pagler. Geradewegs aus Los Angeles herüber war er gekommen, was wohl gleich neben Rom liegt. Hat es gerade noch geschafft, an den Start zu kommen; hat noch die Seekrankheit im Bauch gehabt, was, Blaubacke? Sie sind nicht alle so fest wie du.“ Blaubacke lachte meckernd und zog an dem Zerrwanst.
Pagler stützte sich vor dem sitzenden Wüste auf den Tisch. Er rückte ein Glas beiseite und fragte betont: „Du meinst also, ich hätte den Titel gar nicht verdient?“
„Habe ich das gesagt?“ Wüste schaute sich empört um. „Habe ich nie gesagt, glaube ich. Habe nur gefragt, warum der beste Fahrer der Welt, der Olympiasieger Stevens, nicht in Rom am Start war. Das darf man doch wohl wissen.“
Ein Geschrei ging an, eine Flasche fiel vom Tisch.
„Mach dir nichts draus“, sagte Sioux Kaufmann zu Pagler. „Er ist besoffen.“
Blaubacke versuchte, mit dem Schifferklavier die Stimmung zu retten. Pagler, zutiefst betroffen, schaute sich um, lachende Gesichter im Kreis, dann sah er die Tür. Ein Mann lehnte dort, offensichtlich amüsiert über den Wirrwarr. „Keßmeier“, sagte Pagler erleichtert.
„Keßmeier, warum war Stevens nicht in Rom, weißt du’s?“
„Wird er so unklug sein, zu einem solchen Titelkampf anzutreten, kaum dass er Olympiasieger geworden ist? Weltmeister und Olympiasieger, das hat noch keiner geschafft.“
Mit strahlender Miene schaute sich Pagler um. Wüste konnte ihm den Buckel herunterrutschen. „Das ist Hermann Keßmeier, Sportreporter bei der ‚Allgemeinen‘. Er hat mich in Rom interviewt.“
„Keßmeier, hoch!“ Fröhliches Gelächter. Als er Keßmeier zum Tisch geleiten wollte, bemerkte er, dass dieser nicht allein gekommen war. Ein Mädchen stand bei ihm. „Fräulein Arend.“ Eine weltmännische Geste, dann war dies für Keßmeier erledigt. Er griff schon nach der Flasche und sah sich um. Mutter Quandt rannte nach sauberen Gläsern. Alle schauten das Mädchen an.
Pagler lachte. „Weg warst du auf dem Bahnhof, wie in Luft aufgelöst.“
Der Journalist zeigte die Goldzähne. „Um deine Koffer habe ich mich gekümmert. Deine Mutter packt zu Hause schon aus.“
Ein Stein fiel Pagler vom Herzen. „Das ist echt Keßmeier.“ Er lachte zu dem Mädchen hinüber. Sie war hübsch, hatte große Augen und trug das schwarze Haar glatt in die Stirn gekämmt. Während sie Wein nippte, musterte sie Pagler mit einem langen Blick. Er schätzte sie auf zwanzig.
Die laute Stimmung war gedämpft durch die Ankömmlinge. Dennoch mimte Keßmeier Fröhlichkeit. „Nun starrt Lonny nicht so an. Sie ist mitgekommen, weil sie Pagler zeichnen will.“
Ihr Gesicht rötete sich. Pagler fragte: „Sie sind Malerin?“
„Kunststudentin“, schwächte sie ab. Sie schien zu fühlen, dass sie eine Erklärung schuldig war. „Ich habe schon einige Leute für Zeitungen gezeichnet, Tom Jordens zum Beispiel.“
Pagler zog die Lippen breit. Tom Jordens war überall. „Wollen Sie gleich anfangen?“
Sie schüttelte den Kopf. „Das ist kaum der geeignete Ort. Die Beleuchtung ist miserabel.“
„Lassen Sie das nicht Mutter Quandt hören.“
„Ich zeichne am liebsten im Freien, bei voller Sonne.“
Pagler überlegte. „Wie wäre es mit dem Stadtgarten, morgen Nachmittag gegen fünf. Du lässt mich doch laufen, Simon?“ Überrascht blickte er von einem zum anderen. „Wo ist denn Simon?“
Vom Nebentisch rief Petraschke: „Er ist gegangen, zusammen mit Wendel. Ihm war wohl nicht gut.“
Steif lehnte sich Pagler zurück.
„Trink noch was, Otto, du bist viel zu ernst.“ Die Gläser klirrten gegeneinander.
Dankbar prostete er Keßmeier zu, diesem Reklamemann, der die Zeichnerin auf seine Spur gesetzt hatte.
Er war sehr zufrieden.
10 WENDEL GIBT EINEN RAT
Krone und Wendel schritten in der Nacht über den Vorplatz. Selbst hier war noch das Akkordeon von Weißwanges Bruder zu hören; es roch nach dem Rheinstrom.
Krone, verfolgt von Wüstes bösartigen Fragen, war an der Außentür noch auf Keßmeier gestoßen. Der Journalist hatte ihm die Hand gedrückt, warm und herzlich, dem erfolgreichen Trainer, den er in seinen Artikeln besonders herausgestrichen hatte.
„Wer war das?“, wollte Wendel dann wissen, und Krone sagte es ihm. Und setzte hinzu, weil er nun doch ein wenig ruhiger geworden war durch diese unverhoffte Begegnung: „Ohne ihn wäre heute große Stille hier gewesen. Er hat uns verraten, dass Pagler schon heute kommt.“