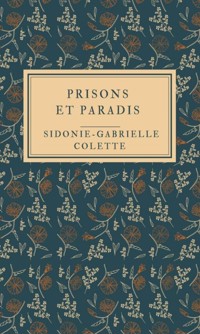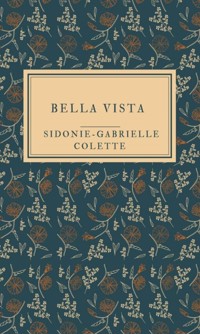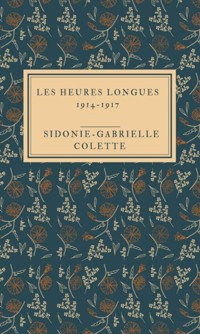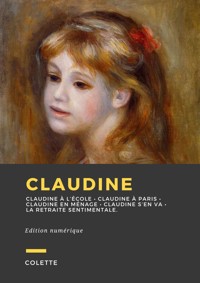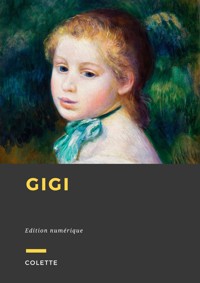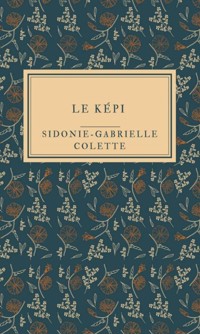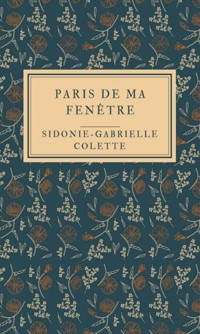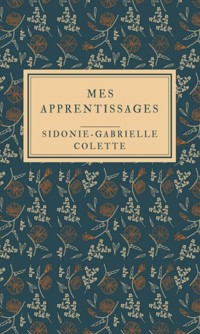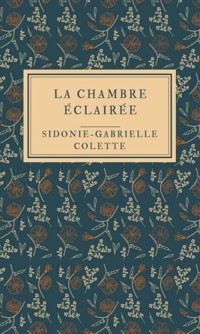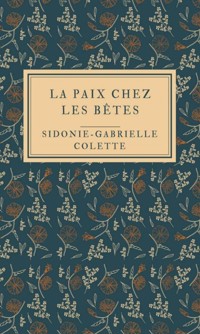19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Manesse Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Das Hauptwerk der Ikone der französischen Literatur – von vielen unterschätzt, von wenigen übertroffen – in zeitgemäßer Neuübersetzung von Renate Haen und Patricia Klobusiczky
Macht Liebe selig? Lässt sie uns über uns hinauswachsen? Schenkt sie uns ewige Jugend? – Diese und andere zeitlos aktuelle Fragen verhandelt dieser vibrierende Roman über die Höhen und Tiefen einer Beziehung, die gegen alle gesellschaftlichen Konventionen verstößt und gerade deshalb etwas Erhabenes gewinnt. Chéri, der titelgebende Held, ist mit seinen vierundzwanzig Jahren ein Bild von einem Mann, unwiderstehlich in seiner Ungezwungenheit und Eleganz, vor allem aber in seinem ausgeprägten Hang zum Pariser Wohlleben. Als Filou, der sich gerne aushalten lässt, ist er für Léa, die weitaus ältere, selbstbewusste und genussfreudige moderne Frau, das perfekte Objekt der Begierde. Hingerissen wie ein junges Mädchen, kann sie der Versuchung einfach nicht widerstehen. Ihre leidenschaftliche Liaison mit dem unreifen Chéri hält für sie so manche Überraschung bereit, vor allem in der erotischen Liebe, deren Exaltationen hier bei aller Freizügigkeit höchst einfühlsam geschildert werden. Am Ende ist Léa um eine existenzielle Lebens- und Liebeserfahrung reicher, wobei dieser Roman einer Amour fou in gewisser Weise Colettes eigenen Ausspruch widerlegt: «Man stirbt nur am ersten Mann.»
Colette gilt in ihrer Heimat als Klassikerin der Moderne und genoss schon zu Lebzeiten allerhöchstes Ansehen. Sie wurde in die Académie Goncourt aufgenommen, und nach ihrem Tod ehrte sie Frankreich mit einem Staatsbegräbnis. Selbstverständlich wurden ihre Werke in die Bibliothèque de la Pléiade aufgenommen. Im deutschen Sprachraum hat man sie hingegen lange unter «Boulevard» verbucht. Höchste Zeit also, das Vorurteil mit einer zeitgemäßen Neuausgabe zu korrigieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
«Grenzen ausloten und verschieben, dafür steht Colette wie kaum eine andere Künstlerin ihrer Zeit.» Dana Grigorcea
Madame trifft auf jungen Filou – ein moderner Liebesroman jenseits trivialer Geschlechterklischees. Léa liebt Chéri, den linkischen Rebell, und Chéri liebt Léa, die reife, willensstarke Frau. Zwischen Leichtsinn und Obsession, Spleen und Eifersucht, Furor und Frivolität hält ihre spannungsgeladene Liaison so manche Überraschung bereit.
Mit Anfang zwanzig ist Chéri ein Bild von einem Mann, unwiderstehlich in seiner Nonchalance und seinem Hang zum Wohlleben. Für Léa, die fast doppelt so alte mütterliche Freundin, ist er das perfekte Objekt der Begierde. Obwohl sie weiß, dass in der Liebe nichts von Dauer ist, lässt sie sich mit Chéri auf eine leidenschaftliche Affäre ein und ist am Ende um eine bittersüße Erfahrung reicher.
In ihrem Hauptwerk beschreibt Colette die Exaltationen einer Amour fou mit sinnlicher Freizügigkeit, höchst feinfühlig und dabei ganz unsentimental. «Sie hat das menschlichste Herz der modernen französischen Literatur», schwärmte Marcel Proust nach der Lektüre des Romans. In ihrer Heimat als Klassikerin der Moderne gefeiert und seit vielen Jahrzehnten verehrt, ist Colettes Entdeckung als «grand écrivain femme» (Simone de Beauvoir) im deutschen Sprachraum überfällig.
Colette
CHÉRI
Roman
Aus dem Französischen übersetzt von Renate Haen und Patricia Klobusiczky
Nachwort von Dana Grigorcea
MANESSE VERLAG
Inhalt
Chéri
Anmerkungen
Nachwort
Léa!
«Léa! Gib sie mir, gib sie her! Hörst du mir zu, Léa? Gib mir deine Perlenkette!»
Es kam keine Antwort aus dem großen, schmiedeeisernen Bett mit ziseliertem Kupfer, das im Dunkeln schimmerte wie eine Rüstung.
«Warum willst du mir deine Kette nicht geben? Sie steht mir genauso gut wie dir, wenn nicht besser!»
Beim Klacken des Verschlusses begann die Spitzenbettwäsche zu rascheln, zwei prachtvolle nackte Arme mit zarten Gelenken hoben zwei schöne, träge Hände.
«Lass das, Chéri, du hast schon genug mit dieser Kette gespielt.»
«Es macht mir Spaß … Hast du Angst, dass ich sie dir stehle?»
Vor den rosaroten, sonnendurchfluteten Vorhängen tanzte er, ganz und gar schwarz, wie ein anmutiger Teufel vor loderndem Feuer. Als er sich rückwärts auf das Bett zubewegte, wurde er jedoch wieder ganz und gar weiß, vom Seidenpyjama bis zu den Wildlederpantoffeln.
«Ich habe keine Angst», antwortete die leise, sanfte Stimme aus dem Bett. «Aber du zerrst an der Schnur. Und die Perlen sind schwer.»
«Das sind sie», sagte Chéri anerkennend. «Von wem auch immer dieses Geschenk stammt, er hat sich nicht lumpen lassen.»
Er stand vor einem länglichen Spiegel, der zwischen beiden Fenstern an der Wand hing, und betrachtete sein Ebenbild, einen sehr schönen, sehr jungen Mann, weder groß noch klein, das Haar so bläulich wie das Federkleid einer Amsel. Als er sein Nachtgewand aufknöpfte, kam eine braune, glatte Brust zum Vorschein, die sich wölbte wie ein Schild, und es fiel ein und derselbe rosa Lichtstrahl auf seine Zähne, auf das Weiße in seinen dunklen Augen und auf die Perlen.
«Leg die Kette ab», insistierte die weibliche Stimme. «Hörst du, was ich sage?»
Der junge Mann, reglos vor seinem Spiegelbild, lachte ganz leise.
«Jaja, ich hab’s gehört. Ich weiß genau, dass du Angst hast, ich könnte sie dir stibitzen!»
«Nein. Aber wenn ich sie dir schenkte, würdest du sie sehr wahrscheinlich annehmen.»
Er rannte zum Bett und warf sich hinein, zu einer Kugel zusammengerollt.
«Allerdings! Um Konventionen kümmere ich mich nicht. Und ich finde es albern, dass ein Mann eine Perle oder zwei von einer Frau annehmen darf, als Krawattennadel oder Knöpfe, und sich entehrt fühlt, wenn sie ihm fünfzig schenkt …»
«Neunundvierzig.»
«Neunundvierzig, ich weiß. Dann sag doch, dass sie mir nicht steht! Sag doch, dass ich hässlich bin!»
Er beugte sich mit einem provokanten Lachen, das winzige Zähne und die feuchte Innenseite seiner Lippen preisgab, über die liegende Frau. Léa setzte sich im Bett auf.
«Nein, das werde ich nicht sagen. Du würdest mir ohnehin nicht glauben. Aber kannst du denn nicht lachen, ohne deine Nase derart zu kräuseln? Du wirst erst so richtig froh sein, wenn du drei Falten um die Nase hast, nicht wahr?»
Er hörte sogleich auf zu lachen, straffte die Stirn und spannte die Unterseite seines Kinns so geschickt an wie eine alte Kokette. Die beiden blickten einander feindselig an: sie mit aufgestützten Ellbogen inmitten ihrer Spitzenwäsche, er im Damensitz auf der Bettkante. Er dachte: «Ausgerechnet sie will mir von meinen künftigen Falten erzählen?» Und sie: «Warum ist er hässlich, wenn er lacht, er ist doch der Inbegriff von Schönheit?» Sie überlegte einen Augenblick und führte ihren Gedanken laut zu Ende: «Tatsächlich wirkst du so gemein, wenn du heiter bist … Du lachst nur aus Bosheit oder Spott. Das macht dich hässlich. Du bist oft hässlich.»
«Das stimmt nicht!», rief Chéri verärgert.
Die Wut führte seine Brauen an der Nasenwurzel zusammen, vergrößerte die herausfordernd funkelnden, wimpernbewehrten Augen, hob den herablassenden, keuschen Bogen des Mundes leicht an. Léa lächelte, als sie ihn so sah, wie er ihr gefiel: rebellisch und dann ergeben, halb angekettet, unfähig, frei zu sein; sie legte eine Hand auf den jugendlichen Kopf, der dieses Joch ungnädig schüttelte. Sie flüsterte so, wie man ein Tier besänftigt: «Na, na … Was hast du … was hast du nur …»
Er ließ sich auf die schöne breite Schulter fallen, drängte mit der Stirn, mit der Nase, grub sich an seinen gewohnten Platz, schloss bereits die Augen und wollte in den geborgenen Schlaf langer Vormittage versinken, aber Léa stieß ihn weg: «Nichts da, Chéri! Du sollst bei unserem Oberdrachen zu Mittag essen, und es ist zwanzig vor zwölf.»
«Wirklich? Ich esse bei der Chefin? Du auch?»
Léa glitt träge in die Kissen zurück. «Ich nicht, ich habe Urlaub. Ich werde um zwei zum Kaffee erscheinen … oder zum Tee um sechs … oder um Viertel vor acht für eine Zigarette … Keine Sorge, sie bekommt mich oft genug zu Gesicht … Außerdem hat sie mich nicht eingeladen.»
Chéri, der schmollend aufgestanden war, strahlte nun hinterhältig. «Ha, ich weiß, warum! Weil wir vornehmen Besuch haben werden! Die schöne Marie-Laure und ihr biestiges Kind!»
Léas Blick aus großen blauen Augen wurde plötzlich scharf.
«Ach ja? Bezaubernd, die Kleine. Etwas weniger als ihre Mutter, aber doch bezaubernd … Leg endlich diese Kette ab.»
«Schade», seufzte Chéri und öffnete den Verschluss. «Sie wäre eine Zier für die Schatulle.»
Léa stützte sich auf einen Ellbogen auf.
«Welche Schatulle?»
«Meine», sagte Chéri gespielt hochtrabend. «Meine Schatulle mit meinem Schmuck für meine Hochzeit …»
Er sprang in die Luft, landete nach einem sauber ausgeführten entrechat six1 auf beiden Füßen, stieß die Portiere mit einer Kopfbewegung auf und verschwand mit dem Ruf: «Mein Bad, Rose! Ein bisschen plötzlich! Ich speise bei der Chefin!»
«Aber ja», dachte Léa. «Ein ganzer See im Badezimmer, acht triefnasse Handtücher und Bartstoppeln im Waschbecken. Hätte ich nur zwei Badezimmer …» Doch dann fiel ihr wie jedes Mal ein, dass man dafür einen Wandschrank hätte opfern und das Frisierzimmer hätte verkleinern müssen, und so kam sie wie jedes Mal zu dem Schluss: «Bis Chéri heiratet, werde ich mich wohl gedulden.»
Sie legte sich wieder hin und stellte fest, dass Chéri am Vorabend seine Strümpfe auf den Kamin geworfen hatte, seine Unterhose auf den Damenschreibtisch, seine Krawatte um den Hals einer Büste von Léa. Angesichts dieser heimeligen männlichen Unordnung musste sie lächeln und schloss halb ihre großen Augen, deren Blau so jung war und die sämtliche kastanienbraunen Wimpern bewahrt hatten. Mit neunundvierzig beendete Léonie Vallon, bekannt als Léa de Lonval, eine erfolgreiche Laufbahn als vermögende Kurtisane und gutherziges Mädchen, dem das Leben ehrenvolle Schicksalsschläge und edlen Kummer erspart hatte. Ihr Geburtsdatum behielt sie für sich, aber sie räumte mit einem genüsslich herablassenden Blick auf Chéri gern ein, dass sie in das Alter kam, in dem sie sich die eine oder andere kleine Annehmlichkeit gönnen durfte. Sie schätzte Ordnung, feine Wäsche, gereifte Weine und wohlbedachte Küche. In ihrer Jugend als gefeierte Blondine und später als reiche Halbweltdame hatte sie weder fragwürdigen Glanz noch unklare Verhältnisse geduldet, und ihren Freunden war ein Pferderennen um 1895 in Erinnerung geblieben, als Léa dem Redaktionssekretär des «Gil Blas»2, der sie als «verehrte Künstlerin» bezeichnete, antwortete: «Künstlerin? Oh! Wie geschwätzig meine Liebhaber sind, teurer Freund …»
Frauen ihres Alters missgönnten ihr die eherne Gesundheit, die Jüngeren, denen die Mode von 1912 ohnehin Rücken und Bauch wölbte, machten sich über Léas üppige Brust lustig, und alle beneideten sie gleichermaßen um Chéri.
«Ach Gott», sagte Léa, «warum nur? Sollen sie ihn doch nehmen. Ich kette ihn nicht an, und er geht auch allein aus.»
Wobei sie zur Hälfte log, stolz auf eine seit sechs Jahren währende Liaison – die sie manchmal, zur Aufrichtigkeit neigend, als Adoption bezeichnete.
«Die Schatulle …», wiederholte Léa. «Chéri verheiraten … Das ist unmöglich, das ist … unmenschlich … Chéri einfach ein junges Mädchen überlassen, warum nicht gleich ein Reh den Hunden zum Fraß vorwerfen? Die Leute wissen nicht, was es mit Chéri auf sich hat.»
Sie ließ die hingeworfene Kette wie einen Rosenkranz durch ihre Finger gleiten. Inzwischen legte Léa sie nachts ab, weil Chéri, der in die schönen Perlen vernarrt war und sie morgens gern streichelte, sonst zu oft aufgefallen wäre, dass Léas nicht mehr ganz so zarter Hals seine strahlende Blässe einbüßte und sich unter der Haut erschlaffte Muskeln abzeichneten. Sie hakte die Kette im Nacken zu, ohne sich aufzurichten, und nahm einen Spiegel vom Nachttisch.
«Ich sehe aus wie eine Gärtnerin», befand sie schonungslos. «Eine Gemüsebäuerin. Eine Gemüsebäuerin aus der Normandie, die sich mit einer Perlenkette zum Kartoffelacker aufmacht. Das steht mir so gut wie eine Straußenfeder im Nasenloch, und das ist noch höflich ausgedrückt.»
Sie zuckte die Achseln, streng mit allem, was ihr an ihrem Äußeren nicht mehr gefiel: ein frischer Teint, gesund, leicht rötlich, ein Freiluftteint, wie geschaffen, um die intensive Farbe der blauen Iris zu unterstreichen, die von einem dunkleren Blau umrandet war. Die stolze Nase fand vor Léa noch Gnade – «Die Nase von Marie-Antoinette!», wie Chéris Mutter stets betonte, bevor sie unweigerlich hinzufügte: «… und in zwei Jahren bekommt die gute Léa das Kinn von Ludwig XVI.» Der Mund mit den eng stehenden Zähnen, der sich fast nie zu einem Lachen öffnete, lächelte oft, im Einklang mit den großen Augen, die selten und gemessen blinzelten, ein hundertfach gepriesenes, besungenes, fotografiertes Lächeln, ein Lächeln voller Tiefe und Zuversicht, an dem man sich niemals sattsehen konnte.
Zum Thema Körper befand Léa: «Bei guter Qualität hält er sich bekanntlich.» Ihrer konnte sich noch sehen lassen, dieser große, rosig-weiße Körper mit den langen Beinen und dem flachen Rücken, den man von den Nymphen italienischer Brunnen kennt; der Hintern mit seinem Grübchen, die hohe Brust würden, wie Léa sagte, «noch lange nach Chéris Hochzeit Bestand haben».
Sie stand auf, hüllte sich in ein Negligé und zog eigenhändig die Vorhänge auf. Die Mittagssonne fiel in das heitere rosa Zimmer, überladen und auf altmodische Weise luxuriös, mit doppelter Spitzenlage vor den Fenstern, rosarotem Rips an den Wänden, vergoldetem Holz, elektrischen Lampen mit rosa-weißen Schirmen und antiken, mit moderner Seide bespannten Möbeln. Léa gab dieses behagliche Zimmer nicht auf und auch nicht ihr Bett, ein bemerkenswertes, unverwüstliches Meisterwerk aus Kupfer und Schmiedeeisen, so hart für das Auge wie grausam für die Schienbeine.
«Aber nein, keineswegs», beteuerte Chéris Mutter, «so hässlich ist das nicht. Mir gefällt dieses Zimmer gut. Es zeugt von einer Epoche, es hat seinen eigenen Chic. Man denkt gleich an die Païva3.»
Léa lächelte bei dieser Erinnerung an den «Oberdrachen», während sie ihr loses Haar aufsteckte. Sie puderte sich hastig das Gesicht, als sie zwei Türen schlagen und einen beschuhten Fuß gegen ein zierliches Möbelstück treten hörte. Chéri kehrte zurück, in Hemd und Hose, mit talkumweißen Ohren und voller Angriffslust.
«Wo ist meine Nadel? Verfluchte Bude! Wird einem hier auch noch der Schmuck geklaut?»
«Marcel hat sie sich an die Krawatte geheftet, um auf den Markt zu gehen», sagte Léa tiefernst.
Chéri, dem es an Humor fehlte, stieß sich an diesem Scherz wie eine Ameise an einem Kohlestück. Er beendete seinen kämpferischen Rundgang abrupt, und als Antwort fiel ihm nur ein: «Reizend! … und meine Halbstiefel?»
«Welche?»
«Die aus Wildleder!»
Léa, die an ihrem Frisiertisch saß, hob den nun allzu sanften Blick. «Das willst du lieber nicht hören», schnurrte sie.
«An dem Tag, an dem mich eine Frau wegen meines Köpfchens lieben wird, bin ich erledigt», entgegnete Chéri. «Vorerst will ich aber meine Nadel und meine Stiefel.»
«Wozu denn? Zum Jackett trägt man keine Krawattennadel, und du hast bereits Schuhe an den Füßen.»
Chéri stampfte mit dem Fuß auf. «Mir reicht’s, hier kümmert sich keiner um mich! Ich hab’s satt!»
Léa legte ihren Kamm aus der Hand. «Na dann geh doch!»
Er zuckte mit den Schultern und blaffte: «Das sagst du so!»
«Verschwinde. Gäste, die sich über die Küche beschweren und Frischkäse auf die Spiegel schmieren, habe ich schon immer verabscheut. Geh doch zu deiner sakrosankten Mutter, mein Kind, und bleib dort.»
Er hielt Léas Blick nicht stand, senkte die Augen und widersprach wie ein Schulkind: «Darf ich also gar nichts sagen? Leihst du mir wenigstens das Auto, um nach Neuilly zu fahren?»
«Nein.»
«Und zwar weil?»
«Weil ich um zwei aus dem Haus gehe und Philibert Mittagspause hat.»
«Wo willst du denn hin, um zwei?»
«Meinen religiösen Pflichten nachkommen. Soll ich dir drei Franc fürs Taxi geben? – Dummkopf», fuhr sie zärtlich fort, «um zwei trinke ich vielleicht Kaffee bei deiner Frau Mutter. Bist du jetzt zufrieden?»
Er schüttelte die Stirn wie ein kleiner Widder. «Man belügt mich, man enthält mir alles vor, man versteckt meine Sachen, man …»
«Wirst du denn nie lernen, dich allein anzuziehen?» Sie nahm Chéri die Krawatte aus den Händen und band sie ihm um.
«Fertig! – Oh! Diese violette Krawatte … Aber durchaus passend für die schöne Marie-Laure und ihren Anhang … Und darauf wolltest du noch eine Perle setzen? Kleiner Gernegroß … Warum nicht gleich Ohrgehänge …?»
Er ließ es sich gefallen, selig, nachgiebig, schwankend, aufs Neue von einer Trägheit und einer Lust ergriffen, die ihn dazu brachten, die Augen zu schließen …
«Liebste Nounoune4 …», flüsterte er.
Sie wischte ihm die Ohren ab, zog den feinen, bläulichen Scheitel neu, der Chéris schwarze Haare teilte, betupfte seine Schläfen mit einem Hauch Parfüm und küsste rasch, weil sie nicht anders konnte, den lockenden Mund, der so dicht bei ihr atmete. Chéri öffnete die Augen, die Lippen, streckte die Hände aus … Sie wich zurück.
«Nein! Es ist Viertel vor eins! Ab mit dir, und dass ich dich ja nicht wiedersehe!»
«Nie wieder?»
«Nie wieder!», rief sie ihm zu und lachte, hingerissen vor Zuneigung.
Als sie allein war, lächelte sie stolz, seufzte vor unterdrücktem Begehren und lauschte Chéris Schritten im Hof ihres Stadthauses. Sie sah ihn das Tor öffnen und wieder schließen, sah, wie er sich leichtfüßig entfernte und sogleich drei Laufmädchen in Ekstase versetzte, die Arm in Arm gingen.
«Ach! Unglaublich …! Und der soll echt sein? Sollen wir fragen, ob wir ihn anfassen dürfen?»
Doch Chéri, der Blasierte, drehte sich nicht einmal um.
Mein Bad, Rose!
«Mein Bad, Rose! Keine Maniküre heute; es ist zu spät. Das blaue Kostüm, das neue, den blauen Hut, den mit dem weißen Futter, und die Spangenschühchen … Nein, warte …»
Léa saß mit übereinandergeschlagenen Beinen da und betastete ihren nackten Knöchel, dann schüttelte sie den Kopf: «Nein, die Schnürstiefeletten aus blauem Ziegenleder. Meine Beine sind heute ein bisschen geschwollen. Das liegt an der Hitze.»
Die Kammerzofe, angejahrt und mit einem Tüllhäubchen auf dem Haar, warf Léa einen wissenden Blick zu: «Das liegt … an der Hitze», wiederholte sie folgsam und mit einem Achselzucken, als wollte sie sagen: «Aber sicher … Alles nutzt sich irgendwann ab …»
Nun da Chéri gegangen war, wurde Léa wieder lebhaft, entschlossen, beschwingt. In weniger als einer Stunde war sie gebadet, mit Sandelholzwasser eingerieben, frisiert und beschuht. Während die Brennschere5 heiß wurde, fand sie Zeit, das Haushaltsbuch des maître d’hôtel6 durchzusehen und den Kammerdiener Émile zu rufen, um ihm einen bläulichen Beschlag auf einem Spiegel zu zeigen. Sie sah sich um, mit diesem prüfenden Blick, der sich fast nie täuschen ließ, und aß in vergnügter Einsamkeit zu Mittag, freute sich über den trockenen Vouvray und die Junierdbeeren, die samt Stielen auf einem Rubelles-Teller7, so grün wie ein nasser Laubfrosch, serviert wurden. Ein tüchtiger Esser musste einst die großen Louis-XVI-Spiegel und die englischen Möbel aus derselben Zeit für dieses rechteckige Esszimmer gewählt haben: luftige Anrichten, ein hochbeiniger Serviertisch, schlanke und solide Stühle, alles aus fast schwarzem Holz mit zierlichen Girlanden. Die Spiegel und das Besteck aus massivem Silber fingen das strahlende Tageslicht ein, das grüne Leuchten der Bäume in der Avenue Bugeaud, und während sie speiste, musterte Léa das rote Pulver, das auf der Ziselierung einer Gabel zurückgeblieben war, schloss ein Auge, um die Politur des dunklen Holzes besser begutachten zu können. Der maître d’hôtel, der hinter ihr stand, fürchtete diese Spielchen.
«Marcel», sagte Léa, «Ihre Politur klebt, und das seit einer Woche.»
«Madame meinen …?»
«Madame meint. Fügen Sie ihr etwas Benzin hinzu, erwärmen Sie alles im Wasserbad, dann ist es im Nu erledigt. Sie haben den Vouvray etwas zu früh heraufgebracht. Schließen Sie die Klappläden, sobald Sie abserviert haben, es ist wirklich heiß heute.»
«Sehr wohl, Madame. Wird Monsieur Ch… Monsieur Peloux hier dinieren?»
«Ich nehme es an … Keine Crème surprise heute Abend, nur Sorbet aus Erdbeersaft. Kaffee dann im Boudoir.»
Als sie sich erhob, groß und aufrecht, und ihre Beine sich unter dem Rock abzeichneten, der an den Schenkeln anlag, konnte sie aus dem verhaltenen Blick ihres maître d’hôtel dieses «Madame ist schön» herauslesen, das ihr keineswegs missfiel.
«Schön …», dachte Léa auf dem Weg ins Boudoir. «Nein. Jetzt nicht mehr. Heute brauche ich das Weiß der Wäsche an meinem Gesicht, das zarteste Rosa für Dessous und Negligés. Schön … Puh … das habe ich kaum mehr nötig …»
Dennoch gönnte sie sich keinen Mittagsschlaf nach dem Kaffee und der Zeitungslektüre im Boudoir mit den bemalten Seidenstoffen. Und mit kämpferischer Miene wies sie ihren Chauffeur an: «Zu Madame Peloux.»
Die Alleen des Bois8, trocken unter ihrem frischen Junigrün, das der Wind bereits welken ließ, der Akzisezaun9, Neuilly, der Boulevard d’Inkermann … «Wie oft bin ich diese Strecke wohl gefahren?», fragte sich Léa. Sie zählte, dann wurde sie das Zählen leid, und während sie ihre Schritte auf dem Kiesweg verlangsamte, lauschte sie auf die Geräusche, die aus dem Haus von Madame Peloux drangen.
«Sie sind in der Halle», sagte sie.
Vor ihrer Ankunft hatte sie noch einmal Puder aufgelegt und den blauen Schleier, ein nebelfeines Gitternetz, bis übers Kinn gezogen. Und dem Diener, der sie aufforderte, durchs Haus zu gehen, antwortete sie: «Nein, ich möchte lieber den Weg durch den Garten nehmen.»
Ein richtiger Garten, fast schon ein Park, sonderte die große, ganz in Weiß erstrahlende Villa vom Pariser Vorstadtgürtel ab. Als Neuilly noch außerhalb von Paris lag, nannte man die Villa von Madame Peloux «ein Anwesen auf dem Lande». Davon zeugten bis heute die Ställe, nun zu Garagen umgewandelt, die Wirtschaftsgebäude mit ihren Hundezwingern und Waschküchen, ebenso die Größe des Billardzimmers, des Vestibüls und des Esszimmers.
«Der Aufwand hat sich für Madame Peloux gelohnt», pflegten die alten Schmarotzerinnen fromm zu sagen, die ihr im Austausch für ein Abendessen und ein Gläschen Weinbrand die Bézique-10 und Pokerkarten entgegenstreckten. Und fügten dann hinzu: «Aber wann wurde Madame Peloux denn nicht für ihren Aufwand belohnt?»
Auf ihrem Weg unter dem Schatten der Akazien, zwischen Beeten mit rot erglühtem Rhododendron und Rosenbogen, vernahm Léa ein Stimmengemurmel, durchbrochen von Madame Peloux’ näselnder Trompete und Chéris trockenem Lachen.
«Ein gehässiges Lachen hat er, dieser Junge», dachte Léa. Sie blieb einen Moment stehen, um ein unbekanntes weibliches Timbre besser zu vernehmen, leise, liebenswürdig und schnell übertönt von der furchterregenden Trompete.
«Das ist die Kleine», sagte sich Léa.
Sie machte ein paar schnelle Schritte und fand sich an der Schwelle zu einer Glashalle, aus der Madame Peloux herbeigeeilt kam und rief: «Da ist ja unsere schöne Freundin!»
Dieses Fässchen, Madame Peloux, in Wahrheit Mademoiselle Peloux, war im Alter von zehn bis sechzehn Jahren Tänzerin gewesen. Manchmal suchte Léa bei Madame Peloux etwas, was an jenen früheren blonden, pummeligen kleinen Amor oder an die spätere Nymphe mit Grübchen erinnern könnte, und fand nur die großen, unerbittlichen Augen, die feine und harte Nase und auch eine kokette Art, die Füße in der «fünften»11 zu setzen, wie die Elevinnen einer Ballettkompanie.
Chéri, auferstanden aus einem Schaukelstuhl, küsste Léas Hand mit unbewusster Grazie und verdarb seine Geste mit einem: «Verdammt! Du trägst schon wieder einen Schleier, ich kann das nicht ausstehen.»
«Lass sie ja in Ruhe!», ging Madame Peloux dazwischen. «Man fragt eine Frau nicht, warum sie einen Schleier trägt! Wir würden das nie tun», sagte sie liebevoll zu Léa.
Zwei Frauen hatten sich im zarten Schatten der Strohjalousie erhoben. Die eine, malvenfarben gekleidet, streckte Léa, die sie von Kopf bis Fuß betrachtete, kühl die Hand entgegen.
«Meine Güte, wie schön Sie sind, Marie-Laure, nichts ist so vollkommen wie Sie!»
Marie-Laure ließ sich zu einem Lächeln herab. Sie war eine junge, rothaarige Frau mit braunen Augen, die ohne jedes Wort, ohne jede Geste bezauberte. Wie aus Koketterie deutete sie auf die andere junge Frau: «Sie kennen doch noch meine Tochter Edmée?», sagte sie.
Léa streckte die Hand aus, die von dem Mädchen erst nach einigem Zögern ergriffen wurde.
«Ich hätte Sie erkennen müssen, mein Kind, aber eine Internatsschülerin verändert sich schnell, während Marie-Laure sich nur verändert, um uns von Mal zu Mal mehr zu verwirren. Sind Sie dem Internatsleben jetzt entronnen?»
«Bestimmt, bestimmt», rief Madame Peloux. «Man kann diesen Charme, diese Anmut, dieses Wunder von neunzehn Jahren nicht ewig unter den Scheffel stellen!»
«Achtzehn», sagte Marie-Laure zuckersüß.
«Achtzehn, achtzehn …! Aber ja, achtzehn …! Léa, erinnerst du dich? Als dieses Kind zur Erstkommunion ging, haute Chéri aus der Schule ab, weißt du noch? Ja, du böser Junge, du bist weggelaufen, und wir waren beide in Panik!»
«Ich erinnere mich sehr gut», sagte Léa und tauschte mit Marie-Laure ein kleines Kopfnicken aus – so etwas wie das «Touché» unter fairen Fechtern.
«Man muss sie verheiraten, man muss sie verheiraten!», fuhr Madame Peloux fort, die ihre Weisheiten immer gern wiederholte. «Wir werden alle zur Hochzeit gehen!»
Sie stieß ihre Ärmchen in die Luft, und das Mädchen beobachtete sie mit naivem Schrecken.
«Sie ist die passende Tochter für Marie-Laure», dachte die sehr aufmerksame Léa. «In unauffälliger Form hat sie alles, was bei ihrer Mutter hervorsticht. Schaumiges, aschblondes, wie gepudertes Haar, unruhige Augen, die sich verstecken, ein Mund, der sich beim Sprechen, beim Lächeln zurückhält … Genau das Richtige für Marie-Laure, die sie trotzdem hassen dürfte …»
Madame Peloux trat mit einem mütterlichen Lächeln zwischen Léa und das Mädchen: «Wo sie sich doch im Garten schon angefreundet haben, die beiden Kinder!»
Sie deutete auf Chéri, der vor der Glaswand stand und rauchte. Seine Zigarettenspitze zwischen die Zähne geklemmt, warf er den Kopf in den Nacken, um dem Rauch auszuweichen. Die drei Frauen betrachteten den jungen Mann, der mit zurückgelegtem Haupt, halb geschlossenen Wimpern und zusammengestellten Füßen dastand und dennoch wie eine geflügelte Gestalt aussah, in der Luft schwebend und schlafend … Léa täuschte sich kein bisschen über den verstörten, niedergeschlagenen Gesichtsausdruck der jungen Frau. Sie gönnte sich das Vergnügen, sie aufzuschrecken, und berührte sie am Arm. Edmée erzitterte am ganzen Körper, zog ihren Arm zurück und murmelte unwirsch: «Was …?»
«Nichts», erwiderte Léa. «Mein Handschuh ist mir heruntergefallen.»
«Jetzt komm, Edmée», befahl Marie-Laure wie nebenbei.
Das Mädchen ging stumm und folgsam auf die flügelschlagende Madame Peloux zu.
«Schon? Nicht doch! Wir werden uns wiedersehen! Wir werden uns wiedersehen!»
«Es ist spät», sagte Marie-Laure. «Außerdem erwarten Sie sonntagnachmittags viele Gäste. Dieses Kind ist nicht an Gesellschaft gewöhnt …»
«Jaja», rief Madame Peloux voller Anteilnahme, «sie hat so eingesperrt gelebt, so allein!»
Marie-Laure lächelte, und Léa sah sie an, wie um zu sagen: «Sie sind dran!»
«… aber wir kommen bald wieder.»
«Donnerstag, Donnerstag! … Léa, kommst du auch am Donnerstag zum Mittagessen?»
«Ich komme», antwortete Léa.
Chéri hatte Edmée an der Schwelle zur Halle eingeholt, wo er dicht neben ihr stand, jeglicher Unterhaltung abgeneigt. Er hörte Léas Zusage und drehte sich um. «Ich hab’s. Wir machen einen Spaziergang», schlug er vor.
«Jaja, in eurem Alter ist das genau das Richtige», bekräftigte Madame Peloux gerührt. «Edmée geht mit Chéri an der Spitze, er führt uns, und wir anderen folgen ihnen. Platz für die Jugend! Platz für die Jugend! Chéri, mein Schatz, würdest du nach Marie-Laures Auto schicken?»
Obwohl ihre kleinen runden Füße auf dem Kies ins Stolpern gerieten, begleitete sie ihre Besucherinnen bis zur Biegung einer Allee und überließ sie dann Chéri. Als sie zurückkam, hatte Léa ihren Hut abgenommen und sich eine Zigarette angezündet.
«Wie hübsch sie sind, alle beide!», keuchte Madame Peloux. «Nicht, Léa?»
«Hinreißend», hauchte Léa und stieß eine Rauchwolke aus. «Aber diese Marie-Laure …!»
Chéri kehrte zurück.
«Was ist denn mit Marie-Laure?», fragte er.
«Solch eine Schönheit!»
«Ah …! Ah …!», stimmte Madame Peloux zu, «das ist wahr, das ist wahr … sie war früher einfach entzückend!»
Chéri und Léa sahen sich an und lachten.
«Früher!», hob Léa hervor. «Aber sie ist die Jugend selbst! Sie hat keine einzige Falte! Und sie kann zartes Mauve tragen, diese miese Farbe, die ich hasse und die sich an mir rächt!»
Die großen, unbarmherzigen Augen und die schmale Nase wandten sich von einem Glas Weinbrand ab. «Die Jugend selbst! Die Jugend selbst!», kreischte Madame Peloux. «Entschuldigung! Entschuldigung! Marie-Laure hat Edmée 1895 bekommen, nein, 94. Da war sie mit einem Gesangslehrer durchgebrannt und hatte Khalil-Bey12 abserviert, der ihr den berühmten rosa Diamanten geschenkt hatte, den … Nein! Nein …! Moment mal … Das war im Jahr davor …!»
Sie trompetete laut und falsch. Léa legte eine Hand über ihr Ohr, und Chéri sagte von oben herab: «Wäre zu schön, so ein Nachmittag, ohne die Stimme meiner Mutter.»
Sie sah ihren Sohn gleichmütig an, an seine Frechheiten gewöhnt, und versank würdevoll, mit baumelnden Füßen, in einem Ohrensessel, der für ihre kurzen Beine zu hoch war. In ihrer Hand wärmte sie ein Glas Eau de Vie. Léa, die in einem Schaukelstuhl hin- und herwippte, warf von Zeit zu Zeit einen Blick zu Chéri hinüber, der sich mit offener Weste auf dem kühlen Korbstuhl rekelte, eine halb erloschene Zigarette an der Lippe und eine Haarsträhne über der Augenbraue – und schmeichelnd, ganz leise, nannte sie ihn einen schönen Schurken.
Sie saßen Seite an Seite, ohne das Bestreben, einander zu gefallen oder zu sprechen, friedfertig und irgendwie glücklich. Ihre lange Vertrautheit ließ sie schweigen, machte Chéri antriebslos und Léa heiter. Wegen der zunehmenden Hitze zog Madame Peloux ihren engen Rock bis zu den Knien hoch, enthüllte ihre kurzen Matrosenwaden, und Chéri riss wütend an seiner Krawatte, eine Geste, die Léa mit einem schnalzenden «Tz, tz …» tadelte.