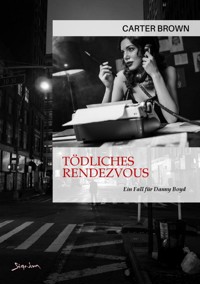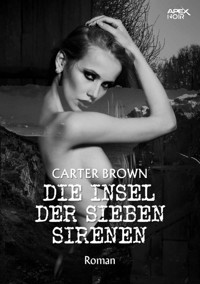4,99 €
Mehr erfahren.
Drei reiche Männer und drei schöne Frauen verbringen intime Ferien in Mexiko - wie störend wirkt da doch eine zerschmetterte Leiche im Gebüsch!
Privatdetektiv Danny Boyd muss die Sache bereinigen.
Aber wenn es nur das wäre. Denn die Witwe trauert um einen noch weitaus schmerzlicheren Verlust: Juwelen im Wert von 200.000 Dollar - Juwelen, die sie nur im Bett zu tragen pflegte.
Und genau da beginnen für Danny die Komplikationen.
Schließlich spitzt sich die Krise zu, als sich die illustre Gesellschaft auf einem englischen Landschloss versammelt: zu einem Sit-in der Liebe, zu Brutalität und Mord...
Der Kriminal-Roman Danny zählt bis drei des australischen Schriftstellers Carter Brown (* 1. August 1923 in London, England unter dem Namen Alan Geoffrey Yates; † 5. Mai 1985 in Sydney, Australien) erschien erstmals im Jahr 1969; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1970 (unter dem Titel Ich zähle bis drei).
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
CARTER BROWN
Danny zählt bis drei
Roman
Signum-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DANNY ZÄHLT BIS DREI
Prolog
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Das Buch
Drei reiche Männer und drei schöne Frauen verbringen intime Ferien in Mexiko - wie störend wirkt da doch eine zerschmetterte Leiche im Gebüsch!
Privatdetektiv Danny Boyd muss die Sache bereinigen.
Aber wenn es nur das wäre. Denn die Witwe trauert um einen noch weitaus schmerzlicheren Verlust: Juwelen im Wert von 200.000 Dollar - Juwelen, die sie nur im Bett zu tragen pflegte.
Und genau da beginnen für Danny die Komplikationen.
Schließlich spitzt sich die Krise zu, als sich die illustre Gesellschaft auf einem englischen Landschloss versammelt: zu einem Sit-in der Liebe, zu Brutalität und Mord...
Der Kriminal-Roman Danny zählt bis drei des australischen Schriftstellers Carter Brown (* 1. August 1923 in London, England unter dem Namen Alan Geoffrey Yates; † 5. Mai 1985 in Sydney, Australien) erschien erstmals im Jahr 1969; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1970 (unter dem Titel Ich zähle bis drei).
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
DANNY ZÄHLT BIS DREI
Prolog
Man bettete Charles Van Hulsden III. auf einem Privatfriedhof zur letzten Ruhe, der hoch oben auf einer windgepeitschten Landspitze an der Küste von Maine liegt. Wegen der tragischen Umstände, die zu seinem Tod geführt hatten, wurde die Zahl der Trauergäste auf Verwandte und nahe Freunde begrenzt. Allerhöchstens dreihundert Limousinen folgten dem Leichenwagen. Eine Phalanx aus Polizisten schirmte den letzten Akt der Trauerfeierlichkeiten wirksam gegen Presse und Schaulustige ab.
Der gischtgekrönte Atlantik zu Füßen der Landspitze gab sich an diesem Tag finster und ruhelos. Heftiger Regen strömte auf den barhäuptigen Geistlichen nieder, der den Sarg begleitete. Ihm folgten unter einem wogenden Meer schwarzer Schirme die Trauergäste über schmale Pfade zum wartenden offenen Grab. Dass hier nur die ganz Reichen beigesetzt wurden, davon zeugen stumm und eindrucksvoll die umliegenden Gruften mit ihren schwelgerischen Kreuzen aus Marmor und den rührig gebildhauerten Engeln.
Ein respektloser Kolumnist hatte errechnet, dass alle Trauergäste zusammen schätzungsweise dreihundert Millionen Dollar schwer waren, wobei er einen Irrtum von fünfzig Millionen darüber oder darunter nicht ausschloss. Er mutmaßte außerdem, dass Wallstreet sich auf dem Stand von 1929 wiedergefunden hätte, wenn die ganze Trauergesellschaft von einem monströsen Missgeschick ausgelöscht worden wäre.
Charles Van Hulsden III. hinterließ ein Vermögen von annähernd vierzig Millionen Dollar, eine Witwe und keine Kinder. Seine Beisetzung an jenem unwirtlichen Apriltag wurde mit dem ganzen Pomp zelebriert, der dem Ableben eines Multimillionärs zukommt. Seine Witwe war ganz in das traditionelle Schwarz gekleidet. Das einzige Bild von ihr, das in der Presse erschien, zeigte einen verwischten weißen Fleck hinter einem dichten schwarzen Schleier. Als ich ihr zum ersten Mal begegnete, war Charles Van Hulsden III. gerade drei Monate tot.
Erstes Kapitel
Sie lebte in einem zweigeschossigen Penthouse auf der Fifth Avenue in der Gegend der Eightieth, und man brauchte fast ein polizeiliches Führungszeugnis, um überhaupt erst mal am Pförtner vorbeizukommen. Schon der Fahrstuhl war besser eingerichtet als mein eigener Laden am Central Park West. Ein Butler öffnete die Tür – etwa der jüngste seines Gewerbes, der mir je im Leben begegnet war, höchstens fünfundzwanzig und von jener düsteren Schönheit, die üblicherweise nur einem spanischen Stierkämpfer zukommt. Ich nannte ihm meinen Namen und folgte ihm durch den Tanzsaal, der hier als Eingangshalle aushalf, in den Wohnraum.
Während der Butler mich ansagte, drehte sich die am Fenster stehende Frau langsam zu mir um. Das rabenschwarze Haar hing ihr über die Schultern herab bis exakt auf die Brustspitzen. Das dunkle Jadegrün ihrer schimmernden Augen kontrastierte höchst bekömmlich mit dem durchsichtigen Weiß ihrer Haut. Ihr üppiger, voller Mund war arrogant aufgeworfen. Sie trug eine nur scheinbar schlichte Kreation aus Seide in der Farbe rosigen Sorbets. Das hemdartig geschnittene Jackett war vorn durchgeknöpft und zeichnete gezielt die Konturen ihrer hohen spitzen Brüste nach; die maßgeschneiderte Hose saß hauteng um ihre langen, wohlgeformten Beine. Die baumelnden Ohrringe hatten bestimmt ursprünglich in einem jener kleinen exklusiven Schaufenster bei Tiffany gelegen, schätzte ich.
»Mr. Boyd.« Ihre Stimme hatte den Klang kühler Sicherheit, die ein achtstelliges Bankkonto einem kaufen kann. »Ich bin Sorcha Van Hulsden, die Witwe.« Sie blickte über meine Schulter den Butler an. »Stella möchte uns einen Martini mixen.«
Der gehauchte Seufzer, der den hinausgehenden Butler begleitete, kam von der sich schließenden Tür. Draußen auf der Straße war schlichter Manhattan-Sommertag, mit Temperaturen um fünfunddreißig Grad und entsprechender Luftfeuchtigkeit. Der klimatisierte Wohnraum gehörte in eine andere Welt, in eine Welt, in die nichts derartig Ordinäres wie Lärm und Wetter eingelassen wurde. Ich sinnierte müßig, ob die verwitwete Dame wohl den ganzen Sommer über einfach zu Hause blieb oder eventuell ihren ganz eigenen klimatisierten Hubschrauber auf dem Dach stehen hatte.
»Nehmen Sie Platz, Mr. Boyd.« Sie wies auf einen Sessel mit geschnitzter Mahagonilehne. »Sie haben einen Vornamen, schätze ich?«
»Danny«, sagte ich und ließ mich in den Sessel sinken.
»Nennen Sie mich Sorcha.« Sie setzte sich in das daunengepolsterte Sofa aus leuchtendgrünem Samt mir gegenüber. »Wir sind im Begriff, alte Freunde zu werden, Danny.«
»Wie schön. Ich habe schon immer davon geträumt, einmal in die oberste Kiste zu kommen.«
Ein blondes Mädchen kam mit den Drinks. Ihre knappe Serviertracht aus schwarzem Satin betonte die Fülle ihrer Vorder- und die dralle Pracht ihrer Hinteransicht. Während sie mir den Martini reichte, drehte ich kaum merklich den Kopf, um sie mein linkes Profil sehen zu lassen, das schlichtweg vollkommen ist, eine Spur gelungener noch als das rechte. Da sie aber unbeeindruckt blieb, musste sie kurzsichtig sein.
»Sie wissen, dass mein Mann vor drei Monaten starb?«, fragte Sorcha mich, nachdem das Mädchen gegangen war.
Ich nickte. »In Mexiko, erinnere ich mich.«
»Er fiel aus dem falschen Fenster«, sagte sie gelassen, »und landete, durchbohrt von einer Baumspitze, hundert Meter tief im Tal. Charlie war zu jenem Zeitpunkt schauderhaft betrunken, natürlich, aber es gelang mir, die örtlichen Behörden dazu zu bewegen, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Das bedurfte natürlich einiger umsichtiger Manöver, wie Sie sich denken können, außerdem musste alles Mögliche andere geregelt werden. Es ist begreiflich, dass ich meinen Schmuck darüber total vergaß.«
»Ihren Schmuck?«, fragte ich gedehnt.
»Wir waren zu siebt auf der Hazienda, bis Charlie aus dem Fenster fiel. Die andern fünf sind am folgenden Tag abgereist, also muss es offenkundig einer von ihnen getan haben.«
»Was getan haben?«, fragte ich begriffsstutzig.
»Meinen Schmuck gestohlen!« Ihre jadegrünen Augen funkelten vor Ungeduld. »So beschränkt können Sie doch nicht immer sein, Danny, oder?«
Ich schluckte etwa ein Drittel meines stattlich bemessenen Martinis hinunter, beschloss, den albernen Witz über meine Beschränktheit zu ignorieren, und konzentrierte mich darauf, aus den tausend Fragen, die mir im Kopf herumschwirrten, die erste auszuwählen.
»Wieso brauchen Sie mich dazu?«, wollte ich wissen. »Die Versicherungsgesellschaft hat ihre eigenen Detektive.«
»Ich habe der Versicherung den Verlust nicht gemeldet und beabsichtige auch nicht, es zu tun«, schnauzte sie. »Die Sache würde unweigerlich bis in die Zeitungen durchsickern, und mir reicht die Publicity bei Charlies Tod bis an mein Lebensende. Außerdem gibt es noch andere Gründe.«
»Welchen Wert hat der fehlende Schmuck?«
Sie zuckte die Schultern. Diese Geste besagte eindeutig, dass eine solche Frage schlechter Stil sei, vergleichbar etwa der Frage nach der bevorzugten Farbe für ihre Dessous. »Um zweihunderttausend Dollar, schätze ich, vielleicht mehr.«
»Und Sie haben drei Monate gewartet, ehe Sie sich entschlossen, etwas zu unternehmen?«, fragte ich heiser.
»Zeit spielt keine Rolle«, antwortete sie gleichgültig. »Alle Stücke sind antik. Der Dieb kann sie folglich nur an einen Sammler loswerden, wenn er auch nur annähernd ihren Wert erzielen will.«
»Der Dieb wird vermuten, Sie hätten den Verlust schon der Polizei und der Versicherung gemeldet. Folglich wird er den Schmuck erst zum Verkauf anbieten, wenn er sich einigermaßen sicher fühlen kann.« Ich nickte. »Sie haben recht, wir haben noch viel Zeit. Was wollten Sie eigentlich in Mexiko?«
»Wir machten dort zwei Wochen Ferien. Mit ein paar« – ihr Mund verzog sich – »besonders guten Freunden.«
»Jede Menge Partys, jede Menge Gäste, diese Art Fez?«
»Im Gegenteil. Wir haben die abgelegene Hazienda extra gemietet, um ausspannen und beisammen sein zu können.«
Ich starrte sie ein paar Sekunden an. »Warum haben Sie denn dann den Schmuck überhaupt mitgenommen? Fühlten Sie sich ohne ihn nackt oder so?«
»Könnte man sagen!« Ihr verschlossener Gesichtsausdruck ließ erkennen, dass sie sich über dieses Thema nicht weiter verbreiten würde.
»Okay«, knurrte ich. »Warum glauben Sie, sei es einer Ihrer Gäste gewesen? Und nicht einer der Dienstboten?«
»Es kam nur eine Frau aus dem Dorf, um täglich für uns zu kochen. Sie hat nie eines der Schlafzimmer betreten. Wenn ich mich recht erinnere, ist sie überhaupt nie über die Küche rausgekommen. Sie steht auf keinen Fall zur Debatte.«
»Dann informieren Sie mich über die fünf Gäste.«
»Außer Charlie und mir waren es drei Männer und zwei Frauen«, begann sie lebhaft. »Ich hatte geglaubt, alle seien besonders gute Freunde, aber einer muss noch gemeiner sein als ein ganz gewöhnlicher Dieb. Eine Freundin zu bestehlen, in deren Haus man auch noch zu Gast ist, scheint mir in der Tat verabscheuungswürdig. Ich bin nicht gesonnen, ihn oder sie ungeschoren davonkommen zu lassen. Sie dürfen das auch nicht, Danny!«
»Ich bin mir nicht ganz im Klaren, was Sie wollen«, sagte ich. »Den Schmuck oder den Dieb?«
»Beides«, antwortete sie, ohne zu zögern. »Aber Sie kümmern sich um den Schmuck.« Langsam leckte sie ihre Unterlippe, als koste sie den Geschmack. »Um den Dieb kümmere ich mich, wenn der Schmuck wieder da ist.«
»Die fünf guten Freunde – haben die auch Namen?«
»Bei den beiden Frauen handelt es sich einmal um die ehrenwerte Daphne Talbot-Frith – ich brauche wohl nicht hinzuzufügen, dass sie Engländerin ist – und um Amanda Peacock. Die drei Männer heißen Edward Waring, Ross Sheppard und Marvin Reiner. Ich werde Ihnen nichts weiter über sie sagen, weil ich meine, dass Sie ohne irgendwelche vorgefassten Meinungen besser mit ihnen fertig werden.«
»Vielleicht doch einen winzigen Hinweis?«, bat ich hoffnungsvoll. »Womit sie, beispielsweise, ihr Geld verdienen.«
»Also gut, einen winzigen Hinweis.« Ihr Lachen war spöttisch. »Daphne tut gar nichts, weil ihr adliger Vater ihr einen beachtlichen Wechsel gibt, solange sie ihm vom Halse bleibt. Amanda ebenso. Sie lebt von der Abfindung aus ihrer letzten Scheidung. Edward, auch Engländer, ist Handelsbankier. Vermutlich hätte Charlie gewusst, was das ist, ich habe keinen Schimmer. Ross ist professioneller Playboy – so eine Art Handelsvertreter mit ausgeprägtem Profitstreben –, sein Gewerbe sind Frauen. Bleibt noch Marvin, nicht wahr?« Sie kniff die Augen zusammen und zuckte dann die Schultern. »Tja, Marvin ist einfach Marvin.«
Ich sah sie finster an. »Sie sind eine enorme Hilfe, Sorcha! Und wo finde ich Ihre Freunde?«
»Ich weiß nicht, wo Edward und Marvin augenblicklich stecken, die anderen drei sind in England. Mindestens einer davon wird wissen, wo Sie Edward und Marvin auftreiben können. Ich bin sicher, dass meine Freunde sich auf Grund Ihrer überragenden Persönlichkeit glücklich schätzen werden, Ihnen Rede und Antwort zu stehen. Übrigens meine ich, Sie sollten mit Daphne den Anfang machen.«
»Wo finde ich sie?«
»Ihr Vater verbringt den Sommer am Mittelmeer, was sie zum Anlass nimmt, im angestammten Familienbesitz in Essex die fürchterlichsten Dinge zu treiben. Es hat, was Daphne betrifft, zwei unbezahlbare Vorteile. Erstens liegt der Besitz weit ab von irgendwelcher Zivilisation, und zweitens ist das Personal dort versichert. Ich habe alles aufgeschrieben, Danny, und zu einem hübschen, fetten Aktenbündel zusammengestellt. Mitsamt Farbfotos der gestohlenen Schmuckstücke und einem Einführungsbrief an jeden meiner lieben Freunde, um zu verhindern, dass man Sie für nicht gesellschaftsfähig hält.« Die Brauen hoben sich eine Spur. »Falls Sie nämlich diesen Anzug bei den Begegnungen tragen.«
»Für diesen Anzug habe ich zweihundert Dollar bezahlt«, warf ich indigniert ein.
»Ich rede nicht vom Geld, ich rede vom Schneider«, machte sie mir mit leidender Stimme klar. »Versuchen Sie doch mal Savile Row, wenn Sie schon in England sind. Ich gebe zu, dass Revers nicht platt aufliegen sollen, aber müssen es gleich wogende Wellen sein?«
»Eines meiner Geschäftsprinzipien ist, dass kein Klient mich beleidigen darf, ehe er gezahlt hat«, schnappte ich zurück.
»Dem Aktenbündel beigefügt ist ein Scheck über zehntausend Dollar, die Sie bitte als Spesen betrachten wollen. Finden Sie meinen gestohlenen Schmuck und bringen Sie ihn mir zurück, dann zahle ich noch mal zehntausend Dollar.« Sie unterdrückte ein leichtes Gähnen. »Ist das zufriedenstellend?«
»Sicher.« Ich schluckte heftig. »Wie sind Sie eigentlich auf mich verfallen, Sorcha?«
»Sie sind das handgepflückte Ergebnis sorgfältiger Erkundigungen eines befreundeten Anwalts, der in solchen Dingen ungemein tüchtig ist.« Ihre grünen Augen glitzerten schwach. »Ich weiß eine ganze Menge über Sie, Danny. Ich kenne Ihre Privat- und Büroadresse, beispielsweise, den derzeitigen Stand Ihrer Finanzen und die exakten Ergebnisse Ihrer drei letzten Aufträge. Wichtiger ist noch, dass Sie als gerissen, skrupellos, unmoralisch und eitel gelten. Sie genießen gleichfalls den Ruf, Ihren Klienten gegenüber absolut loyal zu sein, solange Sie gut bezahlt werden. Ich zahle immer gut.«
Ich bastelte an einer passenden Antwort, während ich den Martini leerte. »Sie haben gutaussehend und sexy vergessen«, sagte ich schließlich.
»Eine Frage des Geschmacks, keine Tatsache«, antwortete sie. »Ich finde Crewcut ordinär und Eitelkeit unerträglich. Vielleicht ist mein Hausmädchen da anderer Meinung. Ich darf nicht vergessen, sie nachher zu fragen.«
»Und eben wollten Sie aus uns noch alte Freunde machen!«
»Ich habe meine Meinung darüber geändert.« Ihre Stimme war wieder selbstgefällig. »Im Übrigen wird es mir einen besseren Einblick in Ihre Arbeit gewähren, wenn ich nicht emotional befangen bin. Ich wünsche, dass Sie in engem Kontakt zu mir bleiben, Danny, wie immer die Ermittlungen auch laufen mögen. Sie können mich anrufen. Ich wünsche auch, eine detaillierte Spesenabrechnung vorzufinden, wenn Sie die Ermittlungen abgeschlossen haben.«
»Wissen Sie was, Sorcha?« Ich grinste sie an. »Sie mögen eine trauernde Witwe aus der obersten Kiste sein, meine Dame, aber Sie sind auch ein Luder!«
»Genauso hat Charlie mich immer genannt. Aber in einem Punkt irren Sie: Ich bin erst durch meine Heirat nach oben geraten. Meine Familie war arm; zu keiner Zeit hätte sie mehr als eine halbe Million Dollar zusammenbekommen.« Sie lachte weich – ein tiefer, gurgelnder Ton in ihrer Kehle. »Ich hoffe, Sie erhalten sich Ihre Abneigung gegen mich, Danny, weil ich glaube, dass Sie auf diese Weise bessere Arbeit leisten.«
Sie erhob sich vom Sofa, und während sie zum Kamin ging, um den verborgenen Klingelknopf zu betätigen, knisterte der Hosenanzug leise. Sekunden später öffnete sich die Tür, und herein kam die blonde Schöne.
»In der Bibliothek auf dem Schreibtisch liegt ein großer Umschlag, der an Mr. Boyd adressiert ist, Stella. Bitte zeigen Sie Mr. Boyd den Weg, damit er ihn mitnehmen kann.« Sie sah mich an, in ihren jadegrünen Augen verbarg sich ein heimliches Vergnügen. »Auf Wiedersehen, Mr. Boyd. Es war äußerst amüsant, mit Ihnen zu plaudern. Ich erwarte, bald von Ihnen zu hören.«
Ich folgte dem Mädchen durch die geräumige Halle in einen Raum, dessen Wände aus Büchern bestanden, und schloss messerscharf, dass es sich hier um die Bibliothek handele. Sie nahm einen dicken Umschlag vom lederbezogenen Schreibtisch, aber als sie ihn mir reichen wollte, fiel er ihr aus der Hand. Der Anblick ihres üppig gerundeten Popos, als sie sich bückte, um den Umschlag aufzuheben, war zu viel für Boyds tierische Instinkte. Ich bedachte ihn mit einem spielerischen Klaps von der Art, bei der die Hand zwar ein wenig verweilt, jedoch nicht lange genug, um in Anzüglichkeiten auszuarten. Sie richtete sich sofort auf und wandte sich mir mit feindseligen Augen zu.
»Machen Sie das nicht noch mal!«, sagte sie eisig.
»Eine impulsive Reaktion«, belehrte ich sie. »Eine instinktive Huldigung an die bemerkenswerte Schönheit Ihres Gesichts und Ihrer Figur.« Ich versorgte sie mit jenem langsamen, zerknirschten Lächeln, das im Spiegel einfach umwerfend aussieht. »Warum nennen Sie mich nicht Danny?«
Ihre Augen blickten immer noch feindlich. Die Situation schrie förmlich nach schweren Geschützen, also bediente ich sie mit beiden Profilen, erst dem rechten, dann dem linken. Aber sie verzog keine Miene.
»Sie tragen Ihre Brille wohl nicht gern?«, fragte ich hoffnungsvoll.
»Ich brauche keine, ich besitze ein völlig intaktes Sehvermögen.« Sie drückte mir den Umschlag in die bebenden Finger. »Stevens wird Sie hinausbegleiten, Mr. Boyd.«
»Stevens? Das ist doch der Stierkämpfer, oder?«
»Der Butler!«
»Ich dachte, dass er für Sie vielleicht ein Stierkämpfer ist, weil er den einzigen Mann in Ihrem Leben darstellt!«
Der Anflug eines Lächelns zeigte sich auf ihren Lippen, doch fing sie es wieder ein. »Ausgesprochen witzig, Mr. Boyd. Obwohl ich bezweifle, dass Sie ahnen, wie witzig. Aber machen Sie sich deshalb keine schlaflosen Nächte. Auf Wiedersehen, Mr. Boyd.«
»Die Frigiden sind nie im Leben so gebaut wie Sie«, beharrte ich. »Was ist also los mit Ihnen?«
»Auf Wiedersehen, Mr. Boyd.« Ihre Stimme klang ziemlich endgültig.
»Auf Wiedersehen, Stella«, sagte ich bedauernd. »Ich finde es nur einfach unfair den Männern gegenüber, dass Sie, sollten Sie frigide sein, immerzu diesen knappen schwarzen Satin tragen.«
Ich marschierte aus der Bibliothek und fand in der Halle den wartenden Butler vor. In seinen dunklen Augen leuchtete für Sekunden warme Anteilnahme auf, während er mich zur Tür brachte.
»Es ist ein Jammer, Mr. Boyd, dass man den Frauen nicht über den Weg trauen kann«, sagte er beim Öffnen der Tür. »Wir Männer sind da doch ganz anders. Wenn wir jemanden mögen, zeigen wir es auch.«