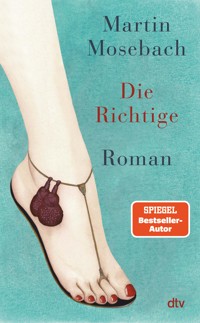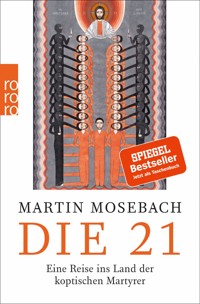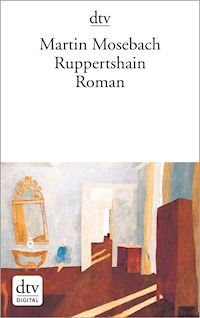14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Planvoll oder zufällig, hier kommen sie zusammen, Menschen von allen Ecken und Enden des Lebens: eine Malerin, die über den Aufbau eines Stilllebens (Kiesel und Koralle, Schmetterling, Perle und Taubenei) mit einer Freundin streitet; ein Junge auf einem Fahrrad, glücklich dahinrasend wie außerhalb der Zeit; eine Liebhaberin des Weins, die sich auf dem Sterbebett endlich die kostbare, seit Jahrzehnten aufgesparte Flasche bringen läßt; ein Mann vor einem Spalt im Vorhang einer Umkleidekabine, gebannt erlebend, wie sich der Spalt erst mit einem warmen Farbton füllt, dann mit gerundeten Formen, dann mit dunklen Linien - eines Beins?, eines Arms? -, die sich vor seinen Augen hin und her bewegen, "langsam und schwimmend wie ein Wels am Grund eines Flusses". Die Miniaturen dieses Buchs erfassen die Welt in Augenblicken. Sie sind Erzählpracht auf engstem Raum, lassen im Handumdrehen Szenen und Figuren entstehen, und so kurz sie sind, so vielgestaltig sind sie in Darstellung und Ton - komisch oder ernst, romanhaft ausgreifend oder dramatisch oder satirisch, dann wieder gelöst, beruhigt. Nur in Sinnlichkeit und Intensität gleichen sich die winzigen Progressionen in der Zeit, die Martin Mosebach beschreibt; es sind die Augenblicke, die unser Leben vor allem ausmachen, die Augenblicke, in denen man, beglückt oder überrascht wie beim Lesen dieser Geschichten auch, etwas von seiner Kürze und Unwiederholbarkeit begreift.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Martin Mosebach
Das Leben ist kurz
Zwölf Bagatellen
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Planvoll oder zufällig, hier kommen sie zusammen, Menschen von allen Ecken und Enden des Lebens: eine Malerin, die über den Aufbau eines Stilllebens (Kiesel und Koralle, Schmetterling, Perle und Taubenei) mit einer Freundin streitet; ein Junge auf einem Fahrrad, glücklich dahinrasend wie außerhalb der Zeit; eine Liebhaberin des Weins, die sich auf dem Sterbebett endlich die kostbare, seit Jahrzehnten aufgesparte Flasche bringen läßt; ein Mann vor einem Spalt im Vorhang einer Umkleidekabine, gebannt erlebend, wie sich der Spalt erst mit einem warmen Farbton füllt, dann mit gerundeten Formen, dann mit dunklen Linien – eines Beins?, eines Arms? –, die sich vor seinen Augen hin und her bewegen, «langsam und schwimmend wie ein Wels am Grund eines Flusses».
Die Miniaturen dieses Buchs erfassen die Welt in Augenblicken. Sie sind Erzählpracht auf engstem Raum, lassen im Handumdrehen Szenen und Figuren entstehen, und so kurz sie sind, so vielgestaltig sind sie in Darstellung und Ton – komisch oder ernst, romanhaft ausgreifend oder dramatisch oder satirisch, dann wieder gelöst, beruhigt. Nur in Sinnlichkeit und Intensität gleichen sich die winzigen Progressionen in der Zeit, die Martin Mosebach beschreibt; es sind die Augenblicke, die unser Leben vor allem ausmachen, die Augenblicke, in denen man, beglückt oder überrascht wie beim Lesen dieser Geschichten auch, etwas von seiner Kürze und Unwiederholbarkeit begreift.
Über Martin Mosebach
Martin Mosebach, geboren 1951 in Frankfurt am Main, hat sich nach dem II. juristischen Staatsexamen 1979 in seiner Geburtsstadt als Schriftsteller niedergelassen und lebt dort noch heute. Sein erster Roman, «Das Bett», kam 1983 heraus; seither sind neun hochgelobte, in mehrere Sprachen übersetzte Romane entstanden, dazu Erzählungen, Gedichte, Libretti und Essays über Kunst und Literatur, über Reisen, über religiöse, historische und politische Themen. Dafür hat Mosebach zahlreiche Auszeichnungen und Preise erhalten, darunter den Heinrich-von-Kleist-Preis, den Georg-Büchner-Preis und die Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt. Zuletzt sind 2010 der Roman «Was davor geschah», 2011 die Essaysammlung «Als das Reisen noch geholfen hat» und 2014 der Roman «Das Blutbuchenfest» erschienen.
I
Das Fahrrad
Ein flüchtiges Phänomen
Da steht mein Fahrrad, an eine Laterne angekettet, wie ich es verlassen habe. Dieser Anblick ist immer neu erstaunlich. Während ich mich auf die Laterne zubewegte, fragte ich mich gespannt: Wird es noch dasein? Ginge es nach den Naturgesetzen, wäre es weg. Einsame Fahrräder, an Laternen gekettet, sind Magneten. Sie stehen still, aber sie erzeugen fremde Bewegung. Von fern nähert sich der ausländische Lieferwagen. Die Männer, die ihm entsteigen, haben eine lange Zange dabei. Sie zwackt durch die Stahlkette wie die Nagelschere durch den Fingernagel. Manchmal widmen sie sich auch nur den Rädern; danach steht das Fahrrad gerupft da, geradezu wie das Messer ohne Klinge, dem der Stiel fehlt. Und dann ereignet sich eben doch immer wieder dies Eintreten des Erhofften und Erträumten. Man biegt um die Ecke, und da steht das Rad. Mag die Sonne heute abend gerne sinken, sie wird morgen wieder aufgehen.
Fahrräder werden nur von denen besessen, die gerade daraufsitzen. Sie sind den Katzen vergleichbar; wer würde wagen zu behaupten, daß eine Katze ihm gehört, bloß weil er sie gekauft hat, sie ernährt, sie impfen läßt und die Wohnung mit ihr teilt? «Mein Fahrrad» – das war das Fahrrad unterm Weihnachtsbaum, von warmem Kerzenlicht mit goldenen Glanzpünktchen übersät. Im Weihnachtszimmer, mit einer großen Schleife geschmückt, an der eine Karte mit meinem Namen hing, gehörte es mir. Als ich es ins Freie brachte, als seine Reifen Asphalt unter sich spürten und Regentropfen sich auf die verchromte Lenkstange setzten, da gab ich es schon halb preis. Es war ein schönes Fahrrad, «mit Gangschaltung», wie das damals hieß – naiv, wenn man an die dreißig Gänge moderner Räder denkt. Das Schloß war nur ein kleiner Riegel, der sich zwischen die Speichen schob. Ich stellte es vor dem Kino ab, im blauen Winterlicht, das den Schwarzweißfilm vorwegnahm. Als ich das Kino wieder verließ, war das Fahrrad weg. So lernte ich sein Wesen begreifen.
Mein Fahrrad heute gehört mir nicht. Das ist meine List: Was mir nicht gehört, kann mir nicht gestohlen werden. Es hat sich mir zugesellt. Zwei Leute hadern deswegen miteinander. Wenn es der dumme Zufall will, daß die beiden Menschen, die glauben, Eigentümer meines Fahrrads zu sein, und mein Fahrrad sich begegnen, erhebt sich Streit. «Das Fahrrad gehört der Firma! Ich habe das Fahrrad seinerzeit für die Firma erworben!» sagt die gutturale Schweizer Stimme. «Das Fahrrad wurde seinerzeit zu meinem persönlichen Gebrauch erworben!» sagt die nasale Mecklenburger Stimme. «Das Fahrrad war nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses dem Firmenfundus rückzuübereignen!» – «Das Fahrrad war durch zahllose Schuldansprüche gegen die Firma bereits konsumiert, restlos aufgezehrt!» – «Da hätten Sie eine Rechnung aufmachen müssen; das haben Sie seinerzeit versäumt!» – «Das mußte ich überhaupt nicht – das Fahrrad ist implizit und konkludent in mein Eigentum übergegangen!» Währenddessen habe ich sehr behutsam, ohne es metallisch klicken zu lassen, das Schloß geöffnet, habe das Fahrrad leise zwischen den beiden Herren hindurchgeschoben, mich darauf geschwungen und bin davongefahren. Jetzt spüre ich das Entweichende, das Sich-Entziehende im Geist meines Fahrrads besonders deutlich.
Inzwischen ist mir mein Fahrrad zugewachsen, ohne es selbst zu merken. Wie es gerade notwendig war, habe ich eines nach dem anderen alle Teile, aus denen es einstmals bestand, austauschen lassen. Eine neue Fahrradkette, neue Schutzbleche, eine neue Lenkstange, ein neuer Gepäckträger, ein neuer Sattel. Alt ist nun nur noch die Nummer auf dem Rahmen, die so tut, als sei dies noch dasselbe Rad. Und ist doch das hybrideste Gebilde: im ganzen fremdes Eigentum, im einzelnen ganz mein. Merkur mit den Flügelchen an den Sandalen, ein Radfahrer ohne Rad, die Kaufleute und die Diebe beschützend, wird es für mich bewahren.
Fahrrads Eigenwillen
Das Fahrrad ist tot. Stählerne Röhren bilden seinen Leib; aber von einem Leib, von fülliger Skulptur kann eigentlich gar nicht gesprochen werden. Es ist der armselige, der rationalistische Ersatz von Pferd und Esel. Wenn noch so viele Leute am Wochenende ihr Pferd in einem Mietstall besuchen und dann auf beschilderten Waldwegen spazierenführen, ändert das nichts an der Tatsache, daß das Zeitalter des Pferdes untergegangen ist. Das schöne starke Tier, dessen Rücken sichtlich dafür geschaffen wurde, daß ein Mensch darauf sitzt, ist aus der jahrtausendealten Symbiose mit dem Reiter wieder entlassen. Wie Zentauren fühlten sich die Beherrscher des Pferdewillens. Kann man sich auch einen Fahrradzentauren vorstellen, einen Menschen, dessen Unterleib in eine einem Küchenmixer ähnelnde Apparatur übergeht?
Das Pferd schnaubt und dampft; auch wenn es sich den Absichten seines Herrn unterwirft und sie gar vorausahnt, ist es immer als Eigenwesen gegenwärtig. Das Fahrrad kann im Bewußtsein des Fahrradfahrers vollkommen verschwinden. Wenn die Luft lau ist und die Straße eben – hier stehen die Fahrradfahrer in der Schuld des Autos, denn für das Fahrrad allein hätte man niemals das ganze Land mit Betonpisten bedeckt –, wenn es keine Hindernisse gibt, dann kann eintreten, daß man das Fahrrad unter sich vergißt. Man fliegt durch die Luft, von einer unsichtbaren Schiene geführt, wie in älteren Inszenierungen Wagners Rheintöchter oder Mozarts drei Knaben an verborgenen Seilen durch den Bühnenraum schwebten. Aus den geschmeidig und ohne Mühe ablaufenden Strampelbewegungen ist etwas Weiches, Spielerisches geworden, ein Flossenpaddeln wie im Wasser, die Füße kreisen dort unten zu ihrem eigenen Wohlbefinden herum. Lautlos gleiten Bäume und Häuser vorbei, als würden auch sie von Bühnenarbeitern, allerdings in die entgegengesetzte Richtung, geschoben. Dann ist es Zeit für das Fahrrad, sich in Erinnerung zu bringen.
Die Selbstvergessenheit des Fahrers ist für das Fahrrad eine Provokation. Da, ein Schlagloch. Es ist tief; durch die Asphaltdecke und den Schotterbelag führt es zurück zur nährenden alten Erde. Wasser steht darin, trüb die Tiefe verschleiernd. Das Fahrrad saust hinein, es bäumt sich auf, es zuckt in ihm, es haut den Händen den Lenker aus der Hand. Wer darauf gesessen hat, weiß: Das war nicht das Schlagloch, das war das Fahrrad selbst. Es hat den Fahrer abgeworfen wie ein junges Pferd den unerfahrenen Reiter. Stürze vom Fahrrad werden von einem musikalischen Akkord begleitet, scheppernd, klingend, dröhnend. In der Stille, während der Geschundene mühsam aufsteht, dreht sich an dem liegenden Gestell ein Rad zwecklos träumerisch im Kreis. Das Fahrrad ist bei sich. Jetzt lebt es.
Wenn es dunkel wird, leuchtet der kleine Scheinwerfer, heller und dunkler werdend, wie von einem schlagenden Herzen angetrieben. Wer viele Gänge hat, kennt das Schnurren, das aus dem Fahrrad nach oben steigt, wie ein sanftes Motorengeräusch, aber nicht so monoton, organisch eben. Der stramm aufgepumpte Reifen ist ein trainierter harter Muskel; wenn die Luft entweicht, wird er schlaff und atrophisch, eine kränkliche Natur, die sich stolpernd und wund über die Pflastersteine schleppt. Heimtückisch sucht das Fahrrad gegen den Willen des Menschen Straßenbahnschienen und andere Rinnen. Da will es hinein, und wenn es drinnen ist, macht es wieder seinen berüchtigten großen Sprung. Niemandem gelingt es lange, das Fahrrad in einer Straßenbahnschiene aufrecht zu halten, denn ein Fahrrad kann man nicht dressieren.
Das subversive Fahrrad
Ist es möglich, auf einem Fahrrad würdevoll und wie ein ernstzunehmender Mensch zu wirken? In der Bernanos-Verfilmung von Robert Bresson schiebt der lungenkrebskranke jugendliche Landpfarrer in der regenschweren Soutane ein übergroß wirkendes Fahrrad den Hügel mit den verkrüppelten kahlen Apfelbäumen hinauf – da ist das Fahrrad wie ein der Heiligenstatue beigegebenes Folterinstrument, ein ikonographisches Attribut. Im Chien andalou von Dalí und Buñuel fährt im harten Sonnenlicht ein schwarzer Mann auf einem schwarzen Rad und wirft einen gefährlichen Riesenschatten. Hier ist das Fahrrad Signal einer surrealistischen Bedrohlichkeit. Aber sonst wirkt es stets untragisch, geheimnislos, provinziell. Wenn man in alten Lexika und Enzyklopädien die bewunderungswürdigen technischen Holzstiche aller möglichen Erfindungen und Apparaturen betrachtet, Zeugnisse eines halb verblendeten, halb genialen Bastler- und Erfindertreibens, das vor hundertzwanzig Jahren die Patentämter beschäftigte, dann ist man nah an der verstaubten Kauzigkeit, die irgendwie immer auch am Fahrrad haftet. Man kann sich vorstellen, wie der Erfinder die verlöteten Gestänge, die Pedale, die spielzeughafte Klingel einer Kommission vorführt, mit dem ganzen Stolz, der auch einer neuartigen Rattenfalle, einem noch nie gesehenen Petersiliezerkleinerer, einer Leselampe für eine Nordpolexpedition gelten könnte. Etwas von Pedalen in Schwung Gehaltenes ist ohnehin leicht lächerlich. Da gab es die Nähmaschine mit ihrem schweren gußeisernen Tisch. Oben beugte sich die Näherin konzentriert und still über die Naht; es war ein Bild der Stille und des Friedens, der Spitzenklöpplerin des Vermeer vergleichbar. Aber in der Kelleretage, verdeckt von der Platte des Arbeitstisches, wurde getrampelt. Der Frieden oben trog. Das Werk wurde weniger mit Auge und Hand – und das heißt: mit dem Geist – geleistet, sondern mit den Waden. Man stelle sich die Spitzenklöpplerin Pedale trampelnd vor! Der Zauber des Bildes wäre zumindest beeinträchtigt. Beim Tretboot wird das noch deutlicher. Rudern ist kraftvoll, männlich, eine würdige Tätigkeit. Treten ist komisch. Hans-Jürgen und Inge fahren am Sonntag Tretbötchen auf dem Main. Wir sehen die unbewegten Oberkörper des Paares büstenhaft starr an uns vorübergleiten, wie von Zauberhand nach vorn gezogen. Unter ihnen bewegt es sich, aber sie scheinen die Bewegung zu ignorieren. Es ist, als hielten sie mit ihrem Trampeln nicht nur das Boot, sondern auch sich selbst, ihr Lächeln, mit dem sie zum Ufer hinübergrüßen, und ihre paarige Zusammengesperrtheit in Gang, als stocke nicht nur die Fahrt des Bötchens, sondern als sänken sie selbst in sich zusammen, wenn sie zu trampeln aufhörten. Auch Klaviere gibt es zum Treten. Die gestanzte Rolle ist von Paderewski eingespielt worden; jetzt wird sie eingelegt, der Beweger nimmt auf dem Klavierhocker Platz, trampelt die Pedale, die Rolle beginnt sich abzuspulen, die Tasten senken sich wie von Geisterhand gedrückt, und himmlische Musik erklingt, während es vom Trampeln zugleich rhythmisch knarrt und rumpelt. Das Pianola ist eine Radtour durch die Impromptu-Gebirge und Berceusen-Täler des Chopin.
Und nun stelle man sich den Bizyklisten vor. Früher war manchmal vom «Affen auf dem Schleifstein» die Rede, als die Messerschleifer mit ihren gleichfalls pedalbetriebenen rundschwingenden Schleifmaschinen noch unterwegs waren. Das Rhesusäffchen im roten Frack, das sich mit anklagendem Tierblick an einem solchen runden Stein anklammert – ist es nicht in Körperhaltung und verkorkster Ausgeliefertheit dem über seine Lenkstange gebeugten, das Hinterteil in die Lüfte streckenden Radfahrer zutiefst verwandt? Der Mensch als sein eigener Galeerensklave, ein Räderwerk antreibend, das umfällt, sobald er zu strampeln aufhört – da wird ein Wort wie «Menschenwürde» unversehens zu einem sehr drolligen Begriff.
Fahrrad-Glück
Das Fahrradfahren wird für mich nach Jahrzehnten, in denen ich bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit durch dieselben Straßen gefahren bin, im Traum immer nur mit einem Bild verbunden bleiben: Die Schule ist aus. Es ist ein erstickend heißer Tag, der Asphalt schmilzt und steht an manchen Stellen als schwarzes Pech auf der Straßendecke. Der Aufenthalt im Klassenzimmer war eine Qual. Aber es war nicht die Hitze, die ihn unerträglich machte. Das war die Zeit des schlimmsten Schulbubengrauens, wo das «Nixtun» und «Nixlernen», wie Heimito von Doderer den entsprechenden Zustand in seinem eigenen Leben beschreibt, einen schier alptraumhaft schweren und hohen Berg von Schuld und Versagen aufgetürmt hat. Man hat so oft gemogelt, so oft geschwänzt, verschlafen, nicht zugehört, daß die entstandenen Lücken wahrscheinlich nicht mehr zu schließen sind. Jetzt fordert jeder Tag einen Offenbarungseid. Man rangiert jetzt in der Klasse ganz hinten, bei denen, die in ihrem Versagen, schon nicht mehr richtig fröhlich, vor sich hin faulen. Eine Arbeit ist zurückgegeben worden. Sie ist schlecht; man ist vom Pech der Schuld und der Vorwürfe ganz und gar beschmiert. Jetzt fällt es bereits schwer, die Unbefangenheit gegenüber den Mitschülern zu bewahren. In das freche Gesicht, das man macht, mischt sich etwas Gezwungenes. Über dem Schulhof steht die Hitze wie ein Block; wenn man da hineintaucht, wird die Schuld, die man geradezu auszudünsten meint, noch eng am Körper gehalten, sie kann nicht abziehen.
Und dann besteigt man das Fahrrad. Die Schule lag an einem Abhang. Das war ein Gefälle, das ein Fußgänger kaum spürt. Wie eine Stadt geologisch beschaffen ist, weiß nur der Radfahrer. Manche Straßen sehen ganz eben aus, aber man rollt sie hinab, ohne einmal in die Pedale zu treten. Die Straße neben meiner Schule war eine Allee, von Pappeln gesäumt. Hinter der dichten Pappelfront schaute die Ecke eines avantgardistischen Palastes aus den zwanziger Jahren hervor. Das gab der Vedute etwas magisch Modernes, altertümlich Fortschrittliches. Und in diese eingefrorene Zukunftsgewandtheit stürzte ich mich auf meinem Fahrrad. Die Straße war schnurgerade und lang, und schnell bekam das Fahrrad eine hohe Geschwindigkeit. Mein Hemd war halb aufgeknöpft, der Fahrtwind blähte es auf, der Schweiß auf der Stirn kühlte ab. In dieser sausenden Fahrt an den Pappelreihen entlang fiel das Miserable der vorangegangenen Stunden von mir ab. Die Geschwindigkeit erzeugte ein Triumphgefühl. Obwohl durch meine eigene Schuld alles unausdenklich schrecklich war, erlebte ich jetzt das reine Glück. Das konnte mir niemand, nicht einmal ich selbst mir rauben. Es gab meine Lebensgeschichte mit ihrer immer bedrohlicher werdenden Kausalitätenkette, aber daneben und dazwischen gab es diese Augenblicke der vollkommenen Freiheit. Am Anfang war das Glücksgefühl noch mit Trotz gemischt. Ich sauste den Berg hinunter, obwohl ich gerade überaus blamabel getadelt worden war, zu Lebensüberschwang also wahrlich kein Recht hatte. Aber jetzt verschwand dieser unreine Rest, der mich mit dem Vormittag verband. Er war aufgelöst und weggeweht. Dieses Rasen an der vergangenen Zukunft vorbei, im Lichtschatten der zahllosen Pappelblättchen, das war, der Geschwindigkeit zum Trotz, ein stilles Heraustreten aus der Zeit. Wenn ich am Ende der Straße dann um die Ecke bog und zu treten anfangen mußte, klang das schöne Gefühl noch eine ganze Weile nach. Es blieb stark, solange ich im Schatten der Kastanien fuhr, die hier die Pappeln ablösten.
Die Sicherheit des hohen Tons
«Warum sitzen hier so viele Leute herum? Was suchen diese Leute hier bloß alle?» Von einer richtigen Probe war heute doch nicht die Rede. Gestern erst ist Donna Anna eingetroffen; der Tenor sollte nur rasch ein Duett mit ihr durchgehen. «Warum hat dieser Saal keine Fenster? Warum ist die Luft hier so trocken und verbraucht?» Dem Tenor ist, als breche ihm gleich der Schweiß aus. Er greift sich ungeduldig an den Hemdkragen. Der Knopf geht nicht auf, er springt ab. Der Tenor trägt als einziger Künstler im Raum eine Krawatte. Er ist sorgfältig angezogen mit blankgeputzten Schuhen und gebügelten Hosen, ein adretter kleiner Mann, hübsch wie ein Zinnsoldat, gerade noch groß genug, um mit hohen Absätzen Liebhaberrollen übernehmen zu können. Er ist braungebrannt. Die etwas ins Mollige gehenden Wangen, das einzig Weiche an seiner straffen Gestalt, glänzen schokoladehaft. Jeder Tag ohne Sonne ist ein verlorener Tag. In diesem Saal ohne Tageslicht zerrinnt kostbare Lebenszeit. Wäre er jetzt an der Sonne, er brauchte nichts zu fürchten. Aber woher soll ohne Sonne die Kraft kommen?
Donna Anna ist weiß wie eine Porzellantasse, mit hellblonden Löckchen und einem pastellfarbenen Angorapullover, dessen feine Härchen ihre Gestalt mit einer hellblauen sfumatura umgeben. Sie lächelt. Sie ist Finnin und sieht gutmütig aus, aber sie hat keine Lust auf Unterhaltung. Der Tenor geht gern auf seine Kollegen zu, er hat «jungenhaften Charme», so hat es in einer Kritik gestanden, aber Donna Anna ist einsilbig, der Angora-Lichthof ist undurchdringlich und schirmt sie vor arglosen Zuwendungen ab. Nur eines will sie besprechen, aber nicht mit dem Tenor, sondern mit einem der Assistenten aus der Dramaturgie: Sofort soll man ihr ein anderes Hotel besorgen.