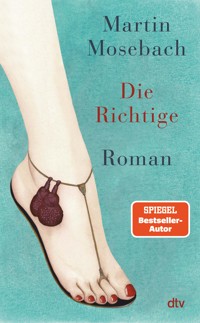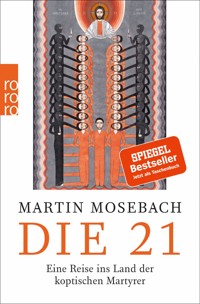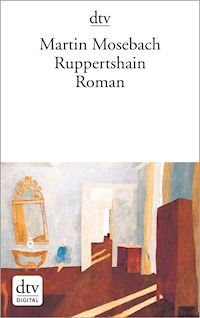Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ralph Krass – so heißt ein verschwenderisch großzügiger Geschäftsmann, der Menschen mit kannibalischem Appetit verbraucht. Ist er unendlich reich oder nur ein Hochstapler, kalt berechnend, oder träumt er hemmungslos? Er will sich seine Gesellschaft kaufen, immer nur selbst der Schenkende sein. Als in Neapel Lidewine in seinen Kreis tritt – eben noch die Assistentin eines Zauberers, eine junge Abenteurerin –, bietet er ihr einen ungewöhnlichen Pakt an. Beobachtet wird das Ganze von seinem Sekretär, dem Pechvogel Dr. Jüngel, mit einem Blick voll Neid und Eifersucht. Aber erst nachdem die Gesellschaft von Herrn Krass durch einen Eklat auseinandergeflogen ist, gelingt es ihm, an seinem Zufluchtsort in der französischen Provinz, die Mosaiksteine des Geschehenen zu einem Bild zu ordnen – während Menschen wie der stumme Kuhhirte Toussaint, der Schuster Desfosses und Madame Lemoine mit ihren Wellensittichen ihm eine Ahnung davon vermitteln, wie alles mit allem rätselhaft zusammenhängt. «Krass», dieser atmosphärische, bildstarke Roman über das, was das Verstreichen von Zeit mit Menschen tut, ist zugleich Liebesroman und Mephisto-Geschichte – manchmal aufgehellt durch leisen Humor, aber vor allem dunkel und in dieser Dunkelheit ergreifend schön. Eine große Erzählung, die den Bogen von Neapel über Frankreich bis nach Kairo schlägt, und eines der fesselndsten, ja überraschendsten Bücher, die Martin Mosebach bisher geschrieben hat.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Mosebach
Krass
Roman
Über dieses Buch
Ralph Krass – so heißt ein verschwenderisch großzügiger Geschäftsmann, der Menschen mit kannibalischem Appetit verbraucht. Ist er unendlich reich oder nur ein Hochstapler, kalt berechnend, oder träumt er hemmungslos? Ein Mann, der niemals Zeit hat und in anderen Menschen nur Marionetten sieht. Als in Neapel Lidewine in seinen Kreis tritt – eben noch die Assistentin eines Zauberers, eine junge Abenteurerin – und sie sich ihm widersetzt, verfällt er darauf, ihr einen ungewöhnlichen Pakt anzubieten. «Krass» ist ein atmosphärischer, bildstarker Roman über das, was das Verstreichen von Zeit mit Menschen tut, über Liebe, Verlust und magisches Wiederfinden.
«Ein sehr starkes Buch über menschliche Schwächen (…) eine der schönsten Liebesgeschichten, die seit Langem auf Deutsch veröffentlicht wurden.» Denis Scheck, SWR FERNSEHEN «LESENSWERT»
«Ein großer Roman über das Über- und das Unterirdische des Menschen.» Richard Kämmerlings, WELT AM SONNTAG
Vita
Martin Mosebach, geboren 1951 in Frankfurt am Main, wo er nach wie vor lebt, war zunächst Jurist. Seit 1983 veröffentlicht er Romane, Erzählungen, Gedichte, Libretti und Essays. Zu seinen Auszeichnungen zählen der Heinrich-von-Kleist-Preis, der Große Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, der Georg-Büchner-Preis und die Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt,
nach dem Entwurf von Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Nikolaus Heidelbach
ISBN 978-3-644-90413-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Erster TeilAllegro imbarazzante
1
Harry Renó verzichtete bei seinen Illusionsabenden auf viel Dekor; in seinem Smoking stand er auf der Bühne, umgeben von einem schwarzen Kasten – seine Hand sehr hell, sein Haar silbrig-farblos, die Requisiten im harten Scheinwerferlicht weiß glänzend. Der Anblick glich einem Schwarz-Weiß-Photo, vor allem wenn er aus leichter Beweglichkeit unversehens in einer leicht manierierten Haltung erstarrte und das Publikum zappeln ließ, bis wieder Leben in ihn fuhr. Eben hatte er sich eine Zigarette angezündet, vom Saal halb abgewandt, um die Flamme vor Zugluft zu schützen. Er tat, als sei er allein und habe eben gerade Lust zu rauchen. Dann richtete er sich auf, saugte genußvoll, legte den Kopf zurück, und nach einem Moment vollständiger Ruhe quoll Rauch aus dem halbgeöffneten Mund, so fest und konzis wie ein schmales Band. Er tat einige Schritte. Der Rauch blieb in der Luft stehen, er verflüchtigte sich nicht. Und nun schrieb er, über die Bühne schlendernd, die Hände in den Jackentaschen, in schöner großer Kurrentschrift «Amore mio, io sono pazzo di te» in die Luft – deutlich standen die Wörter vor der schwarzen Wand. Er hingegen schaute in den Saal. Suchte er in der Menge die Frau, der das Geständnis galt? Ein Augenblick der Verblüffung. Dann rauschte der Beifall auf.
Der Zauberkünstler verbeugte sich knapp, als habe er sich mit seiner Nummer vor allem selbst ein Vergnügen bereitet und fühle sich durch den Applaus geradezu gestört, da öffnete sich die hintere Tür noch einmal, und ein Zug von Menschen wurde durchs Dunkel in die erste Reihe des kleinen Saales geführt. Diese Gesellschaft war von Santa Lucia auf den Vomero heraufgefahren, um hier neapolitanisches Volkstheater zu sehen, «Miseria e nobiltà» von Scarpetta, war aber zum falschen Tag und zur falschen Stunde erschienen, wie sich erst im Foyer herausstellte.
Der junge Mann, der die Gruppe führte, eher klein gewachsen, mit Brille im mageren Gesicht, war mit dem ersten Taxi angelangt, die übrigen waren zu seiner Erleichterung im Verkehr steckengeblieben. Der Schweiß brach ihm aus, er fuhr sich durch den Haarschopf, der danach hahnenkammartig gesträubt war.
«Es geschieht, was nicht geschehen darf …» Das war eine Regel, die aber nicht beruhigte. Zum Glück im Unglück gab es noch teure Karten ganz vorn. Als die anderen eintrafen, hatte er sich auch schon eine Ausrede zurechtgelegt – das Programm sei kurzfristig geändert worden, die Direktion habe deshalb gute Plätze freigehalten, man bitte um Entschuldigung.
Die Leute schoben sich ins Dunkle hinein, da hielt ein schwerer Mann mit großem Kopf und finsterer Miene ihn zurück.
«Wie konnte das passieren?»
Die Frage klang bedrohlich. Dem jungen Mann wurde so heiß, daß seine Brillengläser beschlugen.
«Herr Doktor Jüngel, solche Dinge müssen Sie verhindern; ich habe hier anspruchsvolle Gäste, die haben keine Zeit. Ich hoffe, die Organisation des späteren Abends steht.» Er wandte sich ab und verschwand gleichfalls im Dunkel.
Der junge Mann, der für den Namen Jüngel viel zu alt aussah, unfrisch und wie nicht ganz gesund, tappte ihm mit eingezogenem Kopf hinterher, als gelte es, nach der Abstrafung weniger Platz einzunehmen. Schon als er an der Bar des Hotels Excelsior das Abendprogramm vorgestellt hatte, war ihm plötzlich unwohl geworden: Das von ihm ausgesuchte Volksstück handelte von armen Leuten, die einem reichen Mann aristokratische Verhältnisse vorspielen, um ihn mit lauter Marchesi und Principesse derart zu verwirren, daß er vergißt, die Hände auf seinen Taschen zu halten – so im Groben –, aber konnte Herr Krass, sein furchterregender Chef, das nicht irgendwie auf sich beziehen? Sich womöglich in die Kategorie bedenkenlos auszunehmender reicher Leute eingeordnet finden? Er war ungewöhnlich souverän, doch man wußte nie, wo selbst bei einem solchen Mann die Empfindlichkeiten begannen. Von daher vielleicht sogar ein Segen, daß «Miseria e nobiltà» erst morgen auf dem Programm stand?
Der Zauberkünstler war, nicht nur der Name ließ es vermuten, kein Italiener, hatte aber die flüssige Sprachbegabung, wie sie dem fahrenden Volk nützlich ist. Seine Blässe war beinahe albinohaft, das fein gelöckelte weißblonde Haar, mit Pomade fest an den Kopf geklebt, blitzte metallisch. Von weitem schien er wimpernlos, die Farblosigkeit machte die Härchen unsichtbar, das gab ihm einen eigentümlich kalten und nackten Blick. Ein schöner oder wenigstens hübscher Mann war der Zauberer nicht, aber er strahlte vor Kraft und Intelligenz, man traute ihm Überraschungen zu. Stammte er aus Finnlands ewiger Dunkelheit oder aus Lettland oder Estland? Sein Stil, mit dem Saal Verbindung aufzunehmen, unterschied sich von den üblichen Schmeicheleien seiner Kollegen, nie wäre «Sie sind ein wunderbares Publikum» über seine Lippen gekommen. Er ging eher streng mit den Zuschauern um, verspottete sie gar ein wenig, belauerte sie, war wie ein Drachentöter alter Sagen, der allein vor dem hundertköpfigen Monstrum steht und es mit Finten und Scheinausfällen zu täuschen sucht.
«Sehen Sie, es gibt Leute, die behaupten, es gebe für alles einen Trick, man müsse ihn nur herausfinden. Wir sind hier in Neapel – auch ein Vesuv-Ausbruch oder ein Erdbeben: nur ein Trick! Wer der Natur in die Karten schauen kann, weiß alles.»
Er sprach sehr schnell. Jüngel, ganz gut im Italienischen, verstand ihn kaum, verwickelte sich zudem in dieser generalisierenden und etwas irrationalen Rhetorik – wieso sollte ein Erdbeben ein Trick sein?
«Nein, falsch! Wer wirklich intelligent ist, der weiß: Es gibt Dinge, die sind kein Trick, die sind unerforschbar. Es gibt Phänomene der Unbegreiflichkeit, einer Imprevisibilità.»
Welch ein Wort, gab es das überhaupt? Der Mann aus dem Norden tat so. Aber jetzt brauchte er Mitwirkung.
«Und zwar vor allem Ihretwegen, meine Damen, meine Herren, denn ich will mir später nicht anhören müssen, ich hätte Ihnen etwas vorgemacht. Nein, Sie sollen selber sehen, Sie sollen jeden Schritt verfolgen und mir auf die Finger gucken. Aber machen Sie Ihre Augen auch auf! Ich schätze ein skeptisches Publikum, mit kindlicher Leichtgläubigkeit ist mir nicht gedient. Sie sollen meine Arbeit verfolgen wie Ihren schlimmsten Feind!» Aus seiner Smokingjacke zog er einen Briefumschlag mit einem roten Siegel hervor – den habe er heute nachmittag bei dem bekannten Notar Cocco Palmerio unter Zeugen versiegeln lassen. Und nun bitte er sechs Herrschaften auf die Bühne: Bloß keine Schüchternheit. «Ich brauche vor allem Leute, die dem Laden hier nicht trauen, eher Kontrolleure als Assistenten. Signora, Sie sehen so ungläubig aus, wollen Sie nicht heraufkommen? Und der Signore, ein Wissenschaftler, ein Rationalist, habe ich nicht recht?»
«Kein Rationalist, ein Ragioniere.» Der Mann, ein älterer Kahlkopf, hatte die Lacher auf seiner Seite, aber Harry Renó, mit zusammengekniffenen Augen, schien nichts dagegen zu haben – lacht nur, schien er zu denken. «Und was ist mit Ihnen, Signora?» Er wandte sich zu einer eleganten Frau, die neben Herrn Krass saß, mit weißem streichholzlang geschnittenen Haar und Riesenohrgehängen aus Schildpatt.
Sie erhob sich mit spöttischem Lächeln und ging mit lautem Klackern ihrer hohen Absätze die Bühnentreppe hinauf, seinen Gruß erwiderte sie auf Französisch.
«Ah, Madame est française», dem Zauberer fiel der Wechsel nicht schwer. Ganz kurz hatte er wohl auch Herrn Krass im Auge gehabt, der da so breit vor seiner Nase saß, aber als ihre Blicke sich begegneten, las er in dessen Miene eine solche Drohung, daß er schnell zu einem Mann mit gelblichen Wangen und einer mütterlichen Matrone weiterglitt.
Als letzte der sechs Personen drängte sich aus der Mitte des Saals ein hochgewachsenes Mädchen durch die Reihen, von der ganzen Gestalt her eine junge Frau mit selbstbewußt den Körper ausstellendem Gang, in aufrechter Haltung, den Bauch eingezogen, den Kopf mit den Haarfluten zurückgeworfen. Sie trug ein enges Kostüm mit ziemlich langem Rock, ein Schlitz machte große Schritte möglich. Alles an ihr war betrachtenswert – ihr eigentümlich quadratisches Gesicht, Mund und Augen ausdrucksvoll, die Blicke neugierig hin- und herwandernd, die Lippen halb geöffnet. Jüngel blickte vor allem auf ihre Beine, die fest und wohlgeformt unter dem engen Rock hervorkamen, zugleich etwas starr wie jene Zelluloidbeine, die im Schaufenster mit gestrecktem Fuß die über sie gespannten Strümpfe vorführen. Es hätte ihn nicht überrascht, wenn sie beim Draufklopfen hohl geklungen hätten.
Auch von ihr wollte Harry Renó die Herkunft wissen – «aus Belgien», kam es auf Italienisch, und er wandte sich an die französische Dame wie an eine Verbündete, indem er in gespielter Verzweiflung «Toujours les Belges!» rief. «Wem gebe ich den Umschlag? Zu wem habe ich das meiste Vertrauen?» Nachdenklich ließ er seine sechs Gäste Revue passieren, drehte sich dann auf dem Absatz herum und reichte den Brief der hinter ihm überrascht zurückweichenden Belgierin.
«Aber bevor Sie ihn einstecken, überprüfen Sie bitte das Siegel!»
Sie hielt den Brief mit beiden Händen – sie waren groß wie alles an ihr – und schaute etwas verdutzt darauf.
«Das Siegel ist unzerstört? Klebt gut? Dann weg mit dem Brief, denn jetzt wird gearbeitet.»
Unterdessen hatten zwei Bühnenarbeiter eine Schiefertafel im Hintergrund aufgebaut und sie danach mit einem Paravent verdeckt.
«Jeden von Ihnen werde ich nun bitten, einzeln hinter den Paravent zu treten und ein Wort auf die Tafel zu schreiben: Sie, Signora, beginnen bitte und schreiben den Namen einer Stadt – aber bitte nicht Neapel, machen Sie es uns schwer!»
Ein Anflug von Gelächter im Publikum, der Zauberkünstler wußte: Die lahmsten Späße funktionierten am besten.
«Unsere französische Freundin schreibt bitte den Namen einer historischen Persönlichkeit – wie ich die Franzosen kenne: Napoléon!»
Wieder folgsames Lachen.
«Sie wollen mir ein Kompliment machen», sagte die Dame, die unerschütterlich wirkte, und verschwand hinter dem Paravent. Man hörte das Knirschen der Kreide, sie nahm sich Zeit und kam in würdigem Schritt, vom Ohrschmuck umgaukelt, wieder hervor.
Der Mann mit gelblichen Wangen und etwas stechenden Augen sollte eine Automarke notieren – «Sie verstehen doch was von Autos? Unser Rennfahrer …»; der ältere Kahlkopf, den Bauch vor sich herschiebend, durfte eine Farbe aufschreiben und die mütterliche Matrone eine Blume – «Sie lieben Rosen, stimmt das? Ich weiß alles!»
Schließlich kam die Belgierin, der Brief sah als weißer Streifen aus ihrer Kostümjacke hervor. Es war klar, daß ihr durch den Besitz des Briefes eine Sonderrolle zugefallen war.
«Was haben wir denn schon alles?» Harry Renó machte den Zerstreuten. «Namen, Farben, Städte, Autos, jetzt kommen Zahlen – Sie, Mademoiselle, schreiben bitte eine Zahl.»
Die Belgierin schien amüsiert. Sie sah um sich, als sei sie auf einen dreisten Betrug gefaßt, irgendwann würde alles herauskommen. Mit entschiedenem Schritt, der auf dem Bühnenboden dröhnte, verschwand sie hinter dem Paravent. Ein Moment des Schweigens – dann rief sie: «Aber wie viele Stellen soll meine Zahl denn haben?»
«Wie viele Stellen? Wie Sie wollen – die Telephonnummer von Ihrem Freund, nein, machen wir’s einfach: acht Stellen.»
Es knirschte. Sie kehrte zurück. Sie hatte ihr Teil getan.
O nein, sie hütete ja den Brief. Die Arbeiter traten wieder auf und räumten den Paravent zur Seite, die Tafel erschien, und darauf stand untereinander: Venezia, de Gaulle, Ferrari, blau, Nelke und zum Schluß die Zahl zwo vier eins eins zwo null null acht.
Der Zauberkünstler, auf jede Zeile zeigend, las die Notate laut vor und verabschiedete dann die Gäste – halt, nein, Mademoiselle aus Belgien solle bleiben. «Öffnen Sie nun den versiegelten Brief!» Er zog aus seiner Brusttasche einen kleinen Brieföffner, einen golden glänzenden Dolch, sie nahm ihn wie einen Zauberschlüssel entgegen. Das Papier wurde zerteilt, den Zettel zog sie heraus. «Lesen Sie bitte, was darauf steht!»
Ihre leuchtenden Augen waren kurzsichtig, wie sich jetzt zeigte, sie war auf eine solche Probe nicht vorbereitet. Ganz nah hob sie den Zettel an ihr Gesicht heran: «Venezia, de Gaulle, Ferrari, blau, Nelke und eine Zahl: zwo vier eins eins zwo null null acht.»
Die Welle des Staunens, die durch den Saal ging, bekam sie kaum mit, weil sie sich zu sehr auf das Lesen konzentrieren mußte.
«Wer noch zweifelt, kann den Zettel in der Pause einsehen, und wer sich fragt, wie es zu dieser unerhörten Übereinstimmung kommt, dem sage ich: Alles, was Sie an natürlichen Lösungen konstruieren sollten, ist erheblich komplizierter und unwahrscheinlicher, als einfach anzuerkennen, daß hier etwas Unerklärliches passiert ist. Halt!», rief er, als die Belgierin sich von ihm abwandte; den Zettel hatte sie auf ein Tischchen mit einer Porzellanvase gelegt. «Ich möchte mich noch für die Mitarbeit bedanken, wir sind schließlich stets höflich zu den Damen», und er trat heran, goß aus einer Kanne Wasser in die Vase, und sieh da, ein Blumenstrauß stieg daraus hervor – er ergriff ihn und reichte ihn der Belgierin, die ihn in den Ausschnitt der Kostümjacke steckte.
Der Applaus war beträchtlich. Der blasse Zauberer versuchte, ihn auf die Belgierin zu lenken – «das Instrument der Vorsehung», so etwas rief er tatsächlich.
Es wurde hell, eine Pause, man strebte ins Foyer. Jüngel stürzte zum Buffet, um dort Champagner für die Gäste zu bestellen, als Herr Krass ihn aufhielt.
«Das reicht jetzt hier» – man möge schnellstens Wagen beschaffen, er sei hungrig, die übrigen Gäste auch. Die nächste Reservierung habe doch wenigstens geklappt?
2
Jüngel verstand, daß ihm die Verwechslung des Theaterabends noch eine Weile nachgetragen werden würde. Zu seiner Erleichterung gelang die Überführung der acht Personen wie auf dem fliegenden Teppich. Er hatte die Taxis, mit denen man auf den Vomero heraufgekommen war, draußen warten lassen, und so glich es einem weiteren Zauberkunststück, daß sich die ganze Gesellschaft binnen kurzem auf Meeresspiegelniveau in einem Restaurant unterhalb des Posillipo wiederfand. Hier war eine Tafel gedeckt. Bevor die einzelnen Bestellungen aufgegeben wurden, ließ Jüngel im Flüsterton eine große Platte mit Meeresfrüchten, Langustinos und Austern kommen, die dann, triefend wie eben aus den draußen sanft ans Ufer schlagenden Wellen geschöpft, wiederum zauberschnell auf dem Tisch stand.
Herr Krass nahm die Mitte der Tafel ein, neben sich die französische Dame mit dem streichholzkurzen weißen Haar, Madame Lecœur-Jouët, die Frau des ebenfalls anwesenden Docteur Lecœur-Jouët, eines Chefarztes aus Südfrankreich – da Herr Krass nicht ein Wort Französisch und die Franzosen nicht Englisch sprachen, war hier ständiges Übersetzen gefragt, was Jüngel auch leistete, wenn nicht zugleich anderes von ihm verlangt wurde. Er war der Zerrissene, sah auch so aus, versuchte dann und wann, diese Lage ins Komische zu wenden, brach das aber sofort ab, wenn sein Blick dem von Herrn Krass begegnete.
Gegenüber saß ein stämmiger Mann mit großen behaarten Pratzen, dickschwartiger bräunlicher Haut, eminenten Kinnbacken und verwirrend schmelzenden Augen, die jeden Menschen, ob Mann oder Frau, mit anzüglicher Ironie anblickten. Das war ein Geschäftsfreund von Herrn Krass, ein Herr Levcius; aus einer seiner Bemerkungen ging hervor, daß die beiden «schon viel zusammen gemacht» hätten – der Miene von Herrn Krass war anzumerken, daß er solche Reminiszenzen nicht schätzte. Levcius war in Begleitung einer Frau Roslovski, die, weder jung noch alt, sich in ihrem Leben bisher nicht geschont hatte, auch sie mit ziemlich dicker grauer Haut, dazu fett rotgeschminktem Mund, die Paste hinterließ Spuren auf den Zähnen. Sie gab sich wie eine Schauspielerin, die, nachdem sie auf der Bühne geglänzt hat, sich nach dem Auftritt gehenläßt, kameradschaftlich im Umgang mit wem auch immer, von müder Welt- und Menschenkenntnis, Herr Krass nahm sie kaum wahr.
Dann war da noch ein magerer alter Kahlkopf, schwerhörig und ausschließlich Italienisch sprechend, Dottore Rizzi, den Herr Krass aber wegen eines jüngst verliehenen Ordens ausschließlich Cavaliere titulierte. Jüngel hatte für die Verständigung auch hier einzuspringen, der Cavaliere war auf Anweisung von Herrn Krass mit besonderer Achtung zu behandeln. Er war mit einer viel jüngeren Deutschen verheiratet, mollig, rotgefärbt, mit kleinen grünen Augen, die von den runden Wangen darunter zugedrückt wurden – eine gesprächige Frau, die selbst dann nicht zu reden aufhörte, wenn niemand ihr zuhörte, eine vielleicht im Alltag mit dem Cavaliere erworbene Fähigkeit. Sie konnte sich nicht beherrschen, als die Platte vor ihr stand, und griff ungeniert hinein. Die roten Fingernägel stießen auf den roten Panzer, und die weißen dicken Finger tasteten nach dem weißen Krebsfleisch.
«Zugucken macht mich immer hungrig», rief sie mit stark Düsseldorfer Akzent, dessen Reize ihrem Mann ewig verschlossen bleiben würden. Hätte man einander geheiratet, wenn man den Dialekt des anderen hätte beurteilen können?
Madame Lecœur-Jouët erklärte jetzt, am schönsten habe sie die Nummer gefunden, in welcher der Zauberer Seidenpapierfetzen mit zwei Fächern wie Schmetterlinge in der Luft habe tanzen lassen – «so wenig Aufwand, und so zauberhaft», rief sie aus. Jüngel versuchte, es der Tafel zu Gehör zu bringen; Levcius half dabei.
Ihr sehr würdiger Ehemann mit weißer Haarpracht, der weise Arzt aus dem Märchenbuch, wollte das «Mental-Kunststück», so der Ausdruck des Zauberers, unbedingt getadelt wissen – solche Vorführungen hätten verdummenden Charakter. Das Schmetterlingskunststück lobe seine Frau zu Recht, denn es sei das Ergebnis stupender Fingerfertigkeit, aber das Mentalereignis – schon «mental» sei eine dicke Lüge – festige in den Leuten die Überzeugung, daß derlei möglich sei, und es sei nicht möglich. «Ich bin Naturwissenschaftler, und ich kenne viele Fälle, in denen wir sagen dürfen: Das ist unmöglich, obwohl wir nicht in der Lage sind, es zu beweisen. Nicht alles, womit wir fest rechnen dürfen, muß bewiesen werden …»
Ein ernstes Wort. Die Konversation bekam Niveau. Levcius wiegte das Haupt und blickte den Arzt flirtistisch an. Gebe es denn nicht erstaunliche Phänomene, Unerklärliches, was sich dennoch ereigne? Höre man von Naturvölkern und ihren ungetrübten Instinkten nicht geradezu atemverschlagende Leistungen von Gedankenübertragungen über Hunderte Kilometer hinweg?
«Ich höre nichts davon.»
Der Arzt ließ sich darauf nicht ein, Frau Roslovski fiel ihm mit rauher Diseusen-Stimme ins Wort: «Irgendein Schmu ist dabei, irgendein verborgenes Signal, irgendein doppelter Boden. Die denken sich die dollsten Sachen aus. Man muß es als Spaß sehen, als Unterhaltung.»
Gar nicht besonders leise und im sicheren Vertrauen, der Cavaliere könne sie nicht verstehen, tuschelte ihr Signora Rizzi zu: «Ich bin neulich bei einer Wahrsagerin gewesen – die sagt, ich treffe einen Mann, etwa vierundfünfzig, geschieden, mit einer Villa in Capri und mit ernsten Absichten. Sie sagt, ich hätte ihn schon mal gesehen – ich zermartere mir den Kopf und komme nicht drauf, aber er muß ganz in der Nähe sein …»
«Aufgepaßt», antwortete Frau Roslovski, «den Alten festhalten und weitersuchen, aber bloß die sichere Sache nicht gefährden …» Eine Frau Rizzi hätte gewiß nicht zu ihrer Freundin getaugt, aber mit aufrichtigem Rat wollte sie ihr dennoch gern zur Seite stehen. Nach vielen Enttäuschungen findet der Mensch zur Vernunft, es ist eine harte Schule; Signora Rizzi hatte sie noch nicht durchlaufen und verharrte genießerisch im Reich der Illusion.
Herr Krass hatte den Worten seiner Gäste schweigend gelauscht, er aß und trank schnell, als wäre das Mahl bald zu Ende. Dabei wanderte sein Blick umher. War er mit etwas unzufrieden? Bereitete sich da ein Ausbruch vor? Derweil verhielten sich seine Gäste wie Schulkinder, bevor der Unterricht begonnen hat. Man sprach, ohne ihn zu beachten, solange er das gestattete. Jüngel hatte dem Kellner bedeutet, kein Glas dürfe je leer stehen, besonders das Glas des Gastgebers nicht; am besten, man postiere in der Nähe einen Kellner eigens für ihn.
Das Restaurant war groß, aber heute leer, denn eigentlich geschlossen. Da Herr Krass unbedingt dort zu speisen wünschte, hatte Jüngel verhandelt. «Finden Sie das Argument, das uns die Tore öffnet», hatte Herr Krass befohlen und ihn vieldeutig angesehen, «Sie wissen schon, mir kommt es auf das Ergebnis an, nicht auf den Weg dorthin.» Zu Beginn von Jüngels Tätigkeit in Neapel hatte er ihm im Hotelzimmer einen Aktenkoffer übergeben, der mit Bargeld gefüllt war, D-Mark und Lira, vor allem aber Dollars. «Ich wünsche, daß Sie die Verbindlichkeiten, die Sie in meinem Dienst eingehen, bar abwickeln. Sie notieren sich die größeren Beträge und tragen mir die Summen jeden Morgen vor dem Frühstück vor. Rechnungen brauche ich keine, ich weiß, was die Dinge kosten. Denken Sie bei allem daran, daß meine Zeit kostbar ist, das Kostbarste, mit dem Sie in Berührung kommen. Alles andere ist nachgeordnet.»
Jetzt wischte Herr Krass sich den Mund ab und warf die Serviette neben den Teller. «Ich möchte hier mal gewisse Dinge richtigstellen.» Was sie gesehen hätten, sei ungewöhnlich gewesen, aber nicht ausgeschlossen. Dieser Zauberer sei ein international bekannter Mann – das behauptete er ohne Bedenken, als ob der Weltruhm einer Persönlichkeit sich allein daraus ergebe, daß er mit ihr in Berührung gekommen war –, ein Meister seines Fachs, zweifellos ein Taschenspieler et cetera, et cetera, er neigte sich zu Madame Lecœur-Jouët, der Jüngel wie ein Konferenzdolmetscher ins Ohr hinein seine Übersetzung zischelte. Darüber hinaus sei er wahrscheinlich ein Genie, ein unerkanntes, wie es gar nicht so wenige gebe. Er selbst habe solche Leute kennengelernt. Was nenne man denn eigentlich Genie, was sei das? Das sei ein Mensch – er schloß die Augen und sprach leise und präzis, als lese er in der Nacht seines Inneren einen Text in leuchtenden Buchstaben.
Alles schwieg und lauschte ehrfürchtig. Sein langes Schweigen zuvor hatte einen Raum des Respekts um ihn gelegt; jetzt ging kein Wort mehr im Durcheinanderreden unter.
«Die Kraft eines Genies besteht darin, die Realität seinem Willen zu unterwerfen und nach seinem Willen zu formen.» Das sei bereits an den Ereignissen der Weltgeschichte ablesbar – sie seien nichts anderes als Verlängerungslinien einer Persönlichkeit. Ein Krieg, ein Frieden, eine Eroberung seien vor allem in die Außenwelt projizierte, zu Tatsachen geronnene Charaktereigenschaften, leicht erkennbar bei Alexander, Cäsar, Attila, Napoleon, Hitler, Stalin. «Was diese Männer taten, das waren sie. Männer wie diese schreiten durch die Welt als Rätsel und Fatum und Ausstrahlung einer anonymen Kraft – manchmal haben sie vor sich selber Angst.»
Ging es immer noch um den Zauberer? Gerade um den. Der sei ein Mann, der mit seiner Geisteskraft andere Geister lenke, in sie eindringe, ihnen ihre Gedanken aufzwinge – im Theater habe er seine Versuchspersonen nur dazu gebracht, «blau» oder «Venezia» zu denken, aber was, wenn er seine Macht einmal richtig entfaltete?
«Das Phänomen der Besessenheit, des Inkubus», das war ein Einwurf des nach einigen Gläsern Wein mutig gewordenen Jüngel, der durch Nichtbeachtung aber wie ein Selbstgespräch verhallte.
Nein, es war dem einen oder anderen klar, wovon, besser, von wem, Herr Krass hier gesprochen hatte. War der Mensch nicht mit Händen zu greifen nah, der die Realität seinem Willen unterwarf und sie nach seinem Willen formte und den man am besten auch gewähren ließ, weil es für alle, die vom Strahl dieser Sonne getroffen wurden, so am vorteilhaftesten war?
«Sehen Sie», er schwang sich, nachdem er die Wirkung seiner Worte zur Kenntnis genommen hatte, zu einer gewissen Verbindlichkeit auf, «man müßte den Ablauf dieses Mentalwerkes nur ein bißchen unter die Lupe nehmen, um zu erkennen, wie dieser Mann vorgeht. Haben Sie bemerkt, wie er der Dame, die einen Städtenamen schreiben sollte, sagte, sie solle aber nicht Neapel schreiben? Dem folgte Gelächter, ein wenig auf Kosten dieser Dame, die vermutlich danach leicht verwirrt war. Sie stand jetzt in seinem Bann, ganz lässig hat er sie sich unterworfen. Auch mit dem Mann, der eine Automarke schreiben sollte, gab es einen irritierenden Dialog, und wenn ich mich recht erinnere, dann versuchte er auch erfolgreich, den Herrn durcheinanderzubringen, der die Farbe –» Nein? Den nicht? Das müsse man genau analysieren, anhand von Aufnahmen, dann komme nämlich heraus, daß er auch da durchaus geschickt und beinahe unbemerkt Einfluß ausgeübt habe – von ihm selbst natürlich bemerkt, denn er wisse, wie man so etwas mache. «Mit der letzten Person aber hat er zu kämpfen gehabt, die spürte seine Kraft und wollte sich ihm entziehen – sie hat sogar versucht, ihn unsicher zu machen, und hat nach den Stellen der Zahl gefragt. Das war gefährlich, aber er hat sie wieder in den Griff bekommen.»
Mit Sicherheit meinte mancher, ihn nicht gänzlich verstanden zu haben – war da nicht etwas offen geblieben? Aber man verzichtete auf die Nachfrage, weil ihm selbst alles so klar erschien, daß man sich schämte, die Langsamkeit des eigenen Geistes zu bekennen.
Zwei besonders große Loups de mer wurden jetzt gebracht. Welches Alter mochten die Fische erreicht haben, nur um schließlich auf dieser Tafel zu landen?
Frau Rizzi rief: «Ich hab auch schon wieder Hunger!» Madame Lecœur-Jouët wandte sich an Jüngel und raunte ihm zu: «Das haben Sie gut ausgesucht – was anderes kriegen die hier nämlich nicht hin», was ihn erröten ließ, während er sich zugleich besorgt umsah.
Die Fischhälften sanken unter den Gabeln der tranchierenden Kellner auseinander und offenbarten die Rosmarinzweige, mit denen die Leiber gefüllt waren. Hätte sich ein Ring darin gefunden, keiner am Tisch wäre nach dem Vortrag von Herrn Krass erstaunt gewesen.
3
Ins Hotel zurückgekehrt, begaben die Herren Krass und Levcius sich noch in die Bar, Jüngel wurde mit knappem Kopfnicken entlassen. Eine Stunde später sah man ihn aber wieder in der Halle. Er bat an der Rezeption darum, ein Fax zu versenden, wollte aber unbedingt darauf warten, daß es durchgegangen war, und das Blatt gleich wieder an sich nehmen. Auf dieses Blatt hatte er mit kleiner, etwas gezierter Schrift folgendes geschrieben:
Neapel, den 24.11.1988
Liebste,
hier kommt der Report meines Tages. Um es vorwegzunehmen: Alles geht gut, wenn auch mit blauem Auge. Es ist unheimlich spannend für mich, ich habe nie mit einem Menschen wie Herrn Krass zu tun gehabt. Und es wäre zu blöd, wenn das jetzt nicht funktionieren würde, auch für uns beide, eine solche Chance gibt es einmal und nie wieder, zumal für mich, der ich normalerweise in solche Kreise nie hineingeraten wäre. Allein wie die Verbindung zustande gekommen ist, das gleicht ja einer Berufung wie im Evangelium – mich ohne Prüfung, ohne Zeugnisse, ohne Empfehlung zu verpflichten. Und ich habe hier ganz nette Summen zu verwalten, alles in bar, er faßt kein Geld an, gibt keine Unterschrift. Er sagt: Ich ziehe es vor, unsichtbar durch die Welt zu gehen, was ein Witz ist – wo er sich aufhält, gucken alle hin.
Auf jeden Fall hat mir der Doktortitel bei ihm geholfen, so etwas macht ihm Eindruck, er redet mich auch immerfort damit an. «Sie haben promoviert?» Das war die einzige Frage zu meiner Vergangenheit. Sonst: «Sie sind frei, Sie können reisen?» Daß ich da einfach ja gesagt habe, schmerzt mich – natürlich bin ich nicht frei und will auch nicht frei sein, wir sind ja zusammen und bleiben es hoffentlich für immer. Und wenn mit Herrn Krass alles gut läuft, dann rückt das Ziel auch näher: Das Wort mit H schreibe ich nicht aus, weil es Dich nervös macht, aber Du weißt, worum es geht.
Daß ich mit Italienisch und Französisch keine Schwierigkeiten habe, ist entscheidend, obwohl es bedeutet, daß ich unablässig übersetzen muß. Die besten Leute unserer Gesellschaft sind ganz zufällig dazugestoßen: Herr Krass war auf der Straße mit dem Fuß eingeknickt, der Knöchel schwoll an, ich fragte im Hotel nach einem Arzt, und der stand unterdessen neben mir, ein Chefarzt aus Südfrankreich, Orthopäde sogar, mit eleganter, aber sehr natürlicher, ein bißchen derber Frau. «Bitte, darf ich mir den Fuß ansehen?» Im Salon seiner Suite lag Herr Krass auf einer Ottomane – ich gebe zu, daß mir der Anblick seiner großen nackten Füße peinlich war, als dürfte ich in meiner Stellung so etwas gar nicht sehen. Doktor Lecœur-Jouët hat dann höchst sicher und zielbewußt getastet. Herr Krass runzelte die Brauen, hat aber keinen Schmerzenslaut von sich gegeben. «Aus meiner Sicht ist nichts gebrochen – ich kann natürlich nicht in den Knochen hineinsehen, aber ich vermute, das Risiko ist gering.» Herr Krass daraufhin feierlich von seinem Lager: «Ich vertraue Ihrer Expertise, Herr Doktor, sie ist mir mehr wert als die Auskünfte einer Maschine. Würden Sie mir die Ehre geben, mit mir zu Mittag zu essen?» Und seitdem gehören die beiden dazu. Der Arzt ist sehr beeindruckt von ihm, er von dem Arzt – wohlhabende Leute sind das auf jeden Fall, ich könnte mir sogar denken, daß die Frau vor ihrer Heirat noch ein bißchen wohlhabender war. Sie hat dies Gradheraussein von altem Geld.
Dann gibt es einen Mann, der mir nicht so gut gefällt, der aber für Herrn Krass wichtig zu sein scheint: Herr Levcius, klein und feist und mit jedem Satz anzüglich, was Herrn Krass sichtlich stört, aber er sagt nichts. Wenn ich bei dem klopfe, öffnet er immer im offenen Bademantel, obwohl er nicht weiß, wer draußen steht, behaart wie ein Affe, im Hintergrund seine Frau oder Freundin, eine ebenfalls ziemlich gewöhnliche, aber nicht unfreundliche Frau.
Geht mich ja alles nichts an. Ich habe als Assistent und Sekretär nur die Abwicklung der Reise zu besorgen, auch ein Unterhaltungsprogramm, Führungen und ähnliches, doch vor allem soll ich Herrn Krass Häuser zeigen. Er möchte sich offenbar am Golf ansiedeln und sucht etwas Großes, am besten Historisches – «eine herrschaftliche Residenz», hat er mir eingeprägt. Dies ist jetzt meine Probezeit, so heißt es ausdrücklich. Aber jetzt schon zu meinem Gehalt sehr reichliche Spesen! Ich mußte mir am Flughafen Anzüge und Hemden kaufen, ich hatte die grüne Jacke an – «so können Sie als mein Repräsentant nicht rumlaufen!»
Bei aller Sonderbarkeit doch ein einzigartiger Mann. Meistens schweigend, das kann auch etwas Unheimliches haben, und dann hat er uns heute Abend seine Genietheorie entwickelt – unerhört! Ungebildet, aber ein Naturintellektueller! Genie ist ein großes Wort, man denkt da an Goethe oder Michelangelo, aber was heißt es denn eigentlich? Daß in einem Menschen etwas ist, was er nicht versteht, was größer ist als er selbst, was er nicht beherrscht, sondern was ihn beherrscht, und so was kann ich mir bei ihm vorstellen. Was man an Herrn Krass zunächst kennenlernt, ist das Einschüchternde, das Pompöse – was dahintersteckt und sich erst allmählich offenbart, das treibt ihn zu seinen jähen Entscheidungen. Und ich selbst bin ja auch Gegenstand einer solchen Entscheidung geworden, dann muß mir das wohl recht sein.
Ich schreibe Dir dies alles, weil wir zuletzt zusammen nicht so glücklich waren, wie ich mir das wünsche, und weil Du auch mit meiner Unfähigkeit, irgendwo unterzukommen, so unzufrieden warst – allzu verständlich. Jetzt sieht auf einmal alles anders aus, ist das nicht großartig? Und ich habe zwar selbst nicht viel dazu getan, bewähren muß ich mich allerdings, und das wird nicht leicht und zerrt an den Nerven. Doch das Glückhaben ist auch eine Eigenschaft, und vielleicht entpuppt sich schließlich noch, daß ich Glück haben kann. Auf jeden Fall mit Dir, Du großer Glücksfall meines Lebens!
PS: Wenn Du per Fax antwortest, schreib bitte nur, was jeder lesen kann. So ein Fax kommt auch mal in ein falsches Fach!
In seinem Badezimmer hat Jüngel die Originalblätter, seiner Vorsicht gehorchend, im Waschbecken verbrannt.
4
Ein alter Klosterhof mit riesenhohen Pilastern aus grauem Tuffstein war so oft umgebaut worden, daß sich die Anlage nur noch einem detektivischen Blick nach einer Weile erschloß. In der Mitte dieses weitläufigen Gevierts erhob sich ein Gebäude als Kubus, auf dessen flachem Dach sich ein dichter Orangenhain befand; im dunklen Laub glühte es golden.
«So verrückt, ein Garten im ersten Stock. Ein hängender Garten wie für Semiramis, und so viele Bäume – ich möchte da rein, das ist ein richtiges Zauberwäldchen, frag die Wirtin; wir wollen da reingehen.» Das sagte ein großes Mädchen mit dichter Mähne, die zu beiden Seiten wie eine Infantinnenperücke abstand und das Quadratische des Gesichtes betonte. Ihre Augen rollten, als sei sie mit dem Aushecken eines Vergnügens beschäftigt. Sie saß nackt auf einem Bidet und plätscherte mit den Händen, zwei paddelnden Entenfüßen; das Pelzchen war triefnass und erschien sehr dunkel gegen die helle Haut. Ihre Worte waren an den Mann gerichtet, der im angrenzenden Zimmer auf dem Bett lag und rauchte, Harry Renó, der sich nach seinem Auftritt am Vorabend ausschlief, in einem eigentlich lärmenden Stadtviertel, aber in diesen Hof drang kaum ein Laut.
«Sag nicht Zauberwald, das ist nicht professionell. Du weißt doch, Zauberei gibt’s nicht.»
«Ich bin ja auch nicht professionell – du im übrigen auch nicht, denn unseren Trick kannst du in jeder Stadt nur einmal vorführen, dann heißt es abreisen, das ist doch nicht sehr ökonomisch. Was machst du, wenn du mal für einen zweiten Abend verpflichtet wirst?»
«Ich laß mir was einfallen.» Auf der Bühne hatte er silbrig-eisig ausgesehen, ein Kunstmensch, jetzt, im Bett, den Kopf auf dem weißen Kissen, war sein Teint grau, die Augen farblos, das Gesicht wie ein zerknautschter Gummiball, so wie der Schlaf die meisten Menschen verwandelt; erst nach einem Aufenthalt im Badezimmer finden sie zu ihrer Tagesverfassung zurück.
Das Mädchen, auf dem Bidet wie ein Kind auf dem Schaukelpferd, war hingegen frisch und wach, bestens gelaunt, in Eroberungsstimmung. Sie verweilte in Gedanken noch bei dem Garten, den sie vor Augen hatte. Da standen auch alte Eisenstühle im Schatten des Orangendunkels; trank dort vielleicht jemand nachmittags Tee, öffnete sich hinter den Bäumen der Zugang zu einer geheimen Welt?
«Laß bloß die Wirtin in Ruhe», sagte Harry Renó, «deine Sonderwünsche haben sie immer wütender gemacht: noch ein Kissen, noch eine Decke, noch ein Tee, eine Nagelschere, ein Bügeleisen …»
«Mir scheint, du reist nicht oft mit Frauen. Frauen brauchen Extras. Ich brauche aber noch etwas ganz anderes als ein zweites Kissen – du weißt schon, was.»
«Du willst Geld, aber du kriegst kein Geld, jedenfalls jetzt nicht. Die Abendkasse ist an meinen Agenten gegangen, abzüglich Hotel und Reisekosten immerhin für zwei – was willst du? Du siehst Neapel, da warst du noch nie, ist doch auch ein Honorar, und am Nachmittag geht’s weiter nach Bari, dann nach Taranto, dann Reggio, dann Messina, dann Palermo. Ist das etwa keine schöne Reise?»
Sie lachte. «So, wie du rechnest, kann ich das auch. Wenn du mich nicht beteiligst, dann bin ich weg.» Das war keinesfalls drohend gesagt, eher spielerisch, in ihren Gedanken war sie bei dem Garten dort drüben. Wie kam eine solche Konstruktion zustande? Das Haus lag an einem Berghang – hatte man vielleicht den Boden im Hofgeviert abgetragen und nur den Garten ausgelassen, der dabei auf einmal in die Höhe gewachsen war?
«Du kannst gar nicht weg.» Harry Renó gähnte. «Ich habe deinen Paß, und du hast kein Geld, was willst du machen? Und außerdem liebst du mich, stimmt’s?»
Daß sie in seiner Hand war, darauf vertraute der Mann, und er ahnte wohl auch, daß ein tägliches Gezerre um das Geld sie nicht dauerhaft verstimmte, da war sie so nüchtern wie er. Was er nicht ahnte, war, wie wenig sie es mochte, wenn er von ihrer Verliebtheit sprach; das war etwas, was ihr Geheimnis bleiben mußte, das ging ihn gar nichts an, und wenn er es doch entdeckt zu haben meinte, dann hatte er das klugerweise vor ihr zu verbergen. Jedenfalls sich niemals darauf berufen! Ein intelligenter, witziger Mann, ein unbeherrschbarer Mann, keiner Beeinflussung zugänglich, im täglichen Kampf nie die Nerven verlierend – und zugleich doch so taktlos und dumm. Zu dumm, um eine Antwort zu verdienen. Wie lächerlich er aussah mit dem feinmaschigen schwarzen Haarnetz, das die Lockenreihen seiner weißblonden Frisur über die Nacht hinweg konservierte; er band es sich stets schon vor ihrer nächtlichen Umarmung um. Wenn er sich, nach getanem Werk, von ihr abwandte und ihr den umhüllten Hinterkopf zeigte, meinte sie, in ein riesenhaftes Fliegenauge neben sich auf dem Kissen zu blicken.
Ihre Laune war nur kurz getrübt. Zur Fortsetzung der Unterhaltung fehlte ihr dennoch die Lust. Genüßlich, als schaute ein ganzes Theater ihr zu, rollte sie die Strümpfe über die Beine, den Fuß nach vorn stellend, dabei durchaus im Bewußtsein, daß Renó jedenfalls sie beobachtete, aber ohne daß dies ihre soeben erworbene Gleichgültigkeit erschüttert hätte. «Ich gehe ein bißchen spazieren. Wir treffen uns wieder, wenn du fertig bist, hier oder in der Bar gegenüber.» Einen kleinen Schmerz verspürte sie bei dem Gedanken, sich von dem Anblick des verborgenen Gartens losreißen zu müssen, aber das wäre später ohnehin fällig gewesen.
Im Vorraum kam sie an dem Tischchen vorbei, wo die Wirtin dieser Etagenpension sich die Karten legte. Nachdem Harry Renó sie noch einmal daran erinnert hatte, wie sehr diese Frau sie verabscheute, überlegte sie kurz, ob sie nicht doch einen Auftrag für sie habe; die Wirtin sah sie krötenhaft-halslos von unten an, aber es machte auch Spaß, den Ärger, der in der Frau schon aufstieg, ins Leere laufen zu lassen.
«Ich hatte noch eine Bitte an Sie, aber ich habe sie vergessen.»
Die Frau nahm den Schlag unbewegt. «Wann reisen Sie ab?»
«Das müssen Sie Herrn Renó fragen.» Mit demselben entschiedenen Schritt wie auf der Bühne ging sie an dem Tischchen vorbei und betrat das hallende Treppenhaus.
Draußen ein neapolitanischer Herbsttag in der mildesten, üppigsten Form, frühlingshaft warm, aber ohne die Aufbruchsstimmung des Frühlings. Im Herbst erreichte die Stadt ihren Idealzustand, nichts mußte sich mehr ändern und entwickeln, alles hätte jetzt auf immer so bleiben dürfen. Weiche Luft, weiches Licht, das die sonnenverbrannten braunen Fassaden in ihrer Fleckigkeit warm erstrahlen ließ. Während sie sich langsam von der Pension entfernte, fühlte sie eine kleine Unruhe in sich, als begehe sie einen Fehler – es war der «Hängende Garten», der sie zurückzurufen schien, als ob sie ihn noch nicht genügend betrachtet und in sich aufgenommen habe: als sei da etwas unerledigt geblieben. Plötzlich wurde ihr klar, warum ihre Gedanken sich von dieser höchst ungewöhnlichen Anlage nicht lösen konnten: Sie hatte sie bereits betreten, heute nacht im Traum, ja tatsächlich, sie war darin gewesen.
Das Gebäude, das von dem Orangenhain bekrönt wurde, ein in zeitloser Baufälligkeit ruhender Block, hatte große Tore, die von schief in den Angeln hängenden Flügeltüren geschlossen wurden, Remisen, Garagen, Werkstätten mochten sich dahinter verbergen. Für sie stand im Traum nur fest, daß sie nicht durch eines dieser Tore oder über eine Treppe in den Garten gelangt war – nicht umständlich von der Pension in den Hof hinunter und dann wieder hinauf, sondern pfeilgerade, der Bahn ihres Blickes und der Bewegung ihrer Wünsche folgend, die vom Schlafzimmerfenster hinüber auf das Orangenwäldchen gerichtet waren. Im Nu hatte sie vor den rostigen Stühlen gestanden, die vor dem Hain zum Verweilen einluden. Aber von dort aus ging es weiter, erst jetzt tat sich das Wunder des Gartens auf. Zwischen den dicht nebeneinander gepflanzten Orangenbäumen gab es Leben. Dieses Dunkel besaß Anziehungskraft, es zog sie hinein. Und nach wenigen Schritten schon war der weite Klosterhof vergessen.
Ein ganz eigenes Licht herrschte zwischen den Stämmen und unter den schweren, goldenen Früchten im schwarzen Laub. Das Dunkel erhellte sich warm von innen, Sonnenuntergangsstimmung erfüllte den Hain, das Verblassen des weißen Lichts am Firmament, dem ein sattes Aufblühen aller Farben antwortete. Stimmenmurmeln empfing sie, während sie voranschritt, von den Bäumen nicht behindert – es war geradezu, als wichen sie zur Seite. Ja, da waren Menschen versammelt, schöne, altmodisch elegante Männer und Frauen, mit Teetassen und Orangeade-Gläsern in Händen, die sich lebhaft, aber gezügelt unterhielten. In ihrer Nähe stand ein kleiner korpulenter Mann in lose fallendem blauen Anzug und sprach eindringlich auf eine Dame in gepunktetem Seidenkleid ein, die in der linken behandschuhten Hand den rechten Handschuh hielt, während sie mit der rechten eine Zigarette mit Goldmundstück zu den rotgeschminkten Lippen führte. Beide zeigten keine Verwunderung, als sie hinzutrat; mit dem Eintreffen von Fremden wurde offenbar gerechnet. Sie überragte das eher kleinwüchsige Publikum dieses Goûter und spürte ihren großen schlanken Körper in seiner gespannten Straffheit sehr deutlich. Das gab ihr Zutrauen und schenkte ihr das Gefühl, am rechten Platz zu sein, denn obwohl niemand sie begrüßte oder auch nur ansprach, bemerkte sie, daß man sie aus den Augenwinkeln beobachtete, mit nicht unfreundlicher Neugier, aber zurückhaltend. Die Dame im gepunkteten Kleid sagte leise: «Wenn man diese Person kennen muß, dann wird man das im Verlauf der nächsten Stunden noch erfahren.»
Ein großer blauer Schmetterling taumelte ihr entgegen, wie er in Europa selten zu finden sein dürfte, um so mehr glich er einem der Seidenpapierschmetterlinge, die Harry Renó so virtuos mit seinen Fächern vor sich flattern lassen konnte. Mehrere Augenpaare folgten seinem Flug, ein Lichtstrahl brach sich Bahn durch das ledrige Laub und ließ ihn aufglänzen; es war, als sei er genau von ihr angezogen, und zugleich begriff sie, daß sie bis auf ihre hochhackigen Schuhe, die ihre gestreckte Haltung begünstigten, vollkommen nackt war. Das war keine verstörende Entdeckung, nur mit der Aufforderung an sich selbst verbunden, in ihrer zur Schau getragenen Selbstverständlichkeit nicht nachzulassen, sondern lächelnd so dazustehen wie die Dame mit den Handschuhen. Es kommt nur auf die Haltung an, man kann auch nackt einen angezogenen Eindruck machen – so etwas ging ihr durch den Kopf, als wiederhole sie eine ihr längst bekannte Maxime ihrer Mutter.
Und tatsächlich schien niemand in dieser geheimen Versammlung etwas Auffälliges an ihrer Nacktheit zu finden, der Schmetterling zog alle Aufmerksamkeit auf sich. Sieh da, er wollte zu ihr. Er umgaukelte sie, und dann setzte er sich auf ihren Bauch – sie meinte, die spitzen Beinchen auf der Haut zu fühlen – und öffnete und schloß langsam die herrlichen Flügel. Und nun wurde auch der gedrungene Herr auf ihn aufmerksam, trat einen Schritt auf sie zu und neigte den Kopf, um mit den hinter einer dicken Schildpattbrille lupenartig verkleinerten Augen das Naturschauspiel zu studieren – auch diesen Blick meinte sie wie ein Kitzeln zu empfinden. Ich spiele meine Rolle gut, an diesen Gedanken wollte sie sich jetzt genau erinnern.
Sie ging langsam, sie folgte dem Gefälle der Straße, an Denkmälern und schwarzen Kirchenportalen vorbei, aus denen Kerzenflämmchen leuchteten, durch Häuserschluchten, an deren Ende eine ungeheure, im Dunst verschwimmende Masse den Horizont abschloß – der Vesuv.
Richtig, das ist der Vesuv, dachte sie, so groß … Die Straße hatte sich verengt, sie sah in übermöblierte winzige Wohnungen zu ebener Erde.
Eine Frau kam auf sie zu, zeigte auf ihre Handtasche und sagte: «Passen Sie auf!»
«Worauf?» Sie lachte. «Es ist nichts drin.»
Sie wurde sich ihrer Freiheit bewußt, Frucht ihrer Sorglosigkeit. Der Tag wurde immer schöner. Vermutlich rochen die Taschendiebe, ob sich ein Zugriff lohnte oder nicht – wie schade, sie hätte gern einen kennengelernt. Vor ihr ein kleiner Laden mit Kleidern aus zweiter Hand, ein paar waren draußen aufgehängt und wehten im lauen Wind, tanzende Feen. Früher nannte man so etwas «Fähnchen», schwarz mit weißen Punkten, aus leichtestem Stoff und von einfachstem Schnitt, vorn heruntergeknöpft, für Dienstmädchen. Sie hob einen Zipfel in die Höhe, die Verkäuferin trat hinzu; fünfundzwanzigtausend Lire. Sie beschloß, es anzuprobieren. Kaum war ihr Körper in dem Kleid, wurde es zu etwas völlig anderem. Es war wie für sie gemacht, so restlos gelungen, daß es teuer aussah. Das ging ihr oft so, sie wußte, was ihr stand. Es fehlte nur ein großer Schmuck, dann wäre der Aufzug perfekt gewesen. Sie fand in ihrer Tasche zwanzigtausend Lire, die Verkäuferin ließ mit sich reden. Damit war aber auch das Geld weg, um einen Kaffee oder einen Wein zu trinken. Dieser Gedanke streifte sie nur kurz. Sie dachte nie über den Augenblick hinaus. Wenn Bedürfnisse sich meldeten, dann nahte auch die Gelegenheit zu ihrer Befriedigung, das war bisher so gewesen, und das würde in Zukunft nicht anders sein.
Furchtlosigkeit – von zu Hause hatte sie die sicher nicht mitgebracht. Ihr Vater war Künstler gewesen, jung gestorben, knapp über fünfzig und kurz vor dem Durchbruch zum Ruhm. Martial Schoonemaker war in der Kunstwelt inzwischen ein Name, einer aus der Herde der Duchamp-Epigonen, aber mit eigenem Stil, dekorativ, witzig mit altmodischen Werbegraphiken und Typographie-Fundstücken spielend. Sie erinnerte sich, wie er, sie war zehn oder zwölf, einem Wirt auf dem Land eine Tafel mit dem Wort «Ausgang» abgehandelt hatte, in großen, unbestimmt drohenden Buchstaben; heute hing sie in einem Museum, ein schönes Stück, es ließ sich viel dazu sagen: Ausgang aus dem Jahrhundert, der Kultur, der Kunst, dem Leben, der Tod war auch ein Ausgang … Aber welch eine Existenz. Immer im schwarzen Anzug mit Weste, in der strengen Surrealistentradition, ein wenig geduckt, ängstlich um sich schauend und vor allem stumm. «Man darf nichts riskieren», das hatte ihm ihre Mutter eingeschärft, die sich im Kunstmilieu viel besser auskannte – kein falsches Wort sagen, keine Position beziehen in einem ästhetischen Streit, das sei lebensgefährlich! Ein Haifischbecken, in dem man sich zerfleischte, glaubte man der Mutter. Wer aufsteigen wollte, hatte den Mund zu halten und den Interessen der wichtigen Händler nicht in die Quere zu kommen. «Wichtig», ein häufig gehörtes Wort in ihrer Kindheit – wichtige Leute seien gestern dagewesen, und morgen werde man wieder mit wichtigen Leuten zusammentreffen. Sich in die Gesellschaft von Wichtigen hineinzumogeln, sich an Wichtige heranzudrängeln und an sie zu hängen – die Mutter übernahm die Organisation solcher Vorhaben, mit dem stummen, gequälten Mann an ihrer Seite, aber besser stumm sein als brillant und die falschen Sachen sagend. Das Mädchen wußte, daß Martial Schoonemaker durch seinen Tod der Mutter die Arbeit erleichtert hatte. Sie war es, der es gelungen war, «Ausgang» im Museum von Antwerpen zu placieren, und schon entstanden neue und größere Vorhaben, bei denen die Tochter nicht stören durfte, denn so sicher war der Durchbruch immer noch nicht, auch wenn es inzwischen eine New Yorker Galerie, und zwar eine «wichtige», gab. Der unablässig schwarze Zigaretten rauchende Vater hatte sie geliebt. Sie roch seitdem gern den Raucheratem von Männern und wußte noch genau, an welchem Tag sie ihn nicht mehr als Gestank empfunden hatte: als der Vater nach längerer Abwesenheit zurückgekehrt war und sie auf seinem Schoß saß.
Der Mutter ging sie lieber aus dem Weg. Diese Frau durchschaute jede kleine Lüge und antwortete mit einer Ohrfeige darauf, noch bevor man zu Ende gesprochen hatte. Zuschlagen würde sie auch heute noch, wenn sie denn könnte, aber die Tochter ließ sich nicht mehr sehen und hatte auch einen Weg gefunden, sich zu rächen: Den Namen Schoonemaker konnte ihr niemand streitig machen. Damit hatte sie zum Zorn der Mutter eine Galerie gegründet, die nach kurzem wieder hatte schließen müssen; die Bank war von der Mutter zufriedengestellt worden, die nicht wollte, daß der Name in schlechtes Licht geriet. Seitdem blieb sie Brüssel fern und streunte herum – das ging sehr gut, jeder Tag brachte ein neues Erlebnis, und wenn es nur ein Kleid war. Sie würde auf den Kassenzettel eine weitere Null schreiben, bevor sie ihn Harry Renó übergab, das wäre dann immer noch spottbillig.
Ihre Verstimmung über seinen Geiz war verflogen. Sie nahm die Menschen nicht besonders ernst und war so konsequent in dieser Haltung, daß sie sich nie dazu aufraffen konnte, etwas richtig übelzunehmen, auch wenn es mit einem spürbaren Schaden für sie verbunden gewesen war. Nur ihre Mutter machte da eine Ausnahme. Die nahm sie ernst, aber so wie man einen Tiger ernst nimmt, dem man ja auch nicht übelnimmt, wenn er einen verschlingen will – man muß halt aufpassen in seiner Gesellschaft. Sie hatte die gleiche Gabe wie die Mutter, Sprachen weniger zu lernen, als sich von ihnen anfliegen zu lassen und in einem sehr melodischen Singsang mit flämischer Grundierung vom Französischen ins Italienische und von dort ins Deutsche zu wechseln, mit vielen, aber originellen Fehlern, die ihren Sätzen Farbigkeit verliehen. Harry Renó setzte sie ein wenig unter ihren Möglichkeiten ein, sie hätte mit ihm zusammen auch einen ganzen Abend getragen und zwischendrin immer mal etwas sagen können. Dem Charme ihres Landfahrermischmaschs konnte man sich schwer entziehen.
Die Stadt änderte ihr Gesicht, während sie weiterging. Aus den überfüllten altertümlichen Quartieren der Armen kommend, war sie zwischen hohe Geschäftshäuser des späten neunzehnten Jahrhunderts geraten, das Meer rückte näher, dunkelblau leuchtend. Wie schade, es schon wieder verlassen zu müssen, obwohl es in Bari ebenfalls ein Meer geben würde, aber ob es auch ein so schönes war? Der Vesuv ließ hier unten mehr von seiner Silhouette sehen, diese sanft abfallende Linie, die sich dem Meer so allmählich entgegenbewegte, daß es unmöglich schien, den Punkt zu bestimmen, wo sie den Strand erreichte, wie bei einem Regenbogen, dessen Auftreffen auf der Erde noch niemand gesehen haben soll.
Sie näherte sich der Uferstraße, die dicht befahren war. Wie die Neapolitaner Auto fuhren, ohne weiter auf Regeln zu achten, nicht zu schnell, geschmeidig die Situation einschätzend, die Augen überall, jede Lücke sofort schließend! Es war für sie ein Vergnügen, diese Uferstraße à la napolitaine zu überqueren: statt nach links und rechts zu schauen, sich einfach in den Verkehrsstrom hineinzubegeben, ruhig voranzuschreiten, darauf zu vertrauen, daß die Autos sanft abbremsten, leicht um sie herumfuhren, ihre Reihen für sie öffneten und sich hinter ihr wieder schlossen. So waren die Israeliten durchs Rote Meer gezogen, wunderbar und selbstverständlich, man wußte sich eins mit einem größeren gesellschaftlichen Ganzen und mußte sich ihm trotzdem nicht unterwerfen. Auf diese Weise wollte sie leben, fließend, voraneilend, weder zurück noch zur Seite schauend, und es war eine Freude, sie gehen zu sehen. Den Autofahrern, die für sie bremsten, war das anzumerken. Sie schritt durch ein Spalier des Lächelns.
Aber jetzt fühlte sie auch, daß sie durstig geworden war. Der Fingerhut voll Espresso in der Pension verstand sich ja nicht als Getränk im engeren Sinn, war eher ein bittersüßes Tonikum zum Beginn des Tages. Anstatt umzudrehen und zu Harry Renó zurückzukehren, von dem sie sich, unablässig abwärts laufend, schon recht weit entfernt hatte, hielt sie hier unten Ausschau nach einer Bar, in der sie um ein Glas Leitungswasser bitten könnte.
Eine Bar war weit und breit nicht in Sicht, dafür aber ein großes Hotel, der Landzunge mit dem Castel dell’Ovo gegenüber, ja, das war noch besser als eine Bar. Sie beugte sich zum Seitenspiegel eines parkenden Autos und malte die Lippen rot. Die Straße war ihr Boudoir. Und wieder zurück und hinein in den Verkehr, es war wie ein Ins-Wasser-Springen.
Im Hotel Excelsior schien sie erwartet, so eilfertig riß der Portier die Tür für sie auf. Solche altmodischen Grandhotels waren ihr wohlvertraut, man könnte sagen, genetisch, denn ihr Großvater war Maître d’hôtel gewesen. Den hatte sie zwar nicht mehr gekannt, aber die großen Gastmähler der Galeristen hatten nach Ausstellungseröffnungen oft in solchen Häusern stattgefunden, in der avantgardistischen Kunstszene gab es eine Vorliebe für Belle-Époque-Pomp. In den Jahren vor dem Tod ihres Vaters war die Familie in wachsendem Maße bei derlei Gelegenheiten zugelassen gewesen. Das Mädchen, mit vierzehn schon frühreif, wurde immer mitgenommen; die Mutter hatte bemerkt, daß sie gefiel. Ihrem Lebensgefühl nach war ein solches Hotel der Ort, an dem irgendwer bezahlt, bei dem man sich noch nicht einmal bedanken mußte.
Dies leitete sie auch jetzt, als sie sich zur Bar wandte. Es war später Vormittag, an einen Aperitif vor dem Mahl durfte man schon denken. Die Sonne legte breite Bahnen zwischen die Sessel und ließ die Ranken des Teppichs verblassen. Sie wählte ein Tischchen mit Blick auf den Vulkan, der sollte ihr Gegenüber sein, wenn sie hier allein saß. Ohne irgendeinen Gedanken, ohne Sorge und ohne Plan, mit freiem, offenem Blick, bestellte sie ein Glas Champagner.
5
Ihr Eintreten war nicht unbeachtet geblieben. An einem anderen Tisch saß eine größere Gesellschaft, die sich auf das Mittagessen einstimmte. Sie warf nur gelegentlich einen Blick dort hinüber, beiläufig, obwohl sie bemerkte, daß offenbar über sie gesprochen wurde. Gab es da nicht sogar ein verhohlenes Herüberzeigen? Ein schwerer Mann lehnte breit in seinem Sessel, er nahm an dem Gespräch der Runde nicht teil und war umgeben von drei Damen. Eine davon kam ihr bekannt vor – war sie ihr auf einer Vernissage in Paris begegnet? Dann eine Pummlige in engem Seidenkostüm mit viel rotem Haar, daneben eine eher männliche, unkokette Frau mit gleichwohl flammend rot gemaltem Mund. Sie musterte die Leute vorurteilsfrei – «ich habe keine Gesichtspunkte», das war eine häufige Wendung von ihr, die Menschen waren, wie sie waren, in jedem mochte sich etwas Überraschendes verbergen. Männer sah sie überhaupt mit Sympathie. Einen häßlichen Mann, das gab es für sie eigentlich nicht; Männer waren derart andersartig als Frauen, daß das Äußere nur ungenügende Informationen über sie vermittelte.
Verrückt, daß man sich als Frau mit Männern beschäftigte, das dachte sie tatsächlich manchmal, aber man machte es eben. Sie schien sich ihrer eigenen Wirkung gar nicht bewußt und war zu jeder Frau von natürlicher Herzlichkeit, aber sie interessierte sich nicht für sie. Und die andere war sofort vergessen, wenn ein Mann hinzutrat, mit dem sie allerdings einen anderen Ton anschlug, spöttisch und ein wenig provozierend.
Ihr Glas war leer, denn sie hatte in großen Zügen getrunken. Sie bestellte ein zweites. Es gab Frauen, die sich allein in Hotelbars setzten; zuweilen standen sie mit dem Chefportier im Bunde. Sie vermutete, das Getuschel am anderen Tisch hatte mit dem Verdacht zu tun, sie gehöre in diese Kategorie. Das machte sie nicht verlegen. Ihre Aufmerksamkeit galt nur dem Vulkan, der im hellgrauen Dunst vor sich hin brütete, obwohl er bis zum Rand voll prasselnder Feuersglut steckte. Jetzt wäre es gut gewesen, etwas zum Lesen dabeizuhaben. Sie nahm die Karte, schlug sie auf und begann, sie zu studieren. Viel stand da nicht, aber sie nahm es mit dem höchsten Interesse auf. Die Preise waren, wie in einem solchen Hotel die Preise eben sind: so weit über ihrem Budget liegend, daß sie ohnehin nicht hätte bezahlen können, aber das war ein sachlicher Gedanke, es griff keine Hand nach ihrem Herzen. Sie spielte sich selber die vorzüglich Unterhaltene vor, das paßte zum In-dieser-Bar-Sitzen. Und sie war beschäftigt; es entstand keine seltsame Situation, wenn von dort drüben zu ihr herübergeschaut wurde – das Herübersehen wurde durch diese Lektüre sogar ermutigt.
Ein junger Mann löste sich aus der Gruppe, sehr korrekt in dunklem Anzug, leicht tailliert und mit dunkler Krawatte, der einzige Beschlipste des Kreises. Er hatte vorher sein Ohr dem Schwergewicht zugeneigt und offenbar Anweisungen entgegengenommen und trat nun auf sie zu, nach ihrer Einschätzung eher ein Männlein mit Brille und gesträubtem Haar – doch, diesen Typus gab es auch auf den Vernissagen, die schrieben Katalogbeiträge, die keiner las, aber die unbedingt in einem Kunstbuch drin sein mußten. Er beugte sich zu ihr und sagte auf Französisch mit starkem deutschen Akzent: «Madame, wenn Sie einen Vorschlag gestatten – dort drüben sitzt eine Runde, die Gäste von Monsieur Ralph Krass» – er sprach den Namen aus, als müßte jeder ihn kennen. «Wir würden uns glücklich schätzen, insbesondere Monsieur Krass, wenn Sie an unserem Mittagessen teilnehmen würden. Hoffentlich sind Sie frei.»
Ja, war sie denn frei? Um fünfzehn Uhr sollte der Zug nach Bari gehen. Harry Renó müßte irgendwie erfahren, daß sie nicht mehr ins Hotel, sondern unmittelbar zum Bahnhof käme. Das waren Gedanken, die ihr durch den Kopf gingen, aber ein anderer Gedanke durchkreuzte sie: Die beiden Gläser Champagner sind jetzt schon einmal bezahlt. Da gab es eigentlich keine Wahl. Außerdem fand sie Herrn Krass – nur der Schweigende, Massige konnte das sein – anziehend, buchstäblich: Er zog sie an, sie spürte den Sog, sie erhob sich und ging mit langsamen Schritten hinüber. Die Herren standen auf, ein Mann mit weißer Mähne begrüßte sie mit Handkuß, den sie bereitwillig entgegennahm. Die Leute murmelten ihre Namen. Sie nannte den ihren erst, als der Große, Schwere mit Bedeutung «Ich bin Ralph Krass» gesagt hatte.
«Ich bin Lidewine Schoonemaker.»
Alle Augen ruhten auf ihr, die von Madame Lecœur-Jouët mit spöttischem Lächeln, die von Frau Roslovski mit trübem Blick, als wollte sie sagen: «Ich hab nur drauf gewartet, das mußte ja sein …», Frau Rizzi zeigte unverhohlene Neugier. Aber dann, und das hatte in dieser Gleichzeitigkeit durchaus Komik, wandten sich alle wieder einander zu, als gelte es, Herrn Krass mit seiner Neuanwerbung allein zu lassen, und der rechnete auch mit solchem Takt. Frau Rizzi, bisher an seiner Seite sitzend, mußte rücken, der Kellner brachte einen weiteren Sessel. Jüngel wies ihn leise an, die Getränke der jungen Dame bitte auf die große Rechnung zu schreiben. Er hatte mit seiner Rolle noch nicht viel Übung, war nie in einer ähnlichen Situation gewesen, barst vor Diskretion und hielt sich weit weg von seinem Herrn, um dessen Unterhaltung nicht zu behindern, aber mit Blickkontakt, um auf ein erstes Zeichen hin sofort aufspringen zu können. Unterdessen vertrat er Herrn Krass bei den anderen als Gastgeber. Auch an diesem Tisch war man, der Tageszeit angemessen, beim Champagner. Die zweite Flasche wurde herbeigeholt, in weißem Glas mit goldenem Schild.
Man hatte schon etwas besichtigt am Vormittag. Jüngel hatte einen Rundgang durch das alte Stadtzentrum vorbereitet; für ihn eine Qual, denn im Gedränge der Gassen blieb die Gruppe nicht so zusammen, daß sie seinen Erklärungen hätte lauschen können; man verspürte auch wenig Neugier darauf. Beim Schlendern auf Cardo und Decumanus, den Hauptstraßen der antiken Neapolis, gab es so viel zu entdecken, daß niemand zuhörte und jeder dem anderen etwas zeigen wollte. Jüngel hatte sich deshalb an Herrn Krass gehalten, der an diesen Unterhaltungen nicht teilnahm, sondern sich gedankenvoll und mit schweren Schritten durch die Menge bewegte, als sei er der unerkannte Herr dieser Stadt, auf dessen Befehl hin jederzeit die Kanonen hoch oben auf der Fortezza Sant’Elmo gelöst werden könnten.
«Neapel, sagten Sie, heißt Neustadt.» Unvermittelt tauchte er aus der Tiefe an die Tagesoberfläche auf. «Dann gab es wohl auch eine Altstadt …»
«Ganz richtig.» Jüngel wollte loben, aber seinen Wissensvorsprung nicht betonen. «Es gibt eine Vorgängerstadt: Neapolis wird um siebenhundert gegründet, aber die Vorgängerin Paleopolis, die Altstadt, verliert sich im Dunkel der Geschichte.»
«Wir müssen also sagen, das hier war immer Stadt, immer Kultur, lange bevor die eigentliche europäische Geschichte beginnt?»
Jüngel beeilte sich mit der Bestätigung: «Ja, eine Griechenstadt, das Beste, was es gibt.»
Dies machte auf Herrn Krass offenbar einen günstigen Eindruck. Ein Superlativ, ein übersichtliches Aperçu, damit konnte man etwas anfangen. «Eine Kulturstadt, sagen Sie, sogar Hochkultur. Aber warum eine solche Gründung am gefährlichsten Punkt Europas, wo ein Vulkanausbruch das alles innerhalb von Stunden vernichten kann – und so was ist ja vorgekommen. Wieso kreiert man Architektur und Malerei ausgerechnet dort, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, daß alles wieder zerstört wird? Und warum kann man über die Jahrtausende nicht aus der unabänderlich feindlichen Disposition lernen? Wieso lernt der Mensch so wenig?» Und mit einer unerwarteten Wendung: «Warum lernen Sie, Herr Doktor Jüngel, so wenig? Diese Altstadtführung ist ein Desaster. Wir kürzen das jetzt ab. Die Damen haben Durst.»
So friedlich, heiter, genußfreudig der Kreis von Herrn Krass durch die Stadt geschlendert war und sich dann widerstandslos in Taxis hatte verteilen lassen, von Signora Rizzi sogar ausdrücklich begrüßt – «ich habe allmählich Hunger» –, so spannungsvoll stellte sich dies alles für Jüngel dar. Er hatte für die reibungslosen Abläufe zu sorgen, und diese Aufgabe brachte in ihm eine schier verrückte Übertreibung seines Pflichtgefühls hervor: Sogar für das Niveau der Gespräche, das er doch keinesfalls beeinflussen konnte, sah er sich verantwortlich, obwohl er im Grunde doch gar nicht daran teilzunehmen hatte. In der sonnendurchfluteten Behaglichkeit der Excelsior Bar, das Meeresglitzern gelangte bis hierher, war die Konversation denn auch an einen Tiefpunkt gelangt, der von der Festlichkeit der äußeren Umstände denkbar abstach. Gut, die Herrschaften waren von dem Spaziergang etwas ermattet, aber es war zwölf Uhr, die Stunde der Vollkommenheit, der Champagner hätte doch gleichfalls belebend wirken müssen. Stattdessen sagte Frau Roslovski in das Schweigen hinein: