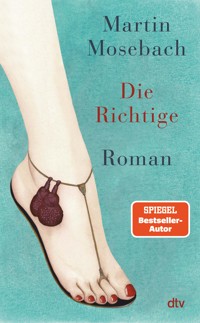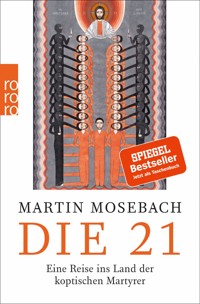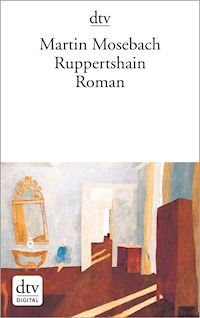9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Möchtegern-Literat reist in die Arktis – ein furioser Schelmenroman. Der ahnungslos entschlossene Theodor Lerner taumelt um die Jahrhundertwende in ein aberwitziges Unterfangen: Angestiftet und manipuliert von einer üppigen Hochstaplerin, der verwegenen Frau Hanhaus, reist er auf einem schrottreifen Dampfer in die Arktis, um eine herrenlose Insel zu annektieren. Was wie ein höchst unwahrscheinliches Capriccio anmutet, ist ein absurdes, aber wahres Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte – Martin Mosebach entfaltet virtuos und komisch ein gründerzeitliches Panorama der Absurditäten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Martin Mosebach
Der Nebelfürst
Roman
Über dieses Buch
Ein Möchtegern-Literat reist in die Arktis – ein furioser Schelmenroman.
Der ahnungslos entschlossene Theodor Lerner taumelt um die Jahrhundertwende in ein aberwitziges Unterfangen: Angestiftet und manipuliert von einer üppigen Hochstaplerin, der verwegenen Frau Hanhaus, reist er auf einem schrottreifen Dampfer in die Arktis, um eine herrenlose Insel zu annektieren.
Was wie ein höchst unwahrscheinliches Capriccio anmutet, ist ein absurdes, aber wahres Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte – Martin Mosebach entfaltet virtuos und komisch ein gründerzeitliches Panorama der Absurditäten.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Oktober 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Die Originalausgabe erschien 2001 im Verlag Eichborn AG, Frankfurt am Main
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
Umschlagabbildung Cina F. Sommerfeld
ISBN 978-3-644-40250-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
1Die Droschke bremst, die Dame stürzt
Ein paar Schritte aus der kleinen Familienwelt heraus, und man war so weit weg, als sei man ausgewandert. Auswandern, das war ein schöner Plan. Leider war Theodor Lerner kein Engländer, denen stand die halbe Welt offen, denn sie gehörte ihnen. Aber es gab auch Argentinien, wo man Rinder züchten, Brasilien, wo man Kaffee anbauen, Panama, wo man eine Reederei betreiben konnte. Andere gingen nach Rußland und handelten dort mit Zucker und Indigo. Das verwandelte sich dann alles in lauteres Gold. Wenn solche Leute zurückkehrten, bewohnten sie in Wiesbaden oder Godesberg Villen mit Türmen und Terrassengärten und ruhten ihren am Anblick des Außerordentlichen müde gewordenen Blick an der milden Rheinlandschaft aus.
Theodor Lerner fand, daß er gut schreibe. Man konnte auch Reiseschriftsteller werden. Solche Leute ritten auf Elephanten zur Tigerjagd und führten ihr Journal beim Schein der blakenden Karbidlampe. Die Leserschaft zu Haus ließ sie zu höchsten Ehren gelangen. Reisebücher las mit Respekt selbst Vetter Valentin Neukirch, der strenge Bergswerksdirektor, der Lerner stets untüchtiges Plänemachen vorwarf. Einstweilen versuchte Theodor Lerner sich mit Aufträgen vom Berliner Lokalanzeiger. Man schickte ihn aus, wenn es irgendwo brannte. Das war wörtlich zu verstehen. Lerner hatte nun schon elf Brände geschildert. Die ersten waren ein Erlebnis. Man stand in der gebannt starrenden Menge, hatte kalte Füße, zugleich wehte der Feuersbrodem herüber, Funken stoben, ein Balken krachte, an einem Fenster erschien eine Verzweifelte im Nachthemd und warf ihr Kind in das aufgespannte Sprungtuch. Lerners atemlose Berichte kamen in der Redaktion recht gut an. Man sah ihn als Spezialisten für solche Fälle. Würde ganz Berlin niederbrennen müssen, bis er eine neue Aufgabe bekam?
Der sorgenzerfurchte Chefredakteur hatte kein Ohr für Lerner. Die Auflage stagnierte. «Wir brauchen etwas Exklusives, man muß uns das Blatt aus den Fingern reißen», murmelte der elegante Mann, zu dem Sorgen gar nicht paßten. Er war gerade zum «Schönsten Mann des Berliner Presseballs» gewählt worden. Das Damenkomitee war von Parteigängerinnen durchsetzt.
«Wissen Sie, wo Ingenieur André ist?» Lerner wußte es nicht. Ingenieur André war vor drei Monaten mit einer Montgolfiere aufgebrochen. Er wollte den Nordpol überfliegen.
«Wie erkennt er den denn von oben?» fragte Lerner. Er schien sich vorzustellen, daß am Nordpol ein hübscher Obelisk oder eine aus Eisblöcken gebildete Pyramide stehe. Bei Gemälden von Napoleons Überquerung des Sankt-Bernhard-Passes lag verwittert zu den Hufen des sich aufbäumenden Rosses eine Steintafel, auf der «Hannibal» stand. Lag am Nordpol am Ende auch solches archäologische Fundgut, von Eskimos oder Wikingern vor tausend Jahren dort aufgepflanzt?
«Sie sind rührend», sagte der Chefredakteur mit dem silbrig durchzogenen Schnurrbart. Lerner kannte einen guten Trick. Wenn er fürchten mußte, mit einer Bemerkung seine Ahnungslosigkeit zu verraten, machte er dazu stets die Miene, als habe er einen Spaß gemacht. Immerhin besaß er ein Gefühl dafür, wann er sich auf unsicheren Boden begab. Der Chefredakteur wurde jetzt abgelenkt.
«Nein, sagen Sie der Dame, daß ich sie nicht empfangen kann», sagte er zu seinem Sekretär, der die Tür zum Vorzimmer hatte offenstehen lassen. Draußen war ein Schatten wie von einer hochgewachsenen Frau mit bedeutendem Hut, großer Büste und raumverdrängenden Stoffmassen am Leib zu erkennen. Der bloße Schatten kündigte etwas Bedeutendes an. In den Hafen des Vorzimmers war ein fünfmastiges Schlachtschiff eingelaufen. Lerner staunte, daß man einen solchen Besuch einfach beiseite schieben konnte.
«Diese Person bringt immer irgendwelches Material an, will irgendwelche skandalösen Briefwechsel verkaufen, Erinnerungen von russischen Spionen, Liebesbriefe allerhöchster Personen, aber entweder sind die Sachen zu teuer, oder sie hat sie dann doch nicht, oder es ist nichts Rechtes – und ich will jetzt etwas über Ingenieur André im Blatt haben.»
«Wie schreibt man über einen Verschollenen?» fragte Lerner. «Ein Verschollener zeichnet sich doch gerade dadurch aus, daß er weg ist und niemand weiß, wo. Das Biographische und die Vorbereitung der Expedition ist von allen Blättern schon vielfach durchgekaut worden, und jetzt ist er eben verschwunden.»
Niemandsland – gab es das auf der Erde? Ein Land, das niemandem gehörte und das keinen Weg und Steg hatte, vielleicht nicht einmal ein Oben und Unten? Man durchschritt eine Grenze, eine Nebelmauer und sank ins Bodenlose, in eine Lawine aus Pulverschnee, in der man nichts erkannte, in der es aber seltsam hell blieb wie an einem nebelverhangenen Wintertag. Gehörte zum Niemandsland nicht auch, daß seine Grenzen nicht bekannt waren?
«Man müßte André suchen», sagte der Chefredakteur. Das taten zwar schon einige Leute. Sie waren so weise, ihm nicht zu Luft zu folgen, sondern mit Hundeschlitten und auf Skiern. So waren diese Helden photographiert worden und so hatten die Leser sie im Gedächtnis. Jetzt waren auch sie verschwunden. So sensationell solche Geschichten klangen, für die Presse gaben sie nicht viel her. Man entfachte erst eine Riesenaufregung und dann blieb das Material zum Nachlegen aus. Eine zerfetzte Ballonhülle würde womöglich alles sein, was die Rettungsexpedition nach Hause brachte. Der Ingenieur fiel den Eisbären anheim. Ein Grab für Ingenieur André würde es ebensowenig geben wie einen Obelisken am Nordpol.
«Ja, Lerner, kriegen Sie raus, wo André ist! Suchen Sie André!» Das war ein Ausbruch der Bitterkeit, eine satirisch-kaustische Theaterspielerei des Chefredakteurs. Lerner verstand diese Worte auch als Anklage. Der Chefredakteur wollte ihm bedeuten, daß er zu gar nichts gut sei – für die tägliche Arbeit vielleicht, bei der ihn Hunderte ersetzen konnten, aber nicht, wenn es um die Rettung des Blattes ging. Der Chefredakteur fand solche Ausbrüche erzieherisch. Den einen spornten sie an, dem anderen wiesen sie seinen Platz zu. In Treptow brannte es in einem Anilinwerk, meldete der Sekretär. Es genügte ein einziger Blick des Chefredakteurs, Lerner aus dem Zimmer und auf den Weg zu weisen.
Draußen regnete es. Zum Glück stand vor dem Zeitungshaus des Lokalanzeigers eine Droschke. Der Verkehr war durch den abendlichen Schauer in die größte Verwirrung geraten. Auto- und Pferdedroschken schoben sich nebeneinander her, immerfort liefen Leute zwischen die Wagen, um auf die andere Seite zu gelangen. Wasser floß über die Windschutzscheibe. Lerner saß kaum, die Droschke war kaum angefahren, da erhob sich riesengroß durch die Wasserfluten auf der Windschutzscheibe vor dem Kühler des Autos eine Gestalt, wankte und fiel.
Dem Fahrer entfuhr ein erschrecktes Schimpfwort. Er bremste. Lerner sprang heraus. Vor dem Auto lag eine Dame im Nassen. Der hochgetürmte Hut saß noch auf ihrem großen Kopf, war aber verrutscht. Der Regenschirm war davongeflogen und rollte der Fahrbahnmitte zu.
«Es geht», sagte die Dame mit erstaunlich fester Stimme, als sie ihren Retter erblickte. Er half ihr auf. Sie war schwer, ließ ihn das aber so wenig wie möglich spüren. Die Dame hinkte leicht, als er sie zum Wagenschlag begleitete. Ob er sie irgendwo hinbringen dürfe? Er selbst sei auf dem Weg nach Treptow. Dort brenne die Anilinfabrik.
«Die Anilinfabrik?» sagte die Dame, die schon dabei war, ihren Hut zu richten. Den tropfnassen Schirm brachte der Chauffeur. «Die Anilinfabrik ist schon gelöscht. Das war ein Fehlalarm, nicht wahr?» Dies sagte sie zum Chauffeur, der die Glasscheibe zum Fond noch nicht geschlossen hatte.
«Weeß ick nix von», antwortete der Mann mürrisch. Ärger über den Unfall und Erleichterung mischten sich in ihm. Dies war der nicht so seltene Fall, daß eine Bekundung des Nichtwissens eine Behauptung bestätigte. Im Fond war jetzt klar, daß es in Treptow nicht brannte und auch gar nicht gebrannt hatte. Im Warmen entfaltete sich der Duft, der aus den Kleidern und dem Haar der Dame stieg, Rosen und Zimt. Jung war sie nicht mehr, obwohl ihr Gesicht jugendlich glatt und ihre Augen frisch und gesund waren.
Wo sie wohne? Das Auto durfte immer noch nicht anfahren. Das sei es ja, sagte die Dame. Eben erst sei sie in Berlin angekommen, von engen Freunden – «Sie kennen vielleicht Herrn Rittmeister Bepler?» – eingeladen, und nun sei bei Beplers niemand zu Hause, unerklärlich. Da saß sie, Lerners Opfer – denn einem Herrn war das Ungeschick seines Chauffeurs stets anzurechnen –, und sollte nun mit beschädigtem Knöchel eine Heimstatt suchen. So sprach sie das nicht aus. Diese Frau jammerte nicht. Das war ganz einfach ihre Situation.
An Lerners Ritterlichkeit zu appellieren war stets von guten Chancen begleitet. Lerner war ritterlich, oder besser, er wollte es gern sein. Er sah sich gern als ausgesprochen ritterlichen Mann. Hier hatte er das richtige Gegenüber. Die Dame wußte Ritterlichkeit, auch in leicht demonstrativer Form, zu schätzen.
«Wohin geht es nu?» fragte der Chauffeur, wieder mit voller Brust mürrisch.
Es ging nach Wilmersdorf, in die Pension «Tannenzapfen», in der Lerner seit vier Wochen wohnte. Dort war gerade ein Zimmer freigeworden, denn der langjährige Gast Hauptmann Richter, Veteran von 1871, hatte in hohem Alter geheiratet.
«In dieser Pension heiraten alle, die komischsten Knochen», sagte die Wirtin zu Lerner. «Auch Sie gehen noch weg.» Und so fand denn, kurze Zeit später, in dem noch gar nicht richtig gelüfteten Zimmer des Hauptmanns am Tisch mit der Fransendecke unter dem Öldruck von Leonardo da Vincis «Letztem Abendmahl» – die Postkarten von Mädchen in Unterwäsche hatte der Hauptmann von der Tapete heruntergenommen – beim Lampenschein schon eine lauschige Teestunde statt.
Man machte sich bekannt. Die Dame war hochinteressiert an Lerners beruflichem Wirken. Sie könne ohne Zeitung nicht leben. Sie verschlinge die Zeitung. Ihre Stimme war warm. Sie war zwar gewichtig, aber elegant. Brauner Taft breitete sich um sie aus. Das graue Haar war voll und sah wie eine gepuderte Rokokoperücke aus, so frisch war das Gesicht darunter. Für Lerners Geschmack war sie zu alt und zu schwer, aber seltsam, das spielte auf einmal keine Rolle. Sie war nicht ein bißchen kokett.
«Sie ist natürlich», dachte Lerner, und «natürlich» hieß auf einmal sehr viel mehr und machte vieles, das eben noch ferngelegen hatte, möglich. Das Hineingleiten in einen langen Kuß war wie eine sanfte Fortsetzung des Gesprächs.
Lerners Hände tasteten sich voran. Es gelang ihm ein Widerhäkchen zu lösen. Das Häkchen hüpfte wie von selbst beiseite. Mit den Fingern fühlte er ihre Haut, weich wie ein im Glas schwimmender Eidotter.
Ihre Hand legte sich um sein Handgelenk und zog es mit entschiedener Kraft, aber langsam zurück.
«Wir sind uns sympathisch», sagte Frau Hanhaus, «aber das Weitere lassen wir. Ich habe Wichtigeres mit Ihnen vor. Diese Dinge können das Geschäft oft unnötig schwermachen.» Sanft, fest und mit einem kameradschaftlichen Lächeln war das gesagt. Dies Lächeln schaffte den Übergang. Lerner war ihr dankbar. Der Kuß hatte nach etwas Fadem geschmeckt, das ihn jetzt nicht störte, später aber störend geworden wäre. Als sie ihn an die Tür begleitete und er ihr zum Abschied die Hand küßte, sah er im Halbdunkel, gegen die Funzel im Zimmer, ihren Schattenriß.
«Ist das die Frau aus dem Büro des Chefredakteurs?» dachte er in seinem Zimmer. Konnten zwei Schatten sich so gleichen? Plötzlich war Frau Hanhaus dagewesen. Plötzlich? Vielleicht war sie immer schon anwesend, unsichtbar, und entschied nur, wann sich den anderen die Augen für sie öffneten. Und dann war sie plötzlich da.
2 Frühstück in der Pension «Tannenzapfen»
Frau Hanhaus hatte etwas Mütterliches, vor allem aber war sie Mutter. Nach der ersten Nacht in der Pension «Tannenzapfen» stellte sich heraus, daß sie so allein in Berlin nicht gewesen wäre, trotz des unbegreiflichen Betragens dieser Rittmeister Beplers im Grunewald draußen. Ihr Sohn vielmehr war es, der die Nacht buchstäblich mutterseelenallein in Berlin verbringen mußte. Unter dem großen Eindruck ihrer Gegenwart konnten Fragen zu ihren Erklärungen jedoch nicht aufkommen. Diese eben noch hochbedeutenden Beplers mit ihrem Vermögen, ihrer Villa, ihren mondänen Verbindungen spielten jetzt überhaupt keine Rolle mehr. Ohne daß Groll hinter diesem Desinteresse stand, waren diese Leute jetzt erst einmal abgeschrieben. Die Grunewaldvilla wurde durch die Pension «Tannenzapfen» im vierten Stock links vollständig verdrängt.
Frau Grantzow, die Wirtin, war gemütvoll, eine nicht mißtrauische, nicht zänkische Pensionswirtin, die ihre Gäste nicht übelwollend klassifizierte. Sie half Frau Hanhaus mit manchem Toiletteartikel aus, denn abgesehen von einer großen Handtasche war die Dame ja ohne Gepäck angekommen. So stattlich und gebietend erschien sie mit ihrer grauen Haartour und dem braunen Taft, daß man sie sich anders als mit Schrankkoffern reisend gar nicht vorstellen konnte. Und am nächsten Morgen war sie kein bißchen ramponiert, wie der Mensch, der ohne seine Siebensachen übernachtet hat, sonst auszusehen pflegt. Das Haar war frisch getürmt. Frau Grantzow hatte schwesterliche Dienste geleistet. Dabei führten die Frauen ein Gespräch, das zur vollständigen Hingabe von Frau Grantzow führte, während sie Hände voll Haarnadeln in die kräftigen Wellen versenkte.
«Viele heute machen den Fehler», so lehrte Frau Hanhaus später einmal, «ihre Aufmerksamkeit nur wohlhabenden, einflußreichen Personen zuzuwenden, damit man sein Pulver nicht bei Habenichtsen verschossen hat, wenn es gilt, bei Mächtigen Eindruck zu machen. Ich behaupte, daß solche Leute eben nicht genügend Pulver besitzen. Schlachten kann man gewinnen – ich meine Schlachten des Lebens –, wenn man die Laufburschen, die Tabaktrafikanten, die Etagenkellner, die Näherinnen, die Dentisten und die Pensionswirtinnen auf seiner Seite hat. Mancher hat schon gesagt: Ich kenne den Oberbürgermeister, und ist an einem kleinen Wachtmeister gescheitert.»
Gemeinsam mit Frau Grantzow und ihrem verdrossenen uckermärkischen Dienstmädchen begann nach dem Frisieren das Möbelrücken, wie es Frau Hanhaus an jedem Ort hielt, an dem sie ein wenig verweilte. Lerner erwachte von einem mächtigen Klagelaut aus tiefster gequälter Brust begleitet von überirdischem Klingen und Singen. Das war der große Spiegelschrank, der nebenan durchaus von seinem Platz neben dem Bett an die andere Wand geschoben werden mußte.
«Fühlen Sie, wie großzügig und geräumig alles wird und wie gut Ihre Stücke zur Geltung kommen, wenn wir Leonardo tiefer und ‹Spätes Glück› ganz abhängen? Sie müssen wissen, ich halte nichts von solchem Spätem Glück, jede Minute darauf zu warten, ist vertan.»
«Meinen Sie?» seufzte Frau Grantzow. Frau Hanhaus hatte einen empfindlichen Punkt berührt, aber sie machte das stets wie ein guter Arzt, daß es weh und zugleich guttat.
Als Lerner zum Frühstück erschien, das in einem länglichen düsteren Durchgangsraum vor der Küche gedeckt war, lagen auf dem mit Krümeln und gebrauchten Kaffeetassen nicht sehr einladend wirkenden Tisch mehrere schon auseinandergefallene Berliner Zeitungen.
«Großfeuer in Treptow», las Lerner im Berliner Börsencourier, «Anilinfabrik in Flammen» hieß es in der Tagespost, «Explosion in Treptow» in der Vossischen Zeitung. Im Lokalanzeiger stand an entsprechender Stelle: «Steht die Erweiterung des Berliner Zoos bevor?»
Lerner durchblätterte das Zeitungswirrsal mit fliegenden Händen. Was er las, stülpte sein Bild von der Wirklichkeit um. Es wurde ihm plötzlich klar, daß er den Brand in Treptow wirklich für ausgeschlossen gehalten hatte. Mit einem einzigen Wort hatte Frau Hanhaus, von ihrem Sturz kaum aufgestanden, regentropfensprühend wie ihr Schirm, jede Möglichkeit eines solchen Brandes in ihm zunichte gemacht. Er war so vor den Kopf geschlagen, daß er nichts hervorbrachte.
Frau Hanhaus frühstückte mit Appetit. Auf ihr Hörnchen fiel ein brauner Tropfen Apfelkrautsirup. Jetzt durfte Lerner von ihrem Sohn erfahren. Sie habe nach ihm geschickt und erwarte Alexander gegen Mittag. Lerner war immer noch vor den Kopf geschlagen. Mochte sie doch eine vielköpfige Sippschaft nachziehen. Seines Bleibens hier war ohnehin nicht länger. Frau Grantzow trat ein, zu Ehren von Frau Hanhaus in einer reich gerüschten Schürze.
«Es ist von der Redaktion antelephoniert worden», sagte sie streng. «Wenn ich gewußt hätte, daß Sie hier sind …»
«Was haben Sie gesagt?» murmelte Lerner matt.
«Daß Herr Lerner noch in den Federn liegt», antwortete die Wirtin mit einer Treuherzigkeit, als wolle sie Uhlands Gedicht «Vor allem eins, mein Kind, sei treu und wahr …» aufsagen.
Nun, das machte nun auch nichts mehr. Das Bild, das beim Lokalanzeiger von ihm bestand, wurde nur vollständiger. Packte er seine Sachen jetzt gleich, oder vertat er noch ein paar Tage in Berlin? Fuhr er zu Bruder Ferdinand? Wie wurde er dort empfangen?
«Die Zeitungen sind voll», sagte Frau Hanhaus genießerisch. Sie habe, wie jeden Morgen, auch heute schon «die Pressearbeit» geleistet.
«Der Brand in Treptow», sagte Lerner leise und legte seinen Kopf in die Hände. Es war kein Vorwurf in diesen Worten. Wer wollte in diesem heimtückischen Spiel mit falschen Gewißheiten gegen eine hörnchenfrühstückende Dame Vorwürfe erheben? Die Dämonen waren hier am Werk. Wie eine Billardkugel hatte er einen dämonischen Stoß bekommen, der ihn aus der richtigen Bahn, auf der er sich befand, hinausschleuderte. War er nicht eben noch mit seinen Brandreportagen herzlich unzufrieden? Empfand er sich nicht gestern noch beim Lokalanzeiger auf totem Gleis? Jetzt kam es ihm vor, als habe seine Zukunft in dieser Arbeit gelegen. Der Chefredakteur war in der Erinnerung plötzlich viel angenehmer. Ein weltläufiger Mann, hatte doch auch als Lokalreporter angefangen, sprach auch offen davon. Er sehe sich als Kollegen seiner jungen Leute. Dieser Zeitungsdienst war für Lerner jetzt, wo er davon Abschied zu nehmen hatte, eine romantische, geradezu abenteuerliche Tätigkeit. Dieses alarmierte Aufbrechen zu den Katastrophen! Dieses In-die-Tasten-Greifen zur tiefen Nacht! Die zynische Lustigkeit des Reportervölkchens, denen imponierte nichts.
«Wollen Sie hören, was ich hier herausgefunden habe? Ein Aufsatz, der reines Gold wert ist», sagte Frau Hanhaus, ergriff mit großer weißer Hand – sie trug einen Amethyst, der schön zu ihrem braunen Kleid paßte – die raschelnde Zeitung, mit der anderen klappte sie ihre Lorgnette aus.
«Das ist etwas für Sie. Sie werden noch glücklich sein, daß wir heute morgen hier zusammengesessen haben, junger Mann.» Und nun begann sie aus dem Wirtschaftsteil des Berliner Börsencouriers einen längeren, nüchtern referierenden Artikel über die Aktivitäten des Deutschen Hochseefischereivereins vorzulesen, mit warmer, sprechgeübter Stimme, leicht dramatischem Tonfall und bedeutungsvollen Blicken, die sie, in kleinen Pausen, Lerner zuwarf, als sei ihr Zuhörer über den Sensationswert der Nachricht schon längst im Bilde.
Es ging – ja worum ging es? Das rauschte an Lerner in seinem versteinerten Unglück weitgehend vorbei. Der Deutsche Hochseefischereiverein tat sich nach neuen Fanggründen für Kabeljau und Goldbarsch um und kreuzte nun auch dort, wo ohnehin die meisten Fangflotten sich herumtrieben, im hohen Norden nämlich, in den unwirtlichen Zonen zwischen Norwegen und dem Nordpol, wo die Inseln oder Eisschollen die drolligsten Namen trugen: Franz-Joseph-Land hieß etwa solch ein verfrorenes Fleckchen, wahrscheinlich größer als ganz Berlin, aber nur von Seehunden und Pinguinen bevölkert. Dort jedenfalls hatte man vom Brand in Treptow nichts gehört, auch nicht vom blamablen Ende eines fixen Reporters. Auf solchen Inseln machten die Fischkutter halt. Dort errichteten sie Vorratsschuppen. Dort trockneten sie Fisch. Dort mußten sie wohl auch überwintern, wenn der Winter zu früh hereinbrach und der Heimweg vom Treibeis abgeschnitten war. Eine dieser Inseln hieß die Bären-Insel. Dort machten offenbar Braunbären oder Grizzly- oder Eisbären den deutschen Fischern Konkurrenz.
«Die herrenlose Bären-Insel», las Frau Hanhaus mit geradezu drohender Betonung – «Merken Sie sich das Wort ‹herrenlos›!» fügte sie mit hochgezogenen Augenbrauen hinzu. Das Wort «herrenlos» kannte Lerner nur im Zusammenhang mit Hunden. Herrenlose Hunde wurden vom Hundefänger eingefangen. Große herrenlose Hunde bekamen die Altwarenhändler für ihre Hundekarren, auf denen sich die alten Zeitungen und die Knochen stapelten. Herrenlos war etwas Unattraktives, Armseliges. Was keinen Herrn besaß, das wollte kein Herr besitzen.
Nein, ganz im Gegenteil. Die Bären-Insel sei herrenlos, weil es zu viele Herren gebe, die daran Interesse anmeldeten, Norwegen, Rußland und England bisher, deren diplomatische Balance jedoch so prekär sei, daß niemand den ersten Schritt wage.
Und warum sollte sich jemand um solch einen Felsen zwischen der Strafgefangeneninsel Nowaja Semlja und Spitzbergen kümmern?
«Das war bis jetzt ein Geheimnis, ist ab jetzt aber keines mehr», sagte Frau Hanhaus mit einer verheißungsvollen Märchenstimme, als lüfte sie dies Geheimnis für ihn ganz allein und habe es nicht der Zeitung entnommen. Bei den Ausschachtungsarbeiten für das Fundament eines der Fischlagerhäuser war man unmittelbar unter einer dünnen Erdschicht auf Kohle gestoßen. Steinkohle vorzüglicher Qualität! Sie hielt vor Erregung den Atem an: Steinkohle.
«Von mir aus Ostereier», rief Theodor Lerner jetzt wütend. Der Panzer der Verzweiflung fiel von ihm ab. Er war zornig. Steinkohle bei den Eisbären. Er habe wahrhaft andere Sorgen.
«Sie waren es, die mich abgehalten hat, nach Treptow zu fahren. Die Anilinfabrik ist ausgebrannt. Das Feuer war erst nach fünf Stunden unter Kontrolle. Ein Feuerwehrmann ist verunglückt. Ein Kessel ist in die Luft geflogen. Die Anwohner mußten die Häuser verlassen. Der ganze Stadtteil Treptow stand auf dem Kopf. Und Sie haben mir erklärt, dort brenne es gar nicht. Woher wußten Sie das? Hat das auch in der Zeitung gestanden? Ich bin Reporter. Ich habe versagt – wegen Ihnen! Sie haben meine Existenz zerstört. Meine Stellung dort war wacklig, aber solch ein Versagen läßt einem Volontär niemand durchgehen – zu Recht. Bitte lassen Sie mich jetzt mit der Kohle von der Eisbäreninsel in Frieden.» Das alles kam sehr scharf und gefährlich. Die Sätze zischten und knallten nur so. Er hatte Lust, Frau Hanhaus den Berliner Lokalanzeiger ganz buchstäblich um die vollen, faltenlosen Wangen zu schlagen, genau dieses Blatt mit der Zoo-Meldung, die nur so nach Verlegenheit stank. Was heute morgen in der Redaktion los war, konnte eine solche Frau überhaupt nicht begreifen. Wer war sie eigentlich? Woher nahm sie sich das Recht heraus, Täuschung und Verwirrung in fremde Leben zu tragen?
«Gute Frage!» hätte Lerners alter Onkel mit der weißen Schnurrbartbürste gerufen. Gut war eine Frage, die nicht, oder nicht ohne weiteres zu beantworten war, so hielt es jedenfalls dieser Onkel. Theodor Lerners Zorn hätte für eine lange Tirade, auch für Handgreiflichkeiten ausgereicht. Frau Hanhaus schien das zu wissen, ja zu bewundern. Sie saß da mit vorgewölbter Büste, von festem Lockenwerk umrahmt, und sah ihn offen und herzlich an. Sie war jetzt weder die Frau einer schwachen Minute, wie gestern abend, noch die frische Kameradin. Anerkennung und Würde gingen von ihr aus. Das blieb Lerner selbst in seinem Furor nicht verborgen. Er war neugierig. Das war seine Stärke und seine Schwäche. Was würde sie antworten?
Sie pflichte ihm bei, und zwar in jedem Punkt, begann Frau Hanhaus ihre vom Ausdruck starker Intelligenz und Geistesgegenwart getragene Erwiderung. Was Herr Lerner übersehe – wenn er den Hinweis erlaube –, sei nur, daß es ihr gerade und ausschließlich um seine Position in der Zeitung zu tun sei. Was sie darlegen wolle, sei nicht in einem Wort gesagt, soviel aber jetzt schon: der Aufsatz im Börsencourier ziele exakt auf ihn mit seinen Möglichkeiten als Redakteur.
«Das bin ich nicht und werde ich jetzt auch nicht mehr werden!» fuhr er gereizt dazwischen.
«Hoffentlich», antwortete sie überraschend schnell und entschieden. Jetzt streckte sie die Amethysthand in die Luft und ließ den Stein funkeln. Den Zeigefinger der anderen Hand legte sie auf den Daumen.
«Erstens, Ingenieur André ist seit Monaten mit seinem Luftballon im Eismeer verschwunden. Zweitens» – der Zeigefinger kam an die Reihe –, «der Berliner Lokalanzeiger braucht Stoff für eine André-Reportage; drittens» – der Mittelfinger –, «auf die Suche nach André gehen Sie; viertens» – der Ringfinger mit dem violetten Stein –, «der Berliner Lokalanzeiger chartert Ihnen zu diesem Zweck ein Schiff; fünftens» – der kleine Finger –, «Sie passieren auf der Fahrt die Bären-Insel und nehmen sie in Ihr Eigentum. Sechstens – dafür habe ich keinen Finger –, Sie werden ein neuer Gulbenkian, ein Henckel-Donnersmarck, ein Rockefeller. Sie verlassen jetzt den Frühstückstisch und begeben sich in die Redaktion. Dort legen Sie dem Chefredakteur die ersten vier Punkte dar …»
Lerner sprang empört auf. Der mit geschnitztem Eichenlaub bekrönte Stuhl drohte umzufallen. «Das ist der reine Wahnsinn.»
Frau Hanhaus schwieg, aber hielt ihn fest im Auge.
3 Schoeps folgt seiner inneren Stimme
Zudritt hatten die Studenten sich photographieren lassen: Hartknoch und Quitte lehnten in Sesseln, Schoeps stützte sich auf Hartknochs Schulter, die andere Hand jonglierte die Bernstein-Zigarettenspitze. Orange und Grasgrün, die Farben der Burschenschaft Francofurtia, waren auf Mützchen und Bändern mit Buntstift eingezeichnet.
Kluge Muselmanen fürchten, daß ihnen beim Photographieren die Seele weggefangen wird. Es war, als sei dieses Burschenschafts-Jugend-Bild Beweis für solch eine magisch einfangende und festfrierende Kraft. Wie die drei Herren sich vor der Linse gelümmelt hatten, waren sie aneinander kleben geblieben.
Dabei war aus allen, wie man so sagt, «etwas» geworden. Quitte hatte das elterliche Kaufhaus erheblich vergrößert. Hartknoch war Primarius und gefragter Herzspezialist, Schoeps schließlich Chefredakteur des Berliner Lokalanzeigers, eine namhafte Figur des Hauptstadtlebens, anders als seine beiden Freunde nicht verheiratet, mit den kraftvollen Silberfäden im Schnurrbart aber ein gefragter Junggeselle.
Daß einer von ihnen nicht heiratete, entsprach einer nicht weiter fixierten Übereinkunft. Es war einfach bequemer, wenn ein Junggeselle die gemeinsamen Vergnügungen vorbereitete und überwachte. Dem Primarius Hartbloch hätte es nicht angestanden, als Mieter der stillen Wohnung in Zehlendorf aufzutreten, zu der alle drei Herren einen Schlüssel besaßen. Wer in dieser Wohnung untergebracht wurde, der mußte einverstanden und gewärtig sein, daß die drei Herren einzeln oder auch gemeinsam, angemeldet oder unversehens dort eintrafen. In dieser Wohnung herrschte der reinste Kommunismus, wie die drei Herren sich häufig mit herzlichem Gelächter versicherten. Chefredakteur Schoeps hatte als der Literat und Ästhet der drei Burschenschaftler die Ausstattung des verschwiegenen Quartiers übernommen. Von Nordafrika-Reisen mitgebrachte Kelims an den Wänden des Rauchzimmers schufen die Atmosphäre eines düsteren Zeltes. Darin blitzten Messingtabletts und reich gravierte Wasserpfeifen. Dolche in ziselierten Scheiden, ein Kamelsattel, bunte Likörflaschen mit ebenso bunten kleinen Gläsern und voluminöse Kissen waren nach und nach herbeigeschafft worden. Die Ampel warf ein vielfach gebrochenes Licht an die Stuckdecke. Das Fenster blieb meistens verhängt.
Das große Bett im Nebenzimmer hatte eine eigenartige Vorrichtung. An den Bettpfosten schwangen geschweifte Spiegel wie Türen in den Angeln. Wer in diesem Bett lag und die Spiegeltüren hinter sich schloß, dem war, als hätten sich ihm an allen Körperteilen Augen geöffnet, so viel war plötzlich zu sehen. Und wem all die Arme und Beine gehörten, war schon kaum mehr festzustellen. Den drei Burschenschaftlern war an solchem Durcheinander gelegen. Die Zehlendorfer Wohnung mit ihren verhängten Fenstern sollte keine Dauerbewohner, genauer: Bewohnerinnen haben. So war es von Anfang an beschlossen.
So wurde es seit neuestem aber nicht mehr gehalten. Die junge Frau, die gegenwärtig in dem Spiegeltürenbett schlief; schlug häufig die schweren Vorhänge zurück und ließ Licht und Luft in die Zimmer.
«Das ist nicht so gut», sagte Schoeps, als er sie von der Straße her am Fenster sah. Warum sei das nicht so gut? Die Antwort lag nahe, wurde aber nicht ausgesprochen. Der Betrieb in der Zehlendorfer Wohnung beruhte auf dem Unausgesprochenen. Wer sich diesen Regeln nicht fügte, der fand sich aus der schönen Regelmäßigkeit bald ausgeschlossen. Die Entfernung von Frauen, die zeigten, daß sie die Grundbedingungen des Zusammenseins nicht einzuhalten gedachten – die unauffällige Annäherung an die Wohnung und das Verbot, einen der drei Schlüsselinhaber zu bevorzugen oder zu benachteiligen –, oblag Schoeps. Er sorgte dafür, daß Damen das marokkanische Rauchkabinett nur betraten, wenn er etwas gegen sie in der Hand hatte. Es ging nicht darum, irgend jemanden zu irgend etwas zu zwingen, aber die Sicherheit geachteter bürgerlicher Existenzen wollte schließlich auch bedacht sein. Quitte hatte Töchter. Hartknoch stand im Lichte der Öffentlichkeit. Wenn das kleine Gedicht mit der Bitte «Grüß mich nicht Unter den Linden» nicht längst Volksgut gewesen wäre, hätte Schoeps sein Autor sein mögen. Dies Gedicht war geradezu die Bundeshymne der drei Burschenschaftler. Jetzt aber wollte diese diebische Freude, jenes Triumphgefühl, das mit dem Gedanken an dies Verslein verbunden war, bei Schoeps nicht mehr aufkommen.
Puppa Schmedecke, von Quitte Puppili, von Hartknoch Puppi genannt, war Schoeps Unter den Linden in ihrem gestreiften hellen Frühlingskostüm, das er selbst hatte machen lassen, entgegengekommen, hatte ihn voll ins Auge gefaßt und nicht nur nicht gegrüßt, sondern auch nicht das kleinste Erkennungszeichen gegeben, obwohl er sie flehend ansah und dabei, wie er sich wütend eingestand, wahrscheinlich recht dümmlich wirkte.
Schoeps mußte sich eingestehen, daß ihm die Herrschaft über das reibungslose Kommen und Gehen in der Zehlendorfer Wohnung entglitten war. Er hatte die Zügel dort nicht mehr in der Hand. Und warum? Weil er sich selbst nicht mehr im Griff hatte, wie er voll Bitterkeit dachte, als er Puppa hinterhersah und sie sich nicht ein einziges Mal umdrehte. Noch hatten die anderen Schlüsselinhaber nicht begriffen, was geschehen war – zum Glück – oder zu noch größerem Unglück? Wenn Schoeps wußte, daß Quitte oder Hartknoch soeben in Zehlendorf von ihrem Schlüsselrecht Gebrauch machten, wurde ihm geradezu übel. Das über ein Jahrzehnt gepflegte Vergnügen delikater Schwägerschaft war mit einem Schlag vergangen. Die bloße Erinnerung daran war peinlich und widerwärtig. Entspannung von verantwortungsvoller Tagesmühe hatte das Schlaf- und Rauchkabinett in zeitlosem Ampeldämmern einst verheißen.
Chefredakteur Schoeps verausgabte sich in der Redaktion des Berliner Lokalanzeigers. Er war ein ruheloser Chef – nicht geradezu von Einfällen berstend, er glaubte sogar, daß ihm eher wenig einfiel –, aber kritisch und sogar nörgelnd und höchst ungemütlich. Die Methode bestand darin, seine Schreiber derart unter Druck zu setzen, daß dabei gleichsam physikalisch deren Einfälle freigesetzt wurden. Wenn er im Sturmschritt ohne Jackett, mit gesträubtem Haar und einem Bündel schmieriger Druckfahnen ein Redakteursbüro betrat, war es, als halte seine Hand kein raschelndes Papier, sondern ein zuckendes Blitzbündel, um es auf einen unfähigen Knecht zu schleudern. Vernichtend sein Tadel, prunkend sein Lob, aber um Schoeps mit der Sonne in ihrem Auf- und Untergehen, in ihrem Sengen und Wärmen zu vergleichen, hätte der Rhythmus seiner Ab- und Zuwendung mehr Gravitas besitzen müssen. Schoepsens Sonne ging auf und unter wie ein Ball dotzt.
«Berliner Tempo, der Pulsschlag einer neuen Zeit», das wurde in den Redaktionsstuben des Berliner Lokalanzeigers weniger stolz als seufzend ausgesprochen. Es kam bei der unablässigen Aufregung auch gar nicht immer soviel heraus. Neuerdings wandten sich sogar kleine Teile des Publikums von Schoepsens Schlachtenlärm ab. Ins Gewicht fiel die Schrumpfung des Abonnements noch nicht, aber bei der Eigentümerfamilie wurden die Augenbrauen zusammengezogen.
Puppa Schmedecke von allen Seiten zu betrachten, von Puppa Schmedecke von allen Seiten bedrängt und überschwemmt zu sein, das wäre vor kurzem noch Schoepsens Soldatenlohn für den Tagesverdruß gewesen. Neuerdings aber machten sich der Zeitungsärger und eine oft genug bis zur Verzweiflung gesteigerte Unruhe beim Gedanken an Zehlendorf und Puppa gefährliche Konkurrenz. Was nach der Gemeinüberzeugung der drei Burschenschaftler niemals hätte eintreten dürfen, war nun eingetreten. Mit den beiden anderen reden kam nicht in Frage – «Lieber den Tod», dachte Chefredakteur Schoeps. Der Tod hatte für ihn, wie er verwundert bemerkte, seinen großen Schrecken verloren. Tod war nicht mehr das Schlimmstvorstellbare. Das Schlimmstvorstellbare war, wenn Puppa Schmedecke sich von einem Augenblick auf den anderen abwandte.
Schoeps staunte über sich. Wenn Puppa viel sprach, bildeten sich Speichelbläschen in ihren Mundwinkeln, was er eigentlich nicht mochte und sogar ein wenig abstoßend fand, und nun sah er diese Bläschen mit dem Wunsch, sie wegzuküssen. Die Frauen, die durch die Zehlendorfer Kabinette zogen, in die eigenen Angelegenheiten, gar den Beruf einzuweihen, war im Kreis der Burschenschaftler bis zur Undenkbarkeit verpönt, schon aus Diskretion, aber auch um den Reiz des Doppellebens auszukosten, die künstliche Geschichtslosigkeit im Zeichen der Wollust, aber nun fühlte Schoeps das dringende Bedürfnis, Puppa an seinem Leben draußen teilnehmen zu lassen. Wenn Quitte und Hartknoch gehört hätten, wie ihr alter Freund Redaktionsinterna vor Puppa ausbreitete, das hätte ein Kopfschütteln gegeben.
Aus solchen Geständnissen sollte natürlich die Botschaft sprechen: «Ich behandle dich wie einen Menschen. Ich gehe mit dir wie mit einer Ebenbürtigen um. Ich liefere mich dir ohne Vorbehalt aus.» Verstand Puppa diese Botschaft? Manchmal hörte sie gern zu, nackt im Spiegelkäfig des Bettes oder im japanischen Neglige auf den marokkanischen Polstern. Schoeps fühlte sich vor ihr zur gleichen Dramatik verpflichtet wie vor den Redakteuren. Sie gab längst Ratschläge, und er war für diese Anteilnahme so dankbar, daß er schwor, alles zu befolgen, was sie für richtig hielt.
«In der Redaktion bin ich inzwischen dem offenen Wahnsinn ausgesetzt», erklärte er Puppa. «Der Kerl, der mir den Brand in Treptow vertrödelt hat – eine Katastrophe, deren Ausmaß noch gar nicht richtig abzusehen ist –, rennt mir mit neuen Aberwitzigkeiten die Bude ein. Ich sage: Lerner, was wollen Sie hier noch, verschwinden Sie! Und er antwortet: Jawohl verschwinden, aber an den Nordpol und mit einem Schiff der Zeitung! Ich sage: Ich soll ein Schiff für Sie chartern, Mann? Jawohl, ein Schiff, sagt er.»
«Wieso ein Schiff?» fragte Puppa. Sie interessiert sich, frohlockte Schoeps. So abwegig sei das nicht, antwortete er voll Wichtigkeit und skizzierte das spurlose Verschwinden des unglücklichen Ingenieurs André mit seinem Luftballon. Ein Stoff sei das schon. Material stecke da schon drin. Das habe dieser Möchtegern-Reporter schon richtig gesehen. Aber man werde zum Teufel doch nicht gerade einen Nonvaleur, einen Nutnick, eine Null mit eigenem Schiff in den Norden senden!
Wen aber sonst?
Nun, gewiß nicht diesen Mann. Das kam mit jupiterhafter Wucht aus dem Olymp der Redaktion.
Wußte Puppa, wie sehr ihm das Herz klopfte?
Fragen über Fragen. Erhielt Theodor Lerner sein Schiff schließlich nur, weil Puppa die Friseuse von Frau Hanhaus war? Wurde die Welt gelenkt, wie der kleine Moritz sich das vorstellte, als der Lehrer vom «Unterrockregiment» der französischen Königsmaitressen sprach? Inzwischen war Moritz Schoeps erwachsen. Dankbar dachte er, wie nett Puppa wurde, wenn er tat, was sie befahl.
4Die Helgoland wird bemannt
Mansagt, Messer Cristóbal Colón habe die Mannschaft seiner Santa Maria in den andalusischen Gefängnissen werben müssen. Hidalgos, die Ehre und Vermögen im Spiel verloren hatten, Messerstecher, Duellhansel, Taschendiebe, Vergewaltiger, Pfaffen, die ihr Gelübde gebrochen hatten, hätten sein Schiff vollgemacht. Nun war die Santa Maria ein kleines Schiff, kleiner sogar als die allerdings mit Dampfeskraft über die Meere reisende Helgoland. So viele Verbrecher, wie die romantische Legende in den niedrigen Gelassen versammelt sehen will, paßten auf diese Nußschale gar nicht darauf, so daß man allenfalls vermuten darf, jeder einzelne Matrose sei wegen mehrerer Verbrechen gesucht gewesen. Es drückte sich in dieser Weigerung der anständigen Bourgeoisie, des sich redlich nährenden Bauernstandes, der frommen Mönche und soliden Landbesitzer, sich auf die Planken eines Schiffleins wie der Santa Maria zu begeben, nicht um eine Handelsreise zu machen, Rom zu besuchen, die Seeräuber und Mamelucken aufs Haupt zu schlagen, sondern mit unbekanntem Ziel auf unbekannter Route wahnhaft ins Blaue zu segeln, kein Mangel an Mut, an heroischen Tugenden oder Unternehmungslust aus, sondern nur die schiere Vernunft. Diese Vernunft lehrte, man solle kein sicheres Gut für ein ungewisses aufgeben. Wer ein Landgut, Weib und Kind, eine ordentliche Profession, liebende Eltern, berechtigte Hoffnungen auf ein zu erwartendes Vermögen besaß, mußte ja ein Narr sein, sich auf die Santa Maria zu begeben.
So wie dies Vorhaben nun einmal notgedrungen aussah, lockte es niemanden, der einen Ofen, und das heißt Haus und Hof besaß, aus diesem und hinter jenem hervor. Zu diesem Aufbruch ins Unbestimmte fanden sich nur Leute, die etwas Allzubestimmtes hinter sich ließen: das schwarze Elend, die Schande, die Strafe. Da ist es leicht, sich über die Besatzung der Santa Maria moralisch zu erheben.
Für die alltäglichen Geschäfte einer Regierung oder eines Handelshauses werden Staat und Familie immer gut beraten sein, sich an bewährte, wohlbekannte, erfahrene Persönlichkeiten zu halten. Nun stellt die Geschichte aber gelegentlich, stets überraschend, neben den üblichen Fall den unüblichen. Ließe sich eine solche erfolgreiche, ehrenwerte, erfahrene Persönlichkeit mit einem solchen Fall ein, so besäße sie nicht die beschriebenen günstigen Eigenschaften. Da der Takt, den die Geschichte anzuschlagen beliebt, jedoch fordert, daß einer das gefährliche und unsichere Werk übernimmt, schöpfen die Nationen in ernster Lage aus einem geheimen Schatz, den jede von ihnen besitzt. Und zwar muß tief geschöpft werden, denn man will an den Bodensatz heran, wo das Gelichter, Bankrotteure, Abenteurer, die Wahnsinnigen, aus dem Amt Gejagten sitzen. Der Reichtum einer Nation an großen Staatsmännern, genialen Kaufleuten und Gelehrten wird stets ergänzt von einem wohlverschlossenen Fundus an Lumpen und Versagern, der in den Stunden der Ungewißheit, des Hasards, der Gefahr aufgeschlossen werden kann.
Frau Hanhaus, die zwar keinen Staat lenkte, sich einer solchen Last aber gewachsen fühlte, war mit dieser Weisheit vertraut, drückte sie aber anders aus. Sie hatte eine Schwäche für Leute, die in der Gesellschaft «gescheiterte Existenzen» genannt werden. Wenn sie von einem General las, der wegen des Rumors sittlicher Verfehlungen aus dem Amt schied, suchte sie im Handbuch der militärischen Chargen augenblicklich den Werdegang dieses Mannes zusammen und trat mit ihm in Verbindung. Bankrotte Bankiers, abgewählte Abgeordnete, verurteilte Versicherungsbetrüger, im Streit mit dem Minister entlassene Diplomaten zogen sie förmlich an. Ihre Berechnung war einfach. Diese Leute hatten in Rängen agiert, die ihr sonst unzugänglich waren, weil die Tradition solche Ämter mit kunstvollen Bastionen umgeben hatte. Nun zerstörte der Skandal ihre einst glänzende Herausgehobenheit. An dem einst mit Ehrfurcht betrachteten Standbild durfte nun jeder menschliche Hund das Bein heben. Alle Freunde waren fern. Der einst Gefeierte stand allein und schutzlos da, keinen Verteidiger zur Seite. Und jetzt drang Frau Hanhaus plötzlich leicht zu ihm vor, in sein Sanatorium, sein Exil, seine Jagdhütte, seine Zelle im Untersuchungsgefängnis. Hier hörte er sie an, hier schüttete er ihr sein Herz aus und fand ein nie versiegendes Verständnis.
Aber was brachte dies Trösten und Anhören, während der Gescheiterte in der Ecke stand? Ein gestürzter Mächtiger besaß oft immer noch Möglichkeiten, Dankbarkeit zu zeigen. Manche seiner Verbindungen waren zerrissen, andere ruhten aber nur. Man konnte jetzt nichts für den Unglücklichen tun, verlor ihn aber nicht aus dem Auge und ließ Zeit verstreichen. Wer oben gewesen war, wußte, was oben gespielt wurde. Man konnte ihn ausfragen. Ein einstmals versiegelter Mund sprach jetzt ungehemmt. Frau Hanhaus sammelte Informationen. Oft wuchs aus der beiläufigen Bemerkung eines solchen Cidevant eine faszinierende Geschäftsidee. Manchmal erlebten die Gefallenen eine Auferstehung. Sie waren aus dem Fleisch der Einflußreichen gemacht, das ließ sich nicht auf Dauer unterdrücken. Wenn sie rehabilitiert wurden, waren sie für Frau Hanhaus allerdings verloren, denn dann dachten sie an die Zeit in der Hölle nicht gern zurück und versuchten die Bekanntschaften dort unten zu vergessen. Aber auch in den Zeiten des Unglücks gab es erstaunlich viele Leute, die den Sturz gar nicht mitbekamen und von den Titeln und der im Glanz erworbenen Statur ungestört beeindruckt blieben. Frau Hanhaus fand, daß der Mensch nicht so schlecht sei, wie Sektenprediger oder Philosophen manchmal behaupteten. Man stürzte sich auf fremdes Leid, weidete sich daran, genoß die Schadenfreude in vollen Zügen – das gab es freilich und schön war es nicht. Aber wie viele Leute zeigten auch Mitgefühl und wieviel mehr waren an fremdem Auf und Ab einfach desinteressiert, schauten kaum hin und hatten schnell alles vergessen.
Wie schnell überhaupt alles vergessen war! Dafür hatte Frau Hanhaus, auch in ihrem eigenen Leben, schon wundersame Bestätigungen erfahren. Sie selbst war es, die leicht vergaß, Kränkungen ohnehin, die brauchte sie gar nicht zu vergessen, die nahm sie gar nicht erst zur Kenntnis.
Als es darum ging, das Rettungsexpeditions-Corps auf der Helgoland für die Suche nach Ingenieur André zusammenzustellen, mußte sie aber dennoch ein wenig ihr Gedächtnis bemühen. Chefredakteur Schoeps war nun gewonnen, er drängte sogar, damit Ingenieur André nicht, während man sich in Vorbereitungen erging und alles gar nicht gründlich genug bedenken konnte, allein nach Hause fand. Herr Schoeps hatte, was nahelag, zunächst die Vorstellung, noch andere Herren aus der Redaktion des Berliner Lokalanzeigers in den hohen Norden zu senden. Er dachte vor allem auch an Photographen und Zeichner, um das Anschauungsbedürfnis der Abonnenten zu stillen.
«Wenn wir solche von Schoeps abhängigen Lichtbildner und Zeichner auf die Helgoland lassen, holen wir uns die Meuterei an Bord. Wie erklären Sie solchen Leuten, daß es uns um die Bären-Insel geht – denn der großartige Ingenieur André ist, wie sich jeder hier mit einer Zeitung in der Hand schon sagen kann, längst vom Eisbären gefressen und jedenfalls in sehr reduziertem, nicht mehr rettungsfähigem Zustand.» Zum Glück war der bereitstehende Photograph, ein gewisser Knecht, nicht seefest und schauderte bei dem Gedanken, wochenlangem Geschaukel ausgesetzt zu sein. Ein gewisser Malkowski drängte sich der Expedition geradezu auf, sowie das Vorhaben in der Zeitung herum war, aber Schoeps schätzte ihn nicht.
«Bei Malkowski sieht der Nordpol aus wie die Sahara», sagte er abfällig und vergaß dabei, daß das bei vielen, ja, den meisten Photographen so sein würde. Das gewellte Weiß von Schnee und Sand ähnelte sich gerade auf größere Distanz verflixt, da halfen nur geschickt ins Bild gebrachte Kamele oder Schlittenhunde bei der Zuordnung der Bilder. Es war ein Glück, daß im Lokalanzeiger unversehens Eifersucht entstand. Alle möglichen Leute kamen plötzlich auf den Einfall, bei der Suche Andres unentbehrlich zu sein. Daß manche davon erheblich besser schrieben als Lerner, änderte nicht, daß sie sich durch ihren Eifer gegenseitig blockierten. Schließlich war Chefredakteur Schoeps froh, daß niemand aus der Zeitung mitfuhr, denn Lerner war nicht einmal Redakteur, es war eine Art Sonderauftrag und griff in das Gefüge in Berlin nicht ein, und wenn Lerner sich bewährte, dann konnte man weitersehen. Zusagen für die Zukunft wurden ganz ausdrücklich nicht gemacht.
Als Photographen zauberte Frau Hanhaus einen mürrischen schnurrbärtigen Junggesellen hervor, dessen Bekanntschaft sie gemacht hatte, als sie versuchte, gewisse Sonderposten aus den belgischen Zinngruben im Kongo zu verkaufen. Möllmann, so hieß der Ingenieur, hatte mehrere Jahre im Kongo gelebt und war ohne Vermögen, dafür aber trunksüchtig zurückgekehrt. In Redefluß, und zwar übellaunigen, geriet er nur, wenn er ein paar Flaschen, gleichgültig wovon, geleert hatte. Er vertrug sehr viel. Von Frau Hanhaus hatte er eine Photographie gemacht, die sie in der für sie vorteilhaftesten Haltung, in einem Korbsessel lehnend, zeigte. Er photographierte aus Neigung und besaß eine große Sammlung von Bildern barbusiger kongolesischer Damen, aus der er wohl auch verkaufte. Nie ruhte ein freudloserer Sammlerblick als der seine auf einer solchen Bildfolge. Bei Möllmann glaubte man, daß ihn nur das technische Moment des gesamten Photographiervorganges bewegte. Wenn er mit dem Kopf unter dem schwarzen Tuch verschwand, verließ er die Welt und verbarg sich in einem dunklen Brunnen, den das kreisrunde Tageslichtlein am Ende nur schwach erleuchtete. Auf Bilder, die da entstehen mochten, kam es ihm anscheinend überhaupt nicht an.
«Das Ideale an Möllmann», sagte Frau Hanhaus, nachdem sie ihn mit Lerner in einem Kaffeehaus zusammengebracht hatte – Möllmann mißfiel Lerner auf den ersten Blick, Lerner hingegen war Möllmann, wie gleichfalls zu erkennen war, höchst gleichgültig –, «das Ideale an Möllmann: er ist Bergbauingenieur und kann photographieren. Wir sparen auf der kleinen Helgoland einen ganzen Mann, wenn wir ihn nehmen. Außerdem ist er frei und froh, wenn er ein paar Kröten verdient.» Die würdige Frau Hanhaus überraschte durch den Gebrauch von Jargonausdrücken für Geld, auch Mäuse, Kies und Pusemanke fielen, aber nur für die lästigerweise benötigten Alltagsbeträge, nie für den herrlichen, außerordentlichen Gewinn, der am Ende allen Wirkens stand. Daß Möllmann durch irgend etwas froh zu machen sei, war unwahrscheinlich. Lerner vermutete, daß es der dichte, über die Oberlippe hängende Schnurrbart war, der schwammartig allen Freudenüberfluß vor Möllmanns Nase aufsaugte. In diesem übermäßig genährten Bart hing nicht nur der Morgenkaffee, sondern wohl auch vieles von den Eindrücken, die nicht in Möllmanns Geist gelangten.
Nun aber der Kapitän, der wichtigste Mann, dessen man sich sicher sein mußte, wenn das Abweichen von den dünnen Spuren des Ingenieurs André ohne Friktionen verlaufen sollte. Da hatte Frau Hanhaus einen Herrn in petto, der in allem das Gegenteil Möllmanns war. Korvettenkapitän a.D. Hugo Rüdiger hatte keinen Schnurrbart, sondern einen zweizipfligen Vollbart, der gleichsam ein großes W formte, das Monogramm des Kaisers, die Krone darüber bildete Rüdigers ausdrucksvolles, niemals unbewegtes Gesicht. Wo Möllmann schwieg, sprach Rüdiger. Wo Möllmann stumpf war, war Rüdiger reizbar. Und diese Reizbarkeit war es, die ihn um seine Korvette und seinen soldatischen Beruf gebracht hatte, obwohl er mit allen Fasern daran hing. Das tat einen Schrei in seinem ganzen Leib, als er von diesem Beruf getrennt wurde, wie man beim Zerreißen von Seide vom «Seidenschrei» spricht. Wie aber war ein Mann, dessen Reizbarkeit seinem Lebensglück das Bein gestellt hatte, überhaupt die steile Offiziersleiter hinaufgeklettert? Auf deren unteren Stufen sind Wutausbrüche, Jähzornsanfälle, Haßtiraden, cholerische Zustände und ähnliche Entrücktheiten dem Fortkommen keineswegs förderlich, vielmehr werden Selbstverleugnung, Schweigen, Disziplin, klagloses Hinnehmen von Ungerechtigkeiten als Standestugenden erwartet. Die schrankenlose Beredsamkeit und die zu Heftigkeit führende Überempfindlichkeit hatten sich bei Kapitän Rüdiger denn auch erst spät entwickelt, zunächst nur im Häuslichen, bis Frau Korvettenkapitän Rüdiger die gemeinsame Wohnung verließ und in ihr Elternhaus zurückkehrte, daraufhin aber ganz entschieden und kraftvoll auch im Dienst. Es gab Stimmen, die behaupteten, Korvettenkapitän Rüdiger sei verrückt geworden. Das Kommando auf der Helgoland nahm er an, als sei sie das Flaggschiff der Kaiserlichen Flotte. Das Vorhaben, das Frau Hanhaus ihm behutsam entschleierte, erregte ihn, obwohl er hier seltsam verschwiegen blieb. Lerner war für ihn keine ernstzunehmende Größe. Kapitän Rüdiger hingegen weckte in Lerner die Erinnerung an die Angst, die ihm als Knabe der Nikolaus eingejagt hatte.
5 Spiele beim Warten
Das Geschäft des Kaufmanns ist das Warten. Wir werden fürs Warten bezahlt. Kaufleute sind Angler», sagte Frau Hanhaus in den bangen Tagen des Wartens, in denen alles dem Aufbruch entgegenfieberte, die Helgoland aber immer noch auf dem Trockendock lag. Das Schiff sei doch hinfälliger als zunächst vermutet, hörte man. Kapitän Rüdiger hielt jedenfalls für erforderlich, was da in größter Hast noch täglich zusammengezimmert, geschraubt und lackiert wurde. Trotz ihrer Gelassenheit äußerte Frau Hanhaus auch Ungeduld, hinter der vorgehaltenen Hand natürlich. «Die Herrschaften tun so, als wollten wir im Eismeer überwintern.» Daß man das keinesfalls vorhatte, durfte aber nicht herausposaunt werden. Dennoch begann sie in der «Verpuppungsphase», wie sie sagte, Financiers aufmerksam zu machen, als ob ihre Hand schon auf der Bären-Insel liege. Wenn sie Bilanz machte, sah die Lage des Bären-Insel-Unternehmens, das sich soeben formte, glänzend aus. Diesen Eindruck faßte sie in Worte, die Lerners Phantasie beflügelten. «Es ist so viel dummes Geld in der Welt, man muß sich nur bücken, um es aufzuheben.» Dummes Geld – das war eine wundervolle Vorstellung. Lerner dachte an langsame und wehrlose Schweine bei diesem «dummen Geld». Man trieb sie mit einer Gerte zusammen. Zartrosa und schüchtern ließen sie alles mit sich machen. Sein Entzücken ließ ihn vergessen, wie sehr er sich gerade über Frau Hanhaus geärgert hatte. Es lag nahe, daß er ihr vom Vetter Valentin Neukirch erzählte, seiner «Prahlverwandtschaft», wie die Brüder Lerner diesen Mann nannten, der Bergwerksdirektor in Zwickau war. Für die Fragen, die sich bei der Kohleförderung auf der Bären-Insel ergaben, war Vetter Neukirchs Rat gewiß unschätzbar. Es war aber auch möglich, daß er sich geschäftlich für das Unternehmen engagierte, wenn er ihm Chancen gab. Lerner aber durfte sich seinem Vetter nur mit soliden Fakten nähern, nicht mit Plänen. Ein Plan von Vetter Theodor war für Vetter Neukirch ein rotes Tuch. Und tatsächlich hatte der Vetter bei der bloßen Nennung von Theodor Lerners Namen giftige Bemerkungen gemacht, als Frau Hanhaus, ohne ihrem Compagnon ein Wort zu sagen, in Zwickau anrief. Ihr Anruf bei Vetter Neukirch war eine Warnung. Solche Aktionen waren kein böser Wille bei ihr. Ihr Kopf war so voller Pläne, daß es nie genügend Realisatoren geben konnte. Wenn sie einen fand, wollte sie ihm möglichst viel von dem, was ihr durch den Kopf ging, aufladen. Hätten die Leute mit Geld ein gewisses Ingenium besessen, dann wäre ihnen auch Frau Hanhausens Geist aufgegangen. Sie