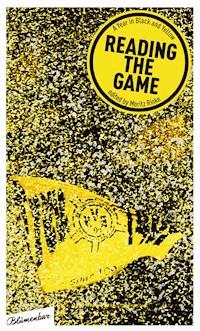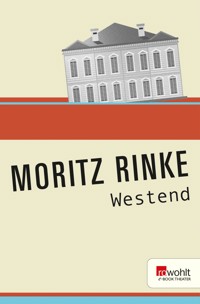
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Eduard und Michael haben gemeinsam Medizin studiert und nebenbei in einer Band gespielt, den Rolling Docs, bis sich die Wege trennten. Eduard operiert als Schönheitschirurg im Krisengebiet der westlichen Seele und entfernt die Angst, alt und wertlos zu sein. Michael arbeitet für eine humanitäre Organisation und kommt eben aus Afghanistan zurück; was er mitbringt, sind Geschichten von Gewalt und sinnlosem Sterben. Welten prallen aufeinander, als sich Eduard und Michael nach Jahren wiedersehen – nicht nur politisch, sondern auch privat. Denn Eduard hat mittlerweile Charlotte geheiratet, die davor mit Michael zusammen war. Erneut ist Charlotte zwischen den grundverschiedenen Männern hin- und hergerissen. So komfortabel ihr Leben in dem Haus ist, das sie und Eduard sich gerade gekauft haben, so unerfüllt und vor allem kinderlos ist es geblieben. Zugleich stagniert ihre Karriere als Sängerin, obwohl sie demnächst in Haydns Die Schöpfung ein Comeback feiern soll. Und dann ist da noch Lilly, die junge Nachbarin, ebenfalls Medizinstudentin, in deren unbefangene Direktheit sich wiederum Eduard verliebt, sodass die alte Ordnung endgültig zu zerfallen droht. Auf der Folie von Goethes "Die Wahlverwandtschaften" erzählt Moritz Rinke von einer untergehenden Welt: von Burgen der Bürgerlichkeit, die brüchig geworden sind; von Menschen, deren Biographien und Körper vernarbt sind vom Krieg oder vom Erfolgsdruck. Westend ist wahrscheinlich Moritz Rinkes bisher reifstes Stück und ganz sicher sein schonungslosestes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 106
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Moritz Rinke
Westend
Über dieses Buch
Eduard und Michael haben gemeinsam Medizin studiert und nebenbei in einer Band gespielt, den Rolling Docs, bis sich die Wege trennten. Eduard operiert als Schönheitschirurg im Krisengebiet der westlichen Seele und entfernt die Angst, alt und wertlos zu sein. Michael arbeitet für eine humanitäre Organisation und kommt eben aus Afghanistan zurück; was er mitbringt, sind Geschichten von Gewalt und sinnlosem Sterben. Welten prallen aufeinander, als sich Eduard und Michael nach Jahren wiedersehen – nicht nur politisch, sondern auch privat. Denn Eduard hat mittlerweile Charlotte geheiratet, die davor mit Michael zusammen war. Erneut ist Charlotte zwischen den grundverschiedenen Männern hin- und hergerissen. So komfortabel ihr Leben in dem Haus ist, das sie und Eduard sich gerade gekauft haben, so unerfüllt und vor allem kinderlos ist es geblieben. Zugleich stagniert ihre Karriere als Sängerin, obwohl sie demnächst in Haydns «Die Schöpfung» ein Comeback feiern soll. Und dann ist da noch Lilly, die junge Nachbarin, ebenfalls Medizinstudentin, in deren unbefangene Direktheit sich wiederum Eduard verliebt, sodass die alte Ordnung endgültig zu zerfallen droht.
Auf der Folie von Goethes «Die Wahlverwandtschaften» erzählt Moritz Rinke von einer untergehenden Welt: von Burgen der Bürgerlichkeit, die brüchig geworden sind; von Menschen, deren Biographien und Körper vernarbt sind vom Krieg oder vom Erfolgsdruck. «Westend» ist wahrscheinlich Moritz Rinkes bisher reifstes Stück und ganz sicher sein schonungslosestes.
Vita
Moritz Rinke, geboren 1967 in Worpswede, studierte Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen. Gleichzeitig schrieb er Kolumnen und Reportagen. Von 1994 bis 1996 arbeitete er beim Berliner Tagesspiegel. Für seine Reportagen erhielt er zweimal den renommierten Axel-Springer-Preis. 1995 debütierte er als Dramatiker mit «Der graue Engel». «Republik Vineta» wurde in der Kritikerumfrage der Zeitschrift Theater heute zum besten deutschsprachigen Stück der Spielzeit 2000/01 gewählt und 2001 für den Mülheimer Dramatikerpreis nominiert, ebenso wie «Die Optimisten» (2004), «Café Umberto» (2006) und «Wir lieben und wissen nichts» (2013). 2010 erschien sein vielgelobter Roman «Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel», der wochenlang auf der Bestsellerliste stand.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Aufführungsrechte: Rowohlt Theater Verlag, Hamburg
Covergestaltung any.way, Walter Hellmann
Coverabbildung iStock
Satz Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-644-00702-4
www.rowohlt-theater.de
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Personen
EDUARD
CHARLOTTE
LILLY
MICHAEL
MAREK
ELEONORA
Well I said
«Lily, Oh Lily I don’t feel safe
I feel that life has blown a great big hole through me»
And she said
«Child, you must protect yourself
You can protect yourself
I’ll show you how with fire»
Gabriel before me
Raphael behind me
Michael to my right
Uriel on my left side
In the circle of fire
I said
«Lily, Oh Lily I’m so afraid
I fear I am walking in the Veil of Darkness»
And she said
«Child, take what I say
With a pinch of salt
And protect yourself with fire»
Gabriel before me
Raphael behind me
Michael to my right
Uriel on my left side
In the circle of fire
Kate Bush,Lily
Eins
Ein großer, leerer Raum, salonhaft, renovierungsbedürftig, keine Möbel, nur ein Stuhl. Ein paar großformatige Bilder, alle an die Wände gelehnt. Hinten eine große Glastür nach draußen, sodass zwei Räume entstehen, die fast ineinander übergehen: der «Salon» und dahinter die Terrasse. Insgesamt: Leicht morbide Eleganz. Musik: Haydn, «Die Schöpfung – erster Tag». Eduard, mit einem Vorschlaghammer, stellt sich vor eine Wand, doch offenbar halten ihn die Bläser und Streicher der «Schöpfung» ab, die Wand einzuschlagen. Charlotte von draußen mit Wiesenblumen.
EDUARD
Soll ich?
CHARLOTTE
Moment …
EDUARD
Ohne diese Wand wäre es hier noch größer, eindrucksvoller …
CHARLOTTE
Das könnte eine tragende Wand sein, ich würde erst einen Statiker fragen, der sich damit auskennt.
EDUARD
Kann ich das etwas leiser machen?
CHARLOTTE
Bitte …
EDUARD
Stell dir mal vor, die Empfänge, die wir hier geben … Abendsonne durch die offene Tür, im Garten Fackeln, richtiges Feuer, es gibt Oliven und Grauburgunder, tout Berlin … Hast du gesehen, hier kommt jetzt wieder Licht durch! Offenbar haben unsere Vorgänger zehn Jahre das Fenster nicht aufgemacht, die Läden davor waren schon gar nicht mehr zu bewegen, ich habe so lange mit dem Hammer draufgehauen, bis sie abgefallen sind.
CHARLOTTE
Ich habe Blumen vom Feld mitgebracht …
EDUARD
Ich liebe diesen Raum. Hier und da noch ein paar Eingriffe, und wir wohnen in einem Schloss!
CHARLOTTE
Wenn ich durch den Garten laufe, sehe ich immer das Kind an meiner Hand, das ich nicht habe.
Kurzes Schweigen.
EDUARD
Ein Garten an sich ist auch schön.
CHARLOTTE
Schau dir diese Blumen an. Man muss nur an den Nachbarn vorbei, dahinter kommt schon dieses riesige Feld … Es ist mir ein Rätsel, wie ich mein ganzes Leben in der Stadt leben konnte, lass bitte dein tout Berlin da, wo es ist. – Ist das Gelbstern oder Wolfsmilch?
EDUARD
Waren sie da?
CHARLOTTE
Wer?
EDUARD
Die Nachbarn. Hast du was gesehen?
CHARLOTTE
Eleonora. Sie liegt in der Sonne.
EDUARD
Ah, Eleonora …
CHARLOTTE
Kriegt die eigentlich Mengenrabatt? Erst waren es die Augenlider, danach die Lippen, korrigier mich, wenn ich falschliege. Und jetzt seid ihr offenbar schon bei den Brüsten angekommen.
EDUARD
Charlotte, ohne sie hätten wir ein Haus in dieser Lage nie gefunden, das war ein Jahrhunderttipp, da müsste ich ihr aus Dankbarkeit im Prinzip alles operieren. Über die Brüste haben wir nicht gesprochen, da ist nichts gemacht.
CHARLOTTE
Da muss man auch nichts machen, das reicht schon, finde ich.
Kurzes Schweigen.
EDUARD
Aber deiner Stimme geht’s schon viel besser. Ist das die Schöpfung?
CHARLOTTE
Ja, erster Tag. Und ihre Tochter?
EDUARD
Unterhaltsam.
CHARLOTTE
Unterhaltsam? Sie hat kein Wort gesagt. Sie hat sich den ganzen Abend gelangweilt.
EDUARD
Das ist außerdem nicht ihre, sondern seine Tochter.
CHARLOTTE
Bezaubernde Erscheinung. Schade, dass sie nicht meine Tochter ist.
EDUARD
Käme das hin? Ist das jetzt deine Rolle, das ist doch Eva?
CHARLOTTE
Nein, das ist der Erzengel Gabriel. Sie ist dir hinterhergerannt.
EDUARD
Sie studiert Medizin, an einer Privatuniversität in Salzburg, das muss ein Vermögen kosten. Wann kommt denn Eva?
CHARLOTTE
Am sechsten Tag natürlich, im Garten Eden, bei Haydn ungefähr in der Mitte. Wie findest du ihn?
EDUARD
Nett. Amüsant. Etwas überheblich. Und du?
CHARLOTTE
Großartig. Marek Fenrich, wie das schon klingt. Ihr seid euch ähnlich.
EDUARD
Aha. Aber Eleonora ist höchstens zehn Jahre älter als seine Tochter.
CHARLOTTE
Das kann man bei einer Frau, an der du herumgemacht hast, leider nicht mehr erkennen.
EDUARD
Ich mache nicht an Frauen herum, ich operiere. Ich operiere Frauen und Männer.
CHARLOTTE
Du entstellst sie, du entstellst Menschen. Woher weißt du, dass sie Medizin studiert?
EDUARD
Ich entstelle keine Menschen! Würdest du mit jemandem zusammenleben wollen, der Menschen entstellt? Ich helfe ihnen, dass sie sich danach wieder gerne selbst ansehen.
CHARLOTTE
Dann schauen sie sich eben gern ihre Entstellung an. Niemand interessiert mehr, wer er wirklich ist …
EDUARD
Wer weiß denn schon, wer er wirklich ist? Es gibt Menschen, die bekommen Depressionen, wenn sie in den Spiegel schauen und etwas sehen, was nicht mehr in ihr Weltbild passt. Da draußen gibt es nicht mehr viele, die den Mut haben, würdevoll alt zu werden. Der schlechte Ruf, den wir Chirurgen haben, ist ungerecht. Was meinst du, wie viele Wohlstandsoperationen es gibt? Raucherbeine, Leberschäden, Bandscheiben, kranke Herzen, das wird ja auch alles operiert, und ich operiere eben die Angst, alt und nicht mehr jung und wertvoll zu sein, das ist ein Seelenschaden. – Ich bin Eleonora sehr dankbar, er selbst wäre nie auf die Idee gekommen, dass uns das Haus hier interessieren könnte. Bei ihm habe ich übrigens auch was gemacht. Haare. Das Übliche bei Männern. Und eine seiner früheren Freundinnen war bei mir. Veronika.
CHARLOTTE
An mich lass ich dich erst heran, wenn ich neunzig bin.
EDUARD
Danach siehst du aus wie sechzig, das ist mir aber zu alt … Das war ein Witz, mein Schatz. Ich bin glücklich, dass du so lange mit mir … Neunzig, hast du gesagt? Da bin ich fast hundert!
CHARLOTTE
Ich glaube, das ist Hahnenfuß. Schöllkraut oder Hahnenfuß, hier für dich, schenk ich dir, heute ist übrigens mein Geburtstag.
EDUARD
Um Gottes willen!
CHARLOTTE
Ja, wieder ein Jahr älter …
EDUARD
Charlotte! Oh nein, in der Nacht hatte ich noch dran gedacht und wollte dich schon wecken … Herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch, komm … (Küsst sie) Wie stehe ich jetzt da? … Ich hole auch Blumen!
CHARLOTTE
Nein, nein, nicht nötig … Ich geb sie dir, und du gibst sie dann wieder mir. Erst mal den Hammer bitte. Der ist ja riesig, wo hast du den her?
EDUARD
Aus dem Keller. Als ich den sah, hatte ich plötzlich Lust, die Wand wegzuhauen.
Sie tauschen die Blumen hin und her.
EDUARD
Also noch mal: Herzlichen Glückwunsch, du Königin in diesem Schloss!
CHARLOTTE
Danke.
EDUARD
Vielleicht war ich auch etwas abgelenkt, wegen Mick.
CHARLOTTE
– Mick?
EDUARD
Ja, Michael kommt, das wollte ich dir schon die ganze Zeit sagen. Ich fahre gleich zum Bahnhof.
CHARLOTTE
–
EDUARD
Er wird ein Weilchen bei uns wohnen, für einen Dritten ist ja noch Platz … Mensch, dieser Raum hier! Der wird das Herzstück von allem, ich sehe dich schon als Königin im Paradezimmer, so nannte man das. Paradezimmer, Herkulessaal, Kriegssalon, Spiegelgalerie, von da ging’s direkt zum Schlafzimmer des Sonnenkönigs – französischer Barock, ich finde, wir bauen das hier quasi nach … Ist alles in Ordnung? Mick hat mich angerufen, er weiß nicht mehr, wo er hin soll, seitdem er aus Afghanistan zurück ist … Zu meiner Schwester kann er nicht, da reden nur noch die Anwälte, offenbar hat er sie jahrelang betrogen, ich weiß noch, früher, sogar auf einer Truppenübung in Eckernförde, im Tiefwasserhafen, der findet überall irgendeine Geschichte, egal, ob in Eckernförde oder Afghanistan …
CHARLOTTE
Ich wusste nicht mal, dass er in Afghanistan war. Er war in Afrika, das verwechselst du.
EDUARD
Er war nach Afrika Hauptmann des Ärztetrupps in Afghanistan oder so was Ähnliches …
CHARLOTTE
Das höre ich zum ersten Mal. Du hast nie mehr von ihm gesprochen seit Afrika, und jetzt holst du ihn vom Bahnhof ab?
EDUARD
Mein Gott, was hätte ich ihm denn sagen sollen?
CHARLOTTE
Wir haben nicht mal genug Bettwäsche …
EDUARD
Das kriegen wir hin … Wir könnten wieder Musik machen, wie früher … Ich bin wirklich davon überzeugt: Wenn wir da alle drangeblieben wären, dann wären wir heute … Ich meine, du bist natürlich fantastisch, aber ich habe damals eher groß geträumt, ganz groß.
CHARLOTTE
Ihr wart eine Studentenband, Eduard, du übertreibst, wie immer, ganz groß.
EDUARD
Ich übertreibe nicht, ich schwärme, das ist ein Unterschied, das verwechselst du immer. Die Rolling Stones haben sich als Schüler am Bahnsteig kennengelernt, weil Mick Jagger Platten von Chuck Berry unterm Arm trug.
CHARLOTTE
Kannst du Michael noch absagen?
EDUARD
Absagen, wie denn? Der steht bestimmt schon am Bahnsteig. Wenn das mal kein Zeichen ist … Ich fand uns jedenfalls großartig. Am Anfang muss man nur Träume haben. Wenn wir die Umzugskisten schon hier hätten, würde ich mit einer Platte von Chuck Berry zum Bahnhof fahren, so unter den Arm klemmen, fehlt nur noch der Gang von Mick Jagger …
CHARLOTTE
Ruf Michael an, dass er wieder zurückfahren muss, das ist nicht der richtige Zeitpunkt … jetzt, da wir hier neu anfangen, ich habe auch schon mit diesem Therapeuten gesprochen, Dr. Mittler, der macht das mit uns zusammen …
EDUARD
Ich denke, du magst Mick. Ich dachte, wir feiern zusammen Geburtstag …
CHARLOTTE
Du wusstest ja bis eben nicht mal, dass ich Geburtstag habe.
EDUARD
In der Nacht wusste ich es! Außerdem, Mick liebt es zu helfen, der kam in unsere WG und hat die erst mal komplett umgebaut zur Begrüßung. Während ich mich in den Lernatlas der Anatomie vertiefte, wurde um meinen Stuhl herum alles vollsaniert. Mick kommt aus einer Handwerkerfamilie.
CHARLOTTE
Weiß ich alles.
EDUARD
Der ist wahrscheinlich der erste Chirurg der Welt, der auch fliesen kann. Morgen kommen die Möbel aus der Bleibtreustraße, da brauche ich sowieso einen zweiten Mann. Und das Geld, das wir mit ihm sparen, stecke ich in die Praxis. Ich möchte sie in einem beruhigenden und dennoch lebendigen Ton streichen. Wie findest du lindgrün?
CHARLOTTE
Ist mir gerade echt egal …