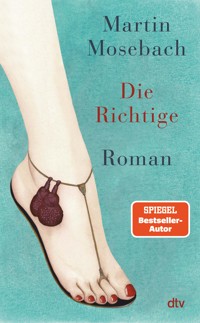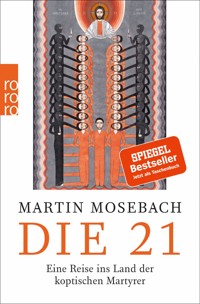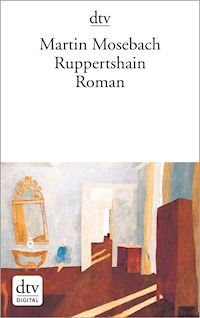9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Meisterhafte Momentaufnahmen: Martin Mosebachs frühe Erzählungen über Erinnerung, Sehnsucht und die Macht des Schicksals In Stilleben mit wildem Tier entführt der Büchner-Preisträger Martin Mosebach den Leser in eine Welt subtiler Überraschungen und eindringlicher Erinnerungen. Seine frühen Erzählungen verbinden auf kunstvolle Weise ein Italien der Phantasie mit Bildern der jüngeren deutschen Vergangenheit. Beunruhigende, komische und tragische Gestalten bevölkern die Seiten dieses Bandes und formen eine faszinierende Kette menschlicher Schicksale. Mosebachs Erzählungen zeichnen sich durch eine unverwechselbare Liebe zum Detail und eine sinnliche Sprache aus, die jeden Schauplatz in seiner Eigenart und Farbe lebendig werden lässt. Von den Straßen Roms bis zu den Gassen Neapels entsteht ein facettenreiches Panorama, das den Leser in seinen Bann zieht. Mit federleichter Virtuosität schafft Mosebach eine Literatur voller Weisheit, Witz und Tiefgang, die lange nachhallt. Ein Meisterwerk der deutschen Gegenwartsliteratur, das Erinnerung, Sehnsucht und die Macht des Schicksals auf einzigartige Weise erkundet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Martin Mosebach
Stilleben mit wildem Tier
Erzählungen
Über dieses Buch
Die wegweisenden frühen Erzählungen des Büchner-Preisträgers Martin Mosebach.
Martin Mosebachs frühe Erzählungen stecken voller subtiler Überraschungen; ihr Motiv ist die Erinnerung. Ein Italien der Phantasie mischt sich mit Bildern jüngerer deutscher Vergangenheit; beunruhigende, komische und tragische Gestalten reichen sich auf den Seiten dieses Bandes die Hände zu einer langen Kette. Martin Mosebach schreibt voller Liebe zum Detail, voller Sinnlichkeit, die jeden Schauplatz in seiner Eigenart und Farbe abbildet. Federleicht-virtuose Literatur voller Weisheit und Witz.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Oktober 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Die Originalausgabe erschien 2001 im Bloomsbury Verlag, Berlin.
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
Umschlagabbildung Unitedt Archives/De Agostini/Süddeutsche Zeitung Photo
ISBN 978-3-644-40443-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Sein Zimmer
Ich sehe Zimmer vor mir, große helle Zimmer, kleine dunkle, dunkle große, kleine helle, schmale dämmrige, niedrige freundliche, alte hohe, neue quadratische Zimmer, lauter Zimmer, in denen ich gewesen bin, Zimmer, die ich erfunden habe, fotografierte Zimmer, und die Zimmer, die ich bewohnen werde.
Überall ist es das Licht, das meine Zimmer unvergeßlich macht; ich bin ein großer Künstler und öffne dem Licht in den Mauern die richtigen Schleusen, durch die es einfließen kann, um den Raum je nach meinem Willen ganz zu füllen, oder nur ein wenig schimmernd zu erhellen, oder ihn mit gelben Flecken zu sprenkeln.
Meine Phantasie beim Ersinnen von Kunstgriffen, das Licht zu lenken, hat kein Ende.
Ich habe zum Beispiel Zimmer, die von allen Himmelsrichtungen ihr Licht empfangen, ringsum von Fenstern umgebene Turmzimmer etwa: Da liefern sich die Lichter eine Schlacht, sie stürzen aufeinander, sie verbeißen sich im Kampf und fallen dann erschöpft im Kreis auf den Boden. Meine Wächter lieben diese Art von Zimmern, das Lichtertoben hält sie wach und hindert sie am Schlaf.
Es gibt bei mir aber auch die entgegengesetzte Art von Zimmern: sie empfängt ihr Licht aus einer einzigen Quelle, einem Fenster nämlich, das sich zu einer bestimmten Himmelsrichtung öffnet; da hat alles einen Charakter, der ganz von der Eigentümlichkeit des gerade für diese Himmelsrichtung bezeichnenden Lichts regiert wird. Im weißen Nordlicht sehen meine Hunde und Katzen wie Standbilder ihrer selbst aus. Das graue Ostlicht macht meine Rosen zu Friedhofsblumen. Das Südlicht blendet mich. Ich sperre es aus mit Fensterläden und Jalousien, aber es dringt durch die Ritzen und hackt meinen Teppich in kleine goldene Stücke. Das Westlicht färbt meine Wangen rot, wenn ich am späten Nachmittag einer Dame ein Geständnis mache. Da haben Sie die Hauptlichter.
Ahnen Sie die Varietäten, die sich bei gemischten Himmelsrichtungen, mehreren Fenstern in verschiedenen Richtungen, Fenstern in entgegengesetzten Richtungen ergeben?
In manche meiner Zimmer fällt nie ein Sonnenstrahl.
Sind hinter ihren immer geschlossenen Vorhängen wirklich Fenster verborgen? Fast meint man, sich diesen Gedanken verbieten zu müssen: Die Existenz von Fenstern käme einer Revolution für die Verhältnisse in diesen Zimmern gleich. Die feierliche Harmonie ihrer sich kreuzenden Schlagschatten würde von jedem anderen Licht, als dem der sorgfältig plazierten gläsernen Lampen zerstört; läßt man sie aber heil und schützt sie vor dem plärrenden Licht eines Sommertages oder der sentimentalen Bleichsucht des Vollmondes, so entfaltet sich die beruhigende Kraft der innersten Kammer einer Pyramide.
In der Nacht beginnen sich meine Zimmer wieder zu gleichen und nur die, die feine Nerven haben, können auch in der Dunkelheit noch ahnen, wie hoch die Zimmerdecke über ihnen schwebt und ob ihr Atem sich in Wandverkleidungen fängt oder ob er auf eine nackte Mauer schlägt. Ich kenne aber das Erschrecken, das uns erfaßt, wenn wir allein in einem dunklen Zimmer zu sein glauben und auf einmal die schleppenden unbeirrbaren Atemzüge eines in ihm schlafenden Menschen vernehmen. Das Zimmer, dessen Eigenheiten nicht wahrzunehmen sind, gewinnt plötzlich durch den träumenden Schläfer ein Herz und fängt an zu leben – ein gesichtsloses Leben, wie in den ersten Tagen der Erde oder in unseren Kinderängsten, die uns die nie gesehenen Ungeheuer aus den Höhlen vor Augen stellten.
Meine Zimmer sind meine Haut. Ich habe tausend Häute und fürchte manchmal, daß ich noch niemals in einem Zimmer gewesen bin.
In einem Zimmer vielleicht, das im 3. Stock eines alten Mietshauses liegt.
Man öffnet seine Türe, tritt ein und sieht sich um. Dabei stellt man fest, daß die Türe am Rand des Zimmers liegt, in seiner äußersten Peripherie, sie versucht, so wenig da zu sein, wie nur möglich, man hat sie dort hingesetzt, damit sie möglichst wenig Platz wegnimmt, jetzt steht sie folgsam in der Ecke und hält ihre Kassettenfüllungen so eng zusammen wie eine Frau ihren Rock beim Durchwaten eines Baches. Es ist offensichtlich, daß mit dieser Tür niemand eine besondere architektonische Wirkung erzielen wollte, sie ist die ordentliche Tür zu einem Mansardenzimmer und sonst nichts. Sie steht im Schatten. Selten nur trifft sie das Licht, das in diesem Zimmer herrscht. Das Licht kommt von draußen herein, durch ein großes Fenster, das in drei schmale Flügel gegliedert ist. Morgens wirft die Sonne einige rote Strahlen auf die Wand neben dem Fenster, sie wandern mit dem sich vollendenden Vormittag langsam nach oben und verschwinden im Winter um zehn Uhr, im Sommer um halb neun. Dann bleibt das Licht den ganzen Tag über gleichmäßig hell am Fenster, in den Tiefen des Zimmers schattiger und unscharf. Wenn sich der Himmel bezieht und graue Wolken auf die Blätterwand vor dem Fenster drücken, nimmt die Atmosphäre des Zimmers einen wäßrigen, grünen Ton an, sein Bewohner schwimmt dann in ihm wie in einem lichtlosen Aquarium, seine Bewegungen stehen unter der Hemmung des Wasserdrucks, die ihm jedoch zugleich ermöglichen müßte, sich mit den Füßen von dem schokoladenfarbenen Fußboden abzustoßen und der weißen Decke entgegenzutreiben, sich wieder sinken zu lassen und wie ein Karpfen die Nase den verglasten Bildern zu nähern, um sie aus einem neuen überraschenden Winkel verständnislos zu betrachten. Abends färben sich die Gegenstände des Zimmers blau und schwarz, wie es die Dämmerung immer macht, und doch berührt es seltsam, daß das Himmelslicht draußen merkwürdig lange weiß leuchtet, ohne die schwarzen Bestandteile des Zimmers erhellen zu können, so als ob nach einer bestimmten Stunde die Fensterscheiben sich weigerten, die Lichtstrahlen durch sie hindurch fallen zu lassen und nur noch bereit wären, dem Betrachter das Abendlicht wie in einer Vitrine zu präsentieren. Man kann sich dann den Bewohner vorstellen, wie er an seinem Schreibtisch, der vor dem Fenster steht, Platz genommen hat, vielleicht schon vor Stunden, und das langsame Schwinden des Lichtes verfolgt. Er versucht, sich im Sommer an den Winter zu erinnern, wenn die Äste kahl vor seinen Augen wanken und den Blick auf das verschobene Schiefergrau der gegenüberliegenden Dachlandschaft öffnen, aber es gelingt ihm niemals, mit der Kraft seiner Vorstellung die dicken grünen Wolken wegzuschieben, die im Wind wie tausend Federn zittern. Er tröstet sich vermutlich damit, daß er, wenn Gott es will, in wenigen Monaten schon wird wieder sehen dürfen, was ihm seine Phantasie jetzt verweigert. Da Gott ihm seine Hilfe offenbar oft gewährt, schmückt er das Bild seines Herrn mit violetten seidenen Schleifen und silbernen Herzen; wenn er von seinem Kopfkissen seine Augen auf sein kleines schwarzes Kruzifix richtet, das über dem Bett hängt und auf die gegenüberliegenden Fenster sieht, vermag er die Arme des Gekreuzigten unter den glänzenden Bändern nicht mehr zu erkennen. So läßt er sich schützen und so kann er die Augen am Abend in Ruhe schließen. Vor der Kühle der nackten Wand, an der entlang sein Bett aufgestellt worden ist, bewahrt ihn ein Teppich, der aus der Ritze zwischen Bett und Mauer geräuschlos aufsteigt und erst kurz vor der Decke innehält. Er ist alt, und seine zackigen Muster beginnen sich voneinander zu lösen wie eine Briefmarke von der anderen; eine entschiedene Hand hat versucht, den Verfall aufzuhalten und hat unerschrocken geflickt, genäht und auch Teile ergänzt, ohne ihm im Ganzen etwas von seiner Mürbe zu nehmen. Aber die Farben, die geblieben sind, besitzen noch genügend Kräfte, um von ihrer Herkunft zu erzählen: vom braunen Blut der geschlachteten Hammel, vom Indigoblau der Pluderhosen, von den bitteren Säften der Heilpflanzen und vom Sand.
Hat der Schläfer nie die Empfindung, der Teppich verdecke eine Tür, die in andere Räume führt? Wenn ein Windstoß den Teppich trifft, und er schwankt und bebt, dann kann man schon bei Tageslicht den Raum ahnen, den der Teppich wie eine Portiere verbirgt. Wahrscheinlich ist es sehr unaufgeräumt dort, Matratzenlager, leere Flaschen, eine ausgestopfte Schildkröte, Fotografien von nackten Menschen ohne Kopf, Zerrspiegel und altmodische Prothesen: Die Kammer, in der die Requisiten für die Träume aufbewahrt werden; sie sind vom Bett, in dem der Schläfer, von Heiligenbildern umgeben, ruht, mühelos zu erreichen, wenn der Teppich zur Seite gleitet und die notwendigen Gegenstände sich aufmachen, um sich zu formieren und eine Welt zu möblieren, der nur für wenige Sekunden Leben gewährt ist und die doch auch in der hellsten Sonne die Gedanken in der Erinnerung an sie verschleiern kann.
Jetzt ist es Morgen in meinem Zimmer, allerdings so spät, daß die erwähnten goldenen Sonnenstreifen schon verschwunden sind. Draußen sind die Blätter grün und gelb und bewegen sich vorsichtig. Über dem eisernen Bett liegt ein rotes Tuch, das den Augen der Besucher die Bettwäsche verbirgt. Alles ist aufgeräumt und in gutem Zustand; die Pfingstrosen blühen, die Bücher stehen, die Kissen liegen, die Bilder hängen und im Glas ist ein Tropfen weißer Wein. In diesem Zimmer kann man nur weißen Wein trinken, weil roter Wein hier einfach zu schwer funkeln würde, zuviel Gewicht hinzufügen würde, diesem Zimmer, das ohnehin schon zu schwere, zu braune Farben hat und von zu vielen Details, zu vielen Gegenständen bevölkert wird, um nicht den ruhigen Genuß eines reifen alten Bordeaux zu verhindern. Bräunliche, eher vielleicht karamelfarbene Wände, der schon erwähnte schokoladenfarbene Linoleumboden, ein braunes Sofa und dann viel Rot in Kissen, Litzen, Bezügen und Decken, ein bißchen Gold von den Bilderrahmen, zu wenig nach dem Geschmack des Bewohners, er liebt das Gold offenbar, und deshalb begnügt er sich, wie sich der Liebhaber eines fernen Menschen mit dessen Fotografie begnügen muß, statt mit Gold mit der Goldbronze oder dem dünn aufgeriebenen Blattgold oder dem Goldschnitt seiner Gebetbücher. Über das Gold ist ihm viel Widersprüchliches bekannt: Er hat gelesen, daß es «die Sonne der Metalle» ist und andererseits, daß das «Licht herrlicher als das Gold» sei. Für ihn ist das Wichtigste, daß das Gold weich und rot ist, nur dann nähern sich ihm der Gegenstand und sein Name bis zur Deckung. «… hold rollt das Gold zu meinem Sold», verkündet er dann vor dem Schlafengehen, während er sich in seinem Spiegel freundlich betrachtet.
Nachdem die Nacht sich zerstreut hat und die Vögel wie aus einer Kehle zwischen den Blättern sitzend zu zwitschern anheben, erhellt das erste Tageslicht ein Zimmer, das verwüstet und unwirklich daliegt. Der mit rotem blassen Samt bezogene Schreibtischsessel steht mit dem Rücken zum Schreibtisch, auf dem zwischen mannigfachen Papieren, einer Uhr, allerlei Püppchen aus Bronze und Porzellan ein Brotkorb mit einem vertrockneten Stück Weißbrot steht. Auf dem Boden liegen Krümel und zerknäulte Servietten; die grünen Gläser spiegeln die Strahlen der Morgensonne in ihrem Bodensatz aus langsam verdunstendem Weißwein. Über einen Sessel ist eine Hose geworfen, ein Hemd hängt herunter, vor dem Bett, in dem ein Mensch schläft, stehen seine gestickten Pantoffeln. Obwohl nicht viele Dinge von ihrer angestammten Stelle gerückt sind, ist ein Chaos entstanden. Armer Schläfer! Du wirst bald erwachen, mit schwirrendem Kopf, du wirst von frischer Morgenkühle beleuchtet, die Reste deines Festes betrachten; wie die Krümel wirst du deine witzigen Bemerkungen zusammenkehren, die Antworten darauf weggießen wie den schalen Wein, die Situationen aufsammeln und falten wie die Servietten. Dein Badewasser wird gurgeln, dein Zimmer wird nicht mehr so trostlos aussehen, wenn du nicht mehr darin bist, tröste dich und fasse dich, geh’ in das Tauchbad – du wirst den Irritationen solcher Abende auch in Zukunft nicht entgehen können, aber die Morgende sind kürzer als die Abende und es ist schon spät.
«Dieses Zimmer ist ein Alptraum», sagte das junge Mädchen. «Ein Kramladen, vollgestopft mit dem unterschiedlichsten Trödel; kein Stil und keine Linie sind zu erkennen, nur ein Brei aus dunklen staubigen Farben, ein Sammelsurium an schlechten Möbeln der verschiedensten Zeiten und viel zu vielen Bildern, die sich alle gegenseitig totschlagen. Und dann diese Geschmacksunsicherheiten! Diese Devotionalien, dieser süßliche Johannes der Täufer aus Gips, der unsägliche Stoffdruck einer kuhartigen Heiligen Helena! Ich glaube, dieses Zimmer ist sehr schmutzig. Sicher ist hinter diesen Bücherreihen eine dicke, fettige Schicht aus mehlweißem Staub und unter dem Bett die Flocken des Teppichs, der sich langsam auflöst. Es muß mir irgendwie gelingen, mich zu verabschieden, sonst wird meine Stimmung Schaden leiden.»
«Ich weiß nicht, wie man in diesem Zimmer eine einzige Zeile schreiben kann», sagte der Dichter. «Ganz abgesehen davon, daß das alles hier nicht mein Geschmack ist. Ich liebe weiße leere Zimmer mit drei Möbeln, am besten kein Bild. Wenn ich arbeiten soll, dann brauche ich sozusagen optische Ruhe, meine Bilder entwickeln sich erst, wenn sie von keinen anderen Bildern bedroht werden. Wenn ich dieses Stilleben mit seinen gefährlichen dunklen Rosen, seinem Kristall, seinem sämigen, öligen Holz betrachten muß, verstummt meine Phantasie. Bilder verwahrt man mit dem Gesicht zur Wand. Wenn man eines betrachten will, hebt man es hoch und dreht es um. Ein Bild an der Wand ist wie ein ständig auf einen einredender Mensch, der keine Entgegnung zuläßt. Was heißt ‹ein Mensch›. In diesem Zimmer bin ich einer Woge durcheinander schreiender Lebewesen ausgesetzt. Ich halte mir die Augen zu und ergreife die Flucht.»
«Alles, was ich hier sehe, hat eine Bedeutung für mich», sagte die Frau. «Ich bin oft in diesem Zimmer gewesen, es war anfangs leerer als jetzt, dann sind immer mehr Sachen dazugekommen, jede ist für mich eine Erinnerung an irgend etwas. Jetzt hat das Zimmer so viel Schwere, daß ich mir manchmal vorstelle, daß ich ihn selbst gar nicht mehr sehen brauche – die Gegenwart ist so unerhört arm; alles, was sie hat, ist, daß sie eben da ist. Wie anders in seinem Zimmer, da habe ich ihn, wie er früher war, wie er später war, wie er heute ist, und, weil ich ihn kenne und schon ahne, was er verändern wird, wo ihm noch etwas fehlt oder wo ihn etwas stört, wie er morgen sein wird. Ich habe nie darüber nachgedacht, ob dies ein schönes Zimmer ist. Wenn ich aufgefordert würde, bestimmte Gegenstände aus ihm zu beschreiben, dann würde ich wohl scheitern, obwohl ich doch weiß, daß ich alles vor Augen habe: Farben, Formen, Gerüche, aber eben als Akkord und nicht im Detail, wie ich mich gewöhnt habe, ihn zu betrachten.»
Wenn das Zimmer frisch geputzt und noch nicht wieder in Benutzung genommen worden ist, sieht es aus wie ein Indiz: Die Stühle bezeugen, daß jemand einmal auf ihnen gesessen hat, das Sofa beweist, daß einmal einer auf ihm gelegen hat, der Schreibtisch belegt, daß einmal einer etwas auf ihm geschrieben hat. Es ist der Zustand des Zimmers, der sich für eine Polizeifotografie eignete. Daß der, der hier gesessen, gelegen, geschrieben hat, schuldig war, ist offensichtlich. Seine Sünden sind zahlreich: Wie oft hat er, wenn er den Telefonhörer abnahm, «ja» gesagt, wenn er «nein» meinte, wie oft hat er aus diesen grünen Gläsern fremden Wein getrunken, wie häufig hat er diejenigen, denen er Liebeserklärungen abgab, auf diesem Sofa mit seinen Tagträumen betrogen! Dann hatte er das Gefühl, auf jedem Sessel in seinem Zimmer sitze eine hochfahrende, kostbare Person, von verdorbenem, funkelndem Geist und fabelhaftem Reichtum – die Bemerkungen flogen hin und her, so schnell, daß sie kaum hörbar waren, es waren eigentlich immer Schlußworte, die einen mondän-resignierten Aufbruch ankündigen sollten. Aber keiner ging; die Gäste blieben immer so lange, bis das Telefon klingelte.
Wieviel Uhr ist es jetzt? Ich feiere die Niemandszeit. Mein Zimmer liegt auf einem Schiff, ich treibe in ihm über das grüne Meer, dessen tausend kleine Wellen in mein Fenster sehen. Die Passagiere sind eine kleine italienische Blumenverkäuferin, ein kleiner Merkur mit Flügelschuhen, zwei rote Putten mit leichten Anzeichen der Seekrankheit, ein kleiner Soldat mit dem goldenen N zu Füßen, ein Löwe, der Heilige Johannes der Täufer als Knabe, ein kleiner Fischer, der Papst, ich selbst mit einem Lorbeerkranz gekrönt, als Ölbild, diverse Stilleben, eine Geige. Ich glaube, daß es keine gute Geige ist, und sage zu jedem, der mich nach dem Wert des Instruments fragt, in unbestimmtem Ton: «Das ist eine französische Geige.»
Wenn ich meine Koffer packe, wird alles, was nicht in die Koffer hinein soll, überflüssig. Es ist nicht mehr aufgestellt, sondern es steht herum. Keinen einzigen von den Kunstbänden auf der Kommode werde ich mitnehmen, auch die Kommode selbst nicht, so vieles andere auch nicht. Dafür einige Etuis, Schachteln und Dosen und meinen Morgenrock. Was noch nicht eingepackt ist, verbreitet die verheißungsvolle Unordnung des Hotelzimmers, ich stehe am Beginn eines Romans, diese Abreise ist der Bestandteil der Exposition, weil in ihr noch die Empfindung und die Handlung zusammenfallen. Weil es ein sehr komplizierter Roman ist, wird das später anders sein, die Wirkung wird später gerade in dem Auseinanderfallen des Äußeren und des Inneren bestehen, aber jetzt ist alles noch eine Einheit, eine Einheit von einer Kraft, die mich die kommenden Verwicklungen überstehen lassen wird.
Ich werde also nicht untergehen, weil ich einmal unter einer roten Decke geschlafen habe, gegen die Kälte von einem Teppich geschützt, gegen den schlechten Schlaf von den violetten Schleifen des schwarzen Kruzifixes. Das hat mich sehr erfrischt, ebenso der schwarze Kaffee am Morgen, auch der Weißwein am Mittag, aus grünen Gläsern genossen.
Am Schreibtisch war es immer schön, ich habe die gelben Papiere mit Zeichen bedeckt, viel Material verbraucht und mir im Winter den Sommer, im Sommer den Winter vorgestellt.
Wer niemals ein Zimmer bewohnt hat, wird mein Glück schwerlich ermessen können. Nicht jedes Zimmer verschafft einem solche Erlebnisse; man muß suchen und darf nicht mit dem ersten Besten zufrieden sein. Ich habe gesucht und gefunden, ein Zimmer, das ich nie verlassen werde.
Dieses Zimmer im dritten Stock eines alten Mietshauses liegt auf der Spitze des Eiffelturms. Es zittert sanft, wenn sich die großen Fahrstühle in Bewegung setzen; im Sommer höre ich die Stimmen der Besucher auf den unteren Terrassen, aber im Winter, wenn die Bäume ihr Laub verlieren, habe ich einen wundervollen Blick.
Die Prinzessin Belgioioso in Rom
In der «Goldenen Traube» wird ein guter einfacher Wein ausgeschenkt, aber nicht jedem, der davon haben will. Neben den Tischen, auf denen die großen gefüllten Karaffen stehen, gibt es die, auf denen sich nur die Aschenbecher füllen und die Menschen, die an ihnen sitzen, vom Kellner so wenig beachtet werden wie die Katzen. So lagern sie sich denn auch zwischen die fröhlichen gesprächigen Weintrinker, sie betrachten sie ebenso kalt und schamlos, als ob sie wirklich Katzen wären. Vor allem aber beschäftigen sie sich mit sich selbst. Sie untersuchen den Zustand ihrer Kleider und den Inhalt ihrer Taschen und wenn sie sprechen, dann wünschen sie von niemandem eine Antwort. Wie die Katzen gehören auch sie dem weiblichen Geschlecht an, und sie genießen das Privileg der Weiblichkeit, sich beständig zu schmücken und zu putzen. In ihrem verwahrlosten Haar stecken glitzernde Kämme, es fällt mädchenhaft auf ihre Schultern und umrahmt ein Gesicht, dessen Lippen zwar keine Zähne mehr verbergen, aber dennoch mit hellroter Farbe angemalt sind. Es gelingt ihnen, die tiefschwarzen Ränder ihrer Fingernägel wie das Attribut einer längst vergessenen, kostbaren Mode erscheinen zu lassen, wenn sie die immer noch vollen Hände auf den Lattentisch legen wie auf eine rote Logenbrüstung. Sie haben verstanden, daß der soziale Status des Menschen nicht am Zustand seiner Kleidung, sondern an ihrer Art und dem Schnitt erkannt wird. Wer nur deswegen nicht sieht, daß ihre Blusen aus feinem Stoff geschneidert sind, weil sie nun schon so manches Jahr ungewaschen blieben, ist blind. Wer nicht schließen kann, daß sie ihre weiten Hosen tragen, weil sie als junge Mädchen schon eine Freizügigkeit genossen haben, die aus ihrer hohen Herkunft kam, der soll getrost ihren Wunsch nach einer Weinkaraffe übersehen und am Nebentisch die Kleingewerbetreibenden versorgen, zu denen er damit selbst auch gehört. Es ist schon nicht so, daß sie den Wein jetzt unbedingt brauchen, obwohl es angenehm wäre, die trockene Kehle an einem heißen Tag etwas zu erfrischen. Gleich um die Ecke, beispielsweise, gibt es ein Geschäft, dessen Inhaber keinen Anstand nimmt, ihnen sofort eine Flasche zu verkaufen, auf ihn werden sie später zurückkommen. Das ist ein stiller korrekter Mann, wer ihm zahlt, dem gibt er, was man wünscht. Aber vorläufig ist die «Goldene Traube» ihre Station, denn es ist die Regelmäßigkeit, aus der sie viel Kraft ziehen, und es wäre undiszipliniert, die «Goldene Traube» nur deshalb nicht zu besuchen, weil man ihnen dort nichts mehr serviert.
Die «Goldene Traube» ist gut besucht, wenn die Geschäfte gerade schließen, aber draußen ist immer noch ein Tisch frei, wo eine Dame sich keinen Szenen aussetzt, wenn sie sich hinsetzt, und nichts bekommt, obwohl sie einer Bestellung grundsätzlich nicht abgeneigt wäre. Von den vielen Auftritten, die um diese Zeit in der «Goldenen Traube» vor sich gehen, nehmen sie allerdings keine Kenntnis. Da können die Motorräder der jungen Männer heran- und wieder wegknattern, da können Leute in blauen Overalls und solche mit den Krawatten der Schalterbeamten hereinkommen, sie blicken nur kurz einmal auf, denn sie wissen, hier kommt kein neues Gesicht herein, bis vielleicht einmal auf einen Touristen mit seinem Stadtplan, und ein Gesicht, das man nur einmal sieht, ist gar kein Gesicht, aber ein Gesicht, das man jeden Tag sieht, ist kein Gesicht mehr.
Wer soweit wie sie gekommen ist, muß sehen, daß er mit seinen Empörungen allein fertig wird, und es gibt auch in ihren Leben solche Empörungen, in der Gegenwart und in der Erinnerung. Die Welt ist voller Geschmacklosigkeiten, die muß man nicht suchen, und es ist unbillig, wenn man von Menschen, deren ganzes Leben ein Beispiel vollendeter stoischer Ruhe gibt, verlangt, daß sie auch im kleinen immer auf sich halten, und auf die Klage verzichten, die doch nicht mehr Erleichterung verschafft, als ein warmes Bad dem zu Tode Betrübten.
Wenn also der Eimer ihrer Fassungskraft überläuft, weil das Leben einen Tropfen von Häßlichkeit und Meskinität zuviel in ihn gegossen hat, dann öffnen sie ihren Mund und sprechen – ohne auf die fröhlichen Weintrinker in der «Goldenen Traube» Rücksicht zu nehmen – etwa so, wie es manchmal die Älteste von ihnen tut: «Gehen Sie mir doch weg mit der Prinzessin Belgioioso! Erzählen Sie mir doch nichts von dieser Frau! Wenn ich einen Menschen gekannt habe, dann sie, bis in ihre abscheulichsten Gewohnheiten hinein! Sie glaubte, sich vor mir nicht zusammennehmen zu müssen, weil wir jahrelang in einem Bett zusammen schliefen. Das ging soweit, daß sie mir schließlich meinen hellblauen Kamm stahl, einen nicht mehr ganz neuen, aber mir sehr teuren unersetzlichen Kamm, ein Geschenk von lieber Hand! Man weiß, wie das war: Oft behielt man von einem jungen Soldaten nichts in der Hand, als solch ein Erinnerungsstück, man lernte sie kennen, und dann mußten sie schon wieder fort und man erwachte und konnte die welken Blumen aus dem Haar ziehen und in einem Album pressen. Meiner hier war anders, er schenkte nicht nur diesen hellblauen Kamm, sondern vieles mehr, glacierte Maronen, Seidentücher und Eisenbahnfahrkarten: Wir haben die herrlichsten Dinge gemacht. Er hat mir dreiundfünfzig Briefe geschrieben, alle mit mindestens zwölf Seiten und der letzte war unvollständig, er trug ihn am Herzen, als ihn die Kugel traf, und die machte hinter dem letzten Satz: Ich liebe Dich! einen roten Punkt. Ich habe das gesamte Briefbündel aufbewahrt, aber einmal sehe ich unter mein Bett: Der Schuhkarton ist leer, ich laufe heraus, da hat die Schwester Oberin mir alle weggenommen und ist dabei, sie mit bunten Stecknadeln am schwarzen Brett zu befestigen. Ich reiße ihr von hinten den Schleier vom Kopf und zeige ihr, was ich davon halte, da geht sie mit den Nadeln auf mich los und will mir ins Gehirn stechen.