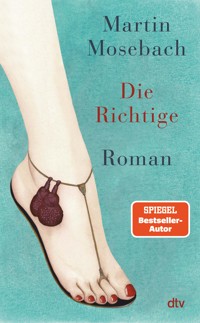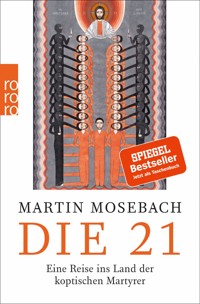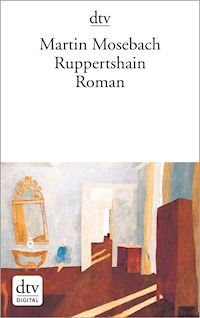9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein literarischer Italien-Streifzug des Büchner-Preisträgers Martin Mosebach. Italien: Land der Sehnsucht – und so viel mehr. Martin Mosebach hat sich auf die Suche nach der «italienischen Essenz» begeben. Und er hat sie gefunden: im Geruch des Meeres vor Venedig und im Klang Roms während der frühen Morgenstunden; im sinnlichen Zauber der Commedia dell'arte und in Sprichwörtern; im Anblick des Maurers, der nach getaner Arbeit Muscheln von den Steinen nahe dem Strand klaubt – im Hier und Jetzt. Und wer weiß, wie man dort ankommt, der versteht zu leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Martin Mosebach
Die schöne Gewohnheit zu leben
Eine italienische Reise
Über dieses Buch
Ein literarischer Italien-Streifzug des Büchner-Preisträgers Martin Mosebach.
Italien: Land der Sehnsucht – und so viel mehr. Martin Mosebach hat sich auf die Suche nach der «italienischen Essenz» begeben. Und er hat sie gefunden: im Geruch des Meeres vor Venedig und im Klang Roms während der frühen Morgenstunden; im sinnlichen Zauber der Commedia dell’arte und in Sprichwörtern; im Anblick des Maurers, der nach getaner Arbeit Muscheln von den Steinen nahe dem Strand klaubt – im Hier und Jetzt. Und wer weiß, wie man dort ankommt, der versteht zu leben.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Februar 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Das Buch erschien zuerst 1997 im Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
Umschlagabbildung David Lichtneker/Arcangel
ISBN 978-3-644-40249-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
‹Freund›, sagte Dian unterwegs zu mir, da ich ihm meine innerste Bewegung nicht recht verhüllen konnte, ‹wie kann Euch erst sein, wenn Ihr nach Neapel zurückschauet etwan auf der Überfahrt nach Ischia! – denn man merkts sehr, daß Ihr in Nordland geboren seid.› – ‹Lieber›, sagt’ ich, ‹jeder wird mit seinem Norden oder Süden gleich geboren, ob in einem äußern dazu – das macht wenig.›
JEAN PAUL
Titan
Das kälteste Land der Welt
Prolog
Der junge Mann reiste mit glänzenden Empfehlungsbriefen. Jetzt saß er am Tisch der Dichterin auf einer Dachterrasse in der Nähe der Piazza Farnese. Über ihm wölbte sich ein veilchenfarbener Himmel, um ihn herum saßen würdige ältere Herren, der Maler, der Komponist und der Architekt, die schon seit Jahrzehnten in Italien lebten. Es war so heiß, daß man meinte, feurigen Wüstenwind zu atmen. Der junge Mann war glücklich. «Wie gefällt es Ihnen in Rom?» fragte der Maler, der seine ironische Nachsicht gegenüber jungen Leuten gern durch zeremonielle Höflichkeit tarnte. «Gut», hätte der junge Mann antworten können. Statt dessen brachen die Dämme seiner Schüchternheit. In die lähmende Hitze ergoß sich der frische Strom seiner Begeisterung. Rom! Die Plätze! Die Steine! Die Obelisken! Die Gärten! Die Kuppeln! Die Blicke! Wichtiger aber noch: die Menschen! Ihre Herzlichkeit, ihr Enthusiasmus, ihre Leidenschaft! Ihre Wärme!
«Ihre Wärme?» fragte der Maler und zog die Augenbrauen in die Höhe. «Wir müssen unseren Gast hier, vermute ich, aufklären», sagte die Dichterin. «Er scheint seine eigenen Empfindungen auf das, was ihm begegnet, übertragen zu haben.» Sie sah in die Runde, tauschte mit jedem der Herren einen ernsten Blick, die Herren nickten zum Einverständnis. Der Schleier des Schweigens wurde gehoben.
«Italien», begann die Dichterin und wandte sich dem jungen Mann wieder zu, «Italien ist das kälteste Land der Welt.»
Der Architekt mit den silbernen Fäden im schwarzen Schnurrbart ergänzte: «Kälte ist hier keine meteorologische, sondern eine geistige, eine sinnliche, eine geschmackliche, eine kulturelle Kategorie. ‹Das alte kalte Volk› hat Rudolf Borchardt die Italiener genannt. Er hat damit die Neigung zur nüchternen Berechnung, den zynischen Blick auf die irdischen Verhältnisse gemeint, eine illusionslose Weltkenntnis, wie sie einer fast dreitausendjährigen Geschichte angemessen ist. Man könnte von einer welthistorisch bedingten Disposition zur Kälte bei den Italienern sprechen.»
«Nicht in die Tiefe der Zeiten schweifen!» rief der Komponist. «Da ist es zu dunkel!» Seine Stimme war für Augenblicke unhörbar, weil tief unten drei Motorräder durch die Straßenschlucht jagten und einen explosionsartigen Krach verursachten. «Sprechen wir von dieser Gefühllosigkeit dem Lärm gegenüber», fuhr er fort, «das ist für mich auch Kälte. Das Krachmachen ist eine Betätigung des menschlichen Egoismus und nicht weiter auffällig – aber das Nicht-unter-Krach-Leiden ist ein Phänomen, das mich immer neu erstaunen läßt. Noch mehr: den Krach gerade zu suchen! Die Angst vor der Stille! Und wenn Sie mir erlauben, den Krach als eine laute Tonlosigkeit zu definieren, dann zieht sich diese Unempfindlichkeit bis in Regionen hinein, die das genaue Gegenteil von Geräuschchaos bilden sollten – in die Musik! Toscanini ist für mich der Inbegriff des italienischen Dirigenten – mit der Dynamik der Motorradfahrer, die mich eben zum Verstummen gebracht haben, hetzt er, scheppernd und krachend, jedes zarte Detail erwürgend, durch eine Mozartsymphonie. Und etwas anderes wird hier auch gar nicht wahrgenommen!» sagte er mit wachsender Bitterkeit. «Nichts haben die großen Pianisten aller Zeiten so gefürchtet wie einen Auftritt in Italien! Die Zerstreutheit, die Indifferenz des Publikums, sein Desinteresse an einer konzentrierten, die Aufnahmefähigkeit fordernden Leistung sind unbesiegbar! Aber dafür strömt das musikverliebte Volk in die Arena von Verona, diesen Reichsparteitag der Oper, singt auf den Rängen die Arien mit und überschüttet, noch während das Orchester spielt, die Diva mit einem Blumenregen, als erwarte jeden, der mit seinem Strauß ihren Busen trifft, eine Freikarte für den nächsten Abend.»
«Was für Sie die Töne sind, ist für mich das Licht», sagte der Maler begütigend, als gelte es, den Komponisten durch Zustimmung vom Gegenstand seiner Erregung abzulenken. «Jede Erscheinung wird ausschließlich von dem Licht geschaffen, das auf sie fällt. Aber welches Licht fällt in diesem Land auf Menschen und Dinge! Im Norden ist sehnsüchtig oder tadelnd immer vom Schönheitskult der Italiener die Rede. Sind damit etwa die bläulichweißes Licht ausgießenden Neonröhren gemeint, die hier überall die gebräunten Sommergesichter grau und faltig machen? Ob in Wirtshäusern oder Wohnungen – die eiskalte Lichtdusche von der Zimmerdecke läßt alles darunter totenstarr werden. ‹Gemütlichkeit› ist ein zu recht mißtrauisch betrachteter Begriff – aber soll ‹Ungemütlichkeit› deshalb ein Ideal werden? Frierend stehen steife Möbel, meist an der Wand aufgereiht, als sollten sie versteigert werden, auf Kachel- oder Terrazzo- oder Marmorböden. Bei den Armen sind die Metallbeine der Plastikstühle insektenartig gespreizt, die Wände können auch zahnpastagrün oder unterwäschehellblau gekalkt sein. Bei der antiquitätenliebenden Bourgeoisie hat der Sakristeienbarock seine Heimat gefunden, grobe, auf Fernwirkung berechnete, vergoldete Stuckschnecken auf Rahmen und Sesseln, die sich dann in hochpolierten Marmorböden spiegeln. In emanzipierten Kreisen speist man in Operationssälen mit Glas- und Stahlmobiliar. Und für wen sind die Renaissancepaläste bewohnbar, wenn nicht für drei Meter hohe Statuen? Eine protzige Kahlheit – das ist die besondere italienische Spezialität. Erst in Italien, umgeben von scharf weiß getünchten Mauern, habe ich verstanden, daß es nicht nur einen calvinistisch-holländischen, sondern auch einen katholischen Puritanismus gibt. Und auf welchen Betten sich die Leute ausstrecken! Erst neulich habe ich in einem Prunkgemach geschlafen, oder besser, kein Auge zugetan. Das Bettgestell war ein reich geschnitzter Barockkatafalk; in ihn hatten meine Gastgeber ein höchst fragiles Camping-Klappbett gestellt – das ist kein Einzelfall! Es wird ja auch nichts getrunken. Sechs Personen kommen mit einer Flasche Rotwein zum Essen aus, und ohne Essen gibt es erst recht keinen Wein.» Hier sprach ein verwundetes Herz. Mitten in selige germanische Trunkenheit waren offenbar kühle romanische Verachtungsblicke gedrungen und hatten eine ernüchterte Befangenheit erzeugt, an die sich selbst der heitere Maler nur mit Unbehagen erinnerte.
«Sie erwähnen den Marmor», sagte der Architekt, indem er eine Brücke über die peinigende Erinnerung baute. «Italien – das Land des totesten Marmors, des Friedhofmarmors schlechthin. Aus Carrara, dieser dantesken Höllenschlucht, der wie ein mondgroßer Kuchen brutal zersägten Berglandschaft, kommt jener weiße Stein. Wenn er fehlerlos ist, gleicht er weißer Seife und wird vielleicht gerade deshalb so gern für die Bepflasterung von Badezimmern genommen. Aber auch der italienische Normalfriedhof ist eine Großhandlung für Carrara-Platten. Wenn Carrara altert, wird er schmutzig. Und auf diesem schmutzigen Weiß, in diesen Marmorschrankwänden, Marmorklavieren, Marmorgaragen, den Ossarien, Sarkophagen und Mausoleen, blühen dann kreischend rot und gelb die Plastikblumen, rund um die auf ein Porzellanschildchen gedruckte Photographie der Toten. Dem Inbegriff eines italienischen Grabmals bin ich in einer Bildhauerwerkstatt in Carrara begegnet – ein Cadillac in Originalgröße aus einem Marmormonolithen naturgetreu bis auf die Scheibenwischer und die Schrauben der Radnaben herausgehauen. Das Grabmal war zwar für Chicago bestimmt, aber für einen dort dahingegangenen Italiener – vielleicht für denselben, der in einer benachbarten Werkstatt achtmal den David von Michelangelo hatte klonen lassen, eine nackte Kolossal-Fußballmannschaft, die in der Halle wie in einem Umkleideraum auf ihren Abtransport wartete. Das Lebendigste, was ein Bildhauer bei Carrara-Marmor erreichen kann, ist ein wächserner Leichenton. Der Kult um diesen Stein, diesen italienischsten aller Steine, grenzt an Nekrophilie. Kein Eiseshauch kommt mir bei seinem Anblick entgegen, sondern die Verfrorenheit einer kalt schwitzenden Hand …» Er stockte im Nachsinnen über noch giftigere Invektiven und bot der Dichterin damit die Gelegenheit, ihn zu unterbrechen – sie hatte schon vor einer Weile ihr Stichwort vernommen.
«Sie tadeln die Plastikblumen – gewiß, sie sind nicht schön, aber sie sind doch weitaus erträglicher als alles, was sie an echten Blumen in einem italienischen Blumengeschäft kaufen können! Ich meine nicht die fast schwarzen Baccarat-Rosen auf meterlangem Stiel, das floristische Pendant zum blankpolierten Steinway-Flügel. Ich denke an die Lieblingsblumen der Nation. Zunächst die Anthurie – der Rhesusaffenpenis, der aus einer roten Lackzunge aufsteigt. Fünfzig Stück davon gelten hierzulande als passende Gabe für jede Kinderkommunion. Dann folgt unmittelbar die weiße Calla – eine Blütentüte aus Wachspapier, die in einen fetten, gurkendicken grünen Stiel übergeht. Vor mächtigen Buketts der Calla werden in italienischen Filmen gern Folterszenen angesiedelt. Aber diese Blindheit gegenüber der Schönheit von Blumen entspricht ja einer Wahrnehmungsschwäche gegenüber der ganzen Natur. Nennen Sie mir große italienische Landschaftsmaler! Landschaften auf den Bildern der großen Italiener sind bloße Staffagen, Theaterkulissen, die selbst auf der Leinwand kaum leben. Auch hier darf sich die Vorliebe für die Oper austoben. Der Nordmensch seufzt am Golf von Neapel, in der römischen Campagna, unter den Oliven von Fiesole, an den Hängen des Comer Sees – Italienern ist zu diesen Wundern erst unter dem Trommelfeuer der nördlichen literarischen und malerischen Propaganda etwas eingefallen. Und diese Gefühllosigkeit erstreckt sich bis auf die Tiere: Ich verabscheue Hunde, aber den gedrückten, geprügelten, den hündischen Hund mit eingekniffenem Schwanz will ich schon gar nicht um mich haben. Und weil Sie jetzt bereits über mich lächeln – die weibliche Sentimentalität für Blumen und Tiere» –, keiner der Herren hatte gewagt, das Gesicht zu verziehen – «will ich das Vorurteil nun auch bestätigen und über die italienischen Weihnachten klagen. Man mag unsere Baumanbetung aus Wotanszeiten, die sich den Wald zur Sonnenwende ins Zimmer holt, ruhig belächeln und braucht die italienische Plastiktanne, einer Flaschenbürste nicht unähnlich und mit glitzerndem Schmuck bis zur Unkenntlichkeit überschüttet, dennoch nicht als urbanes Gegenmodell zu feiern. Aber was erwartet man von einem Volk, das die Opferkerzen in den Kirchen durch Automaten ersetzt hat, die nach Geldeinwurf anspringen, um vor dem Heiligen Antonius drei Minuten lang sechs Glühbirnchen leuchten zu lassen! Auch der Heiligenschein der Immaculata ist durch Birnchen gebildet – das sieht besonders mystisch aus, wenn einige Birnchen des Strahlenkranzes, wie fast immer, kaputt sind.»
«Überall dort, wo der Nordmensch ergriffen und gefühlvoll ist, bleibt der Italiener stumpf und kalt», sagte der Maler.
«Für einen Italiener sind aber natürlich wir die Kalten!» rief der Komponist empört. «Wir sind die Rechner, ohne Sinn für Anmut und Poesie! Die unsinnlichen Barbaren, die sich ihrer Rohheit schämen müssen!»
«Hat nicht selbst diese Hitze, die heute nacht nicht weichen will, in ihrer Erbarmungslosigkeit etwas Kaltes?» Das war der Architekt, der unter dem kritischen Blick der Dichterin ein Paradoxon wagte.
Der junge Mann sah ratlos von einem zum andern. Der Maler hatte sein Atelier in einer verlassenen venezianischen Kirche eingerichtet, der Architekt besaß einen Palast in einem toskanischen Landstädtchen, und der Komponist bewohnte ein Kloster an der ligurischen Küste. «Wie können Sie dann nur hier leben?» Das war eine Frage, aus der ungläubiges Staunen sprach.
«Nur mit dem Blick auf römische Mauern kann man bauen», sagte der Architekt.
«Erst hier habe ich sehen gelernt!» sagte der Maler.
«Ich höre meine Musik hier in der Luft», sagte der Komponist.
Die Dichterin schwieg; sie hatte sich erst kürzlich über den Gegenstand verbreitet und wollte sich nicht zitieren.
Man brach jetzt auf. Alle hatten noch Verabredungen – zum Abendessen, im Café, zu einem Cocktail, mit einer Dame.
Unversehens stand der junge Mann allein auf der Straße.
Ein Motorrad raste auf ihn zu. Im letzten Augenblick sprang er in ein Haustor. So wachte er auf.
Die schöne Gewohnheit zu leben
Der Golf von Neapel in Sprichwörtern
IN MEMORIAM MARIAE SALVIA
Maria lebt seit achtundsiebzig Jahren auf der Insel Capri und hat noch nie die Blaue Grotte gesehen; sie kennt die Faraglioni, die bizarren Felsenhörner, nur von den Photos, die keineswegs nur die Touristen, sondern auch die Mitglieder ihrer Familie unablässig knipsen, und sie hat auch als junges Mädchen nie den Einfall gehabt, im Meer zu baden. Wenn man ihr glaubt, dann wäre es ihr vollkommen gleichgültig, wo sie lebt, solange sie nicht ihre Gewohnheiten ändern müßte.
Gewohnheit, das ist ein anderes Wort für Leben. Nur was sich wiederholt, kommt Maria bemerkenswert vor. Das Außerordentliche stört ihren Sinn für Symmetrie. Sie will nichts erleben, was sie nicht ausdrücken kann, aber sie will auch nichts sagen, was von ihrem ererbten Erfahrungsschatz nicht gedeckt ist. Deshalb liebt sie Sprichwörter. Was ihr auch widerfährt – sie ruht nicht, bis sie das dazu passende Sprichwort gefunden hat. Es ist, als bilde das Wort ein Gegengewicht zu den Ereignissen. Erst wenn sie es ausgesprochen hat, ist die Welt wieder im Lot.
Den Gartenweg kommt Rosita entlang; sie trägt einen Korb Zitronen auf dem Kopf und lächelt siegesgewiß. Es sind gute, pralle Riesenzitronen, großporig wie die Nase eines Säufers, die dicksten Zitronen weit und breit, gereift in warmem Halbdunkel hinter den Strohmatten, die Licht und Wind von den Zitronenbäumen abhalten. Um die Bäume herum ist die Erde geharkt wie in einem Vorgarten; Rosita macht sich viel Arbeit mit den Zitronen, damit sie die besten werden, und sie sind die besten.
Rosita ist braungebrannt wie ein Mann mit harten Händen und schwarzen Fingernägeln vom sauberen Dreck der Gartenerde. Maria ist blaß, allenfalls ein bißchen gelblich, und ihre Hände sind rot und weich, denn sie werden, was immer sie auch nur flüchtig berührt haben, sofort in die Wasserschüssel getaucht, in der eine Zitronenscheibe schwimmt, viele Male am Tag.
In der Küche ist es so dämmrig wie im Zitronenhain. Maria geht leise auf und ab; wer sie sieht, glaubt nicht, daß sie auf der Straße keinen Schritt zu gehen bereit ist. Sie braucht eben ihre Pantoffeln. Sie will gleiten, nicht schreiten. Rosita stampft geradezu, verglichen mit Maria. Die Gläser im Küchenschrank klingeln, als Rosita ihren Korb absetzt. Maria hat das nicht so gerne, sie liebt die Stille. Die Bauern sind grob und brauchen zuviel Platz. Am meisten ärgert sich Maria aber über Rositas Zuversicht. Rosita glaubt ganz offensichtlich, daß sie die einzige Frau sei, die Zitronen zu verkaufen hat. Da steht sie, hält zwei glänzende Zitronen in den braunen Pratzen und strahlt so stolz, als hätte sie die Zitronen soeben geboren. Das wollen wir ihr mal versalzen, denkt Maria. Ihr Gesicht blickt höflich und zugleich skeptisch. Ja, so hätten die letzten auch ausgesehen. Und innen? Völlig saftlos, mit einer matten Säure. Für die Hausfrau sei das nicht schön gewesen. Die Familie sei heikel – sehr heikel! Rosita hört sich das alles mit heiterer Miene an. Mit diesen Mitteln ist ihr Stolz nicht zu kränken. Sie wartet, sie hört zu, sie denkt, aber sie spricht nicht aus, was sie denkt. «Chi disprezza vuol comprare – wer verachtet, will kaufen.» Das hätte an ihrer Stelle auch Maria sagen können.
Ein Vogel zwitschert im Lorbeerbaum. Dann kracht ein Schuß aus der Schrotflinte. Und jetzt herrscht wieder Stille, vertieft durch Knister- und Raschelgeräusche. Die Sonnengardinen blähen sich im Wind, und das ist genau das, was sie auch tun sollen, denn sie sind frisch gewaschen, damit alles hier einen guten Eindruck macht. Es naht die Zeit der villeggiatura, wenn alle Ehemänner aller besseren Familien in Neapel ihre Frau und die Kinder aufs Land und auf die Inseln schicken. Die villeggiatura ist teuer, viel zu teuer, sie frißt dem Familienvater die Haare vom Kopf, aber sie muß sein. Hier oben ist man weit entfernt von den Cafés der Piazza, also werden die Quartiere etwas billiger sein. Ein Anwalt hat Interesse bekundet, seine Frau und die schon etwas ältere, leider noch unverheiratete Tochter bei Maria einzumieten; er selbst will immer nur über das Wochenende aus Neapel heraufkommen. «Ein Haushalt mit einer alten Jungfer ist meistens schwierig», sagt Maria. Sie hat tagelang die Zimmer mit scharfer Salmiaklösung geputzt, die mit Schafwolle gestopften Matratzen sind aufgetrennt worden, die Wolle hat in der Sonne gelegen, ein Mann hat sie mit einer rostigen Maschine neu zerrauft, wieder in die Hüllen gestopft und eingenäht und das Ganze dann aufs neue boutonniert. Mitten im Salon steht ein Bügelbrett, denn die Frau des Anwalts hat am Telephon gesagt, daß ihre Tochter jeden Tag bügelt, um abends im Café einen guten Eindruck zu machen. In der Woche wollen Mutter und Tochter zusammen in dem großen Ehebett schlafen, am Wochenende kann der Tochter ein Drahtbett in einem kleinen Flur aufgeschlagen werden. Alles ist wundervoll vorbereitet, in harter Arbeit nach zahllosen Telephonaten. Und jetzt sind die Leute da – der Anwalt mit silberweißem Haar und straffer Haltung, die würdevolle Matrone in rotem, die magere Tochter in blauem Leinen. Ja, schön, da ist das Bügelbrett, der Kühlschrank, das Drahtgestell, die frisch gestopften Matratzen. Ja, sauber ist es auch; es riecht nach Salmiak. Draußen zwitschert ein Vogel. Es ist still hier.
«Ist es immer so still hier?» fragt die Frau des Anwalts mit kaum verhüllter Angst. «Wenn es hier immer so still ist, werde ich verrückt!»
Alle Arbeit war umsonst. Die Familie ist aus dem drohenden Schweigen der campagna in die Sicherheit eines lauten Cafés geflohen. Maria sitzt in der dunklen Küche und denkt an die letzten Tage. «Una mala nuttata – e la figlia femmina. Eine schlimme Nacht – und das Kind nur ein Mädchen!»
Mario ist Maurer, aber am liebsten steigt er am Wasser zwischen den Felsen herum, löst mit einem scharfen Messer flache Muscheln von den Steinen und sammelt sie in einem kleinen Eimer. Er ist schüchtern und am liebsten allein. Seine Frau Rosita – «Rosita von den Zitronen» – ist zu tüchtig. Sie sieht aus, als ob sie mit ihren Zähnen Nüsse knacken könnte, obwohl sie viel zu vernünftig ist, um ihre schönen neuen Jacketkronen solchen Prüfungen auszusetzen. Gern schickt sie ihren Mann auf die Jagd nach den kleinen weichen Muscheln, dann ist er ihr bei der Arbeit nicht im Weg und kann dennoch keinen Unsinn machen. Der Strand ist einsam, auf dem Mario zwischen den Felsen auf- und absteigt; manchmal versinkt sein Kopf ganz, und dann taucht er weit entfernt zwischen zwei riesigen schwarzen Blöcken wieder auf.
Die blonde Schwedin, die den steilen Pfad heruntergestiegen war, mußte einfach glauben, daß sie ganz allein in der schönen Bucht sei. Als sie sich zu ihrer Badetasche herunterbeugte, um das Handtuch herauszusuchen, hätte sie Marios Kopf hinter einem Felsen hervorgucken sehen können, aber als sie dann den Kopf hob, war er schon wieder verschwunden. Die Schwedin zog ihre Bluse aus und streckte sich auf dem warmen, glatten Stein aus. Sie wollte der Sonne ein Opfer bringen, sie wollte nicht mit sich geizen, sondern sich den ultravioletten Strahlen ganz hingeben. Die Augen hielt sie geschlossen; die Sonne durfte jetzt machen, was sie wollte.
Mario hatte gar keine Kamera dabei, aber er verhielt sich wie ein Photograph. Als suchte er den besten Blickwinkel, umkreiste er die regungslose Schwedin, immer wohlverborgen hinter dicken Steinen, und war sofort verschwunden, wenn sie auch nur etwas tiefer atmete. Einmal klapperten die Muscheln in seinem Eimerchen, und die Schwedin schlug die Augen auf, aber das Schweigen der Felsen, die sie rings umgaben, beruhigte sie schnell. Und sie hätte niemals von Marios Gegenwart erfahren, wenn sie etwas später nicht versucht hätte, in das Motorboot zu steigen, in dem ihre Freunde saßen. Das Boot kam nicht nah genug an die Felsen heran; die Schwedin mußte einen sehr großen Schritt machen und schwankte. Im selben Augenblick war Mario neben ihr und griff ihr rettend mit beiden Händen ans Hinterteil.
Maria staunte überhaupt nicht über den schüchternen Mario, als sie die Geschichte hörte. «Sie war blond, nicht wahr», sagte sie. «Un pelo tira più che cento paie di buoi. Ein solches Haar zieht mehr als hundert Paar Ochsen.»
Vor der Insel liegt ein Kriegsschiff auf dem glitzernden Wasser, ein Koloß aus graugestrichenem Stahl, der sich von seiner lichtüberfluteten Folie schwarz und mächtig abhebt. Hubschrauber schweben von seinem Deck in die Luft, Antennen und Radarschirme stehen turmhoch über den festungshaften Aufbauten. Man darf das Schiff besichtigen; der Kommandant hat angekündigt, daß die Kinder zwischen den Kanonen zum Eisessen eingeladen werden.
Maria blickt von ihrer Höhe auf das Schiff herunter. Es ist größer als das Grand Hotel und die Kathedrale, größer als irgend etwas auf der Insel; erstaunlich, daß das Ufer nicht durch das viele Wasser, was verdrängt wird, überflutet ist. Das ist das einzige, was Maria verwundert. Sie wird sich das Schiff nicht ansehen. Das Schiff, wie es so daliegt, ist ihr gleichgültig; aber sobald sie sich darauf befände, hätte sie Angst, elend zu ertrinken. Wenn das Schiff wieder abfährt, wird es, so groß es ist, nicht einmal ein Loch hinterlassen. Das Schiff ist ein Spielzeug für Männer. Attilio und Franco vom Veteranenverein werden auf das Schiff steigen, für die ist das das Richtige. Beunruhigend ist allerdings, daß auch Marias Enkel unbedingt das Schiff sehen wollen. Man wird doch nicht so herzlos sein, die Großmutter allein auf dem Berg zurückzulassen, Schlangenbissen, Skorpionen, Räubern und Unholden ausgeliefert? Alfredino, einen dicken hübschen Putto, wird man nicht hindern können, aber Valentina mit der hohen Nonnenstirn und den melancholischen Augen muß zu Hause bleiben, da helfen keine Tränen.
«Siehst du, Alfredino muß das Schiff sehen, weil er den schiocco hat», sagt Maria, um tröstliche Einsicht zu vermitteln. Schiocco ist ein Dialektwort für Knospe, hier speziell für den Körperteil gebraucht, der Alfredino von Valentina unterscheidet. Alfredino lächelt selbstgefällig, während ihn seine Schwester voll Abscheu betrachtet. «Du mußt dich daran gewöhnen», sagt Maria. Alfredino verläßt das Haus mit erhobenem Haupt. Er trägt einen Kinderphotoapparat aus buntem Plastik, er wird hundert Bilder knipsen, Eis essen und ein amerikanisches und ein italienisches Fähnchen zum Geschenk erhalten. «Das ist das Leben einer Frau», sagt Maria. Sie hat die Lust zu trösten ein bißchen verloren. Das Geheule ist doch zu verächtlich. Also Schluß damit.
«Una donna d’oro non merita un uomo di paglia», sagt Maria. «Eine Frau aus Gold verdient noch nicht einmal einen Mann aus Stroh!»
«Giuseppina hat ein Herz aus Gold», sagt Maria, als sich ihre Schwägerin auf krummen, besser: völlig verbogenen Beinen auf einen mühevollen Heimweg begeben hat. Die beiden Frauen haben in der Küche Kaffee getrunken, in nächster Nähe des Herdes, denn Maria ist der Überzeugung, daß der Kaffee, wenn er nicht augenblicklich nach dem Aufkochen getrunken, sondern erst auf die Terrasse oder in das Eßzimmer getragen wird, sein gesamtes Aroma bereits verloren hat. Mit solchen Finessen kennt Giuseppina sich natürlich nicht aus. Woher auch? Sie ist eine Bäuerin, roh, primitiv, ungebildet. Die Bauern wissen nicht zu leben. Sie sammeln Schnecken und Sauerampfer und essen ihre Spaghetti mit Kastanien – eine Ernährung für Wildschweine. Aber das ändert nichts daran, daß Giuseppina herzensgut ist. Warum sind die Beine so krumm? Vom Arbeiten auf dem Feld und im Garten, von morgens bis abends. Dazu war sie ja schließlich ausgesucht worden. Als Marias Schwiegereltern beschlossen, daß nun auch der jüngere Sohn eine Frau