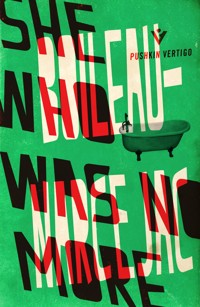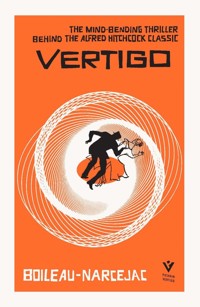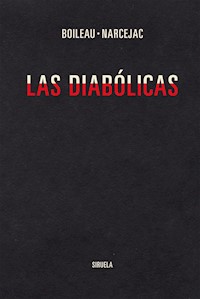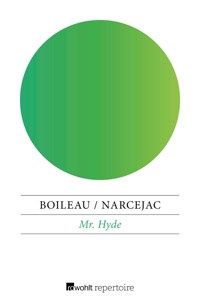9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eliane ist noch eben rechtzeitig aus dem alten, längst nicht mehr benutzten Brunnen gezogen worden; François Rauchelle, ihr Mann, kann nicht begreifen, wie es zu dem Unfall kommen konnte … Oder will er es nicht begreifen? Es gibt keine rationale Erklärung. Aber … Da ist Miriam, die Frau, die er zu lieben glaubte und deren Einfluß er sich noch immer nicht entziehen kann – die schöne, geheimnisvolle Fremde, die mit einer schwarzen Dienerin und einem Geparden auf der kleinen Insel lebt, die, der Küste vorgelagert, nur bei Ebbe über eine Dammstraße zu erreichen ist. Miriam, die an Schwarze Magie glaubt, die ihn aus der spießigen Enge seiner ländlichen Tierarztpraxis reißen und der bürgerlichen Eliane endgültig abspenstig machen will … Hat Miriam etwas mit dem unerklärlichen Unfall zu tun? Die heile, gesicherte Welt François Rauchelles ist zerbrochen. Wie er sich auch dagegen wehrt – er ist Miriam verfallen. Er beschließt, mit ihr zu fliehen. In aller Heimlichkeit brechen sie eines Nachts auf, um die Insel zu verlassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Pierre Boileau • Thomas Narcejac
Das Geheimnis des gelben Geparden
Aus dem Französischen von Yvonne de Hair
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Eliane ist noch eben rechtzeitig aus dem alten, längst nicht mehr benutzten Brunnen gezogen worden; François Rauchelle, ihr Mann, kann nicht begreifen, wie es zu dem Unfall kommen konnte … Oder will er es nicht begreifen? Es gibt keine rationale Erklärung. Aber …
Da ist Miriam, die Frau, die er zu lieben glaubte und deren Einfluß er sich noch immer nicht entziehen kann – die schöne, geheimnisvolle Fremde, die mit einer schwarzen Dienerin und einem Geparden auf der kleinen Insel lebt, die, der Küste vorgelagert, nur bei Ebbe über eine Dammstraße zu erreichen ist. Miriam, die an Schwarze Magie glaubt, die ihn aus der spießigen Enge seiner ländlichen Tierarztpraxis reißen und der bürgerlichen Eliane endgültig abspenstig machen will … Hat Miriam etwas mit dem unerklärlichen Unfall zu tun?
Die heile, gesicherte Welt François Rauchelles ist zerbrochen. Wie er sich auch dagegen wehrt – er ist Miriam verfallen. Er beschließt, mit ihr zu fliehen. In aller Heimlichkeit brechen sie eines Nachts auf, um die Insel zu verlassen.
Über Pierre Boileau • Thomas Narcejac
Die beiden französischen Autoren Pierre Boileau (1906–1989) und Thomas Narcejac (1908–1998) haben zusammen zahlreiche Kriminalromane verfasst. Ihre nervenzerreißenden Psychothriller haben viele Regisseure zu spannenden Filmen inspiriert, am bekanntesten sind wohl «Die Teuflischen» und sein amerikanisches Remake «Diabolisch» und «Vertigo – Aus dem Reich der Toten», sicher einer der besten Filme von Alfred Hitchcock.
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
MIRIAM HELLER
glaubt an Schwarze Magie.
FRANÇOIS RAUCHELLE
glaubt, ein Mörder zu sein.
ELIANE RAUCHELLE
glaubt an ihren Mann – trotz allem.
RONGA
glaubt nicht – sie weiß … Glaubt sie.
Jede eventuelle Ähnlichkeit der Charakteredieses Buches mit lebenden oder verstorbenen Personenberuht auf einem Zufall.
… l’amour n’est rien, s’il n’est pas de la folie, une chose insensée, défendue, et une aventure dans le mal.
THOMAS MANN, Der Zauberberg
Seine kräftigen Schritte werden in die Enge kommen, und sein Anschlag wird ihn fällen. Denn er ist mit seinen Füßen in den Strick gebracht, und wandelt im Netze. Der Strick wird seine Ferse halten, und die Schlinge wird ihn erhaschen. Sein Strick ist gelegt in die Erde, und seine Falle auf seinem Gang. Um und um wird ihn schrecken plötzliche Furcht, daß er nicht weiß, wo er hinaus soll.
Das Buch Hiob
1
François Rauchelle, Tierarzt
Le Clos Saint-Hilaire über
Beauvoir-sur-Mer (Vendée)
an
Maître Maurice Garçon
Mitglied der Academie Française
Anwalt am Obersten Gericht
Paris
ALLES BEGANN AM 3. MÄRZ DIESES JAHRES. So kommt es mir wenigstens vor. Ich kann nicht mehr das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden. Hat der Besuch Vials alles ausgelöst? In gewissem Sinne, ja. Aber wenn man nicht an einen Zufall glaubt, hat das Drama schon zwei Jahre früher begonnen. Auch im März! Denn es war März, als ich mit Eliane hierher zog. Wir kamen von Epinal.
Aber ich will Ihnen nun nicht mein ganzes Leben erzählen. Ich will Ihnen nur ausführlich die Ereignisse dieser letzten drei Monate schildern, nichts zusammenfassen, nichts frisieren, mit einem Wort, genauso wie ich sie erlebt habe. Ich weiß nicht, ob ich schuldig oder unschuldig bin. Sie werden das entscheiden, wenn Sie diesen Bericht gelesen haben, denn ich werde mir Mühe geben, einen Bericht zu verfassen.
Ich bilde mir nicht ein, mich gewandt auszudrücken. Aber mein Beruf hat mich gelehrt zu beobachten, nachzudenken, auch mitzufühlen, und darunter verstehe ich, empfänglicher als andere für das zu sein, was ich ‹Symptome› nenne. Wenn ich mich einem Tier zum erstenmal nähere, weiß ich sofort, wie ich sein Vertrauen gewinnen kann, wie ich es ansprechen, streicheln, beruhigen muß. Zunächst ertasten meine Finger unter dem schweißnassen Fell die Angst. Sie können mir glauben, daß die Tiere von Todesangst gepeinigt werden. Ich habe immer ein Gefühl für diese dumpfe Angst gehabt, die die Tiere umfangen hält, wenn sie krank sind. Über Angst weiß ich Bescheid. Deswegen bin ich ein guter Zeuge.
Und doch hatte ich an jenem dritten März, als die Glocke anschlug, keinerlei Vorahnung. Die Nacht brach herein. Ich war abgespannt. Den ganzen Tag war ich im Marschland unterwegs gewesen, von einem Hof zum anderen gefahren. Ich hatte gerade geduscht und war im Hausrock in meinem Arbeitszimmer damit beschäftigt, eine Liste der pharmazeutischen Artikel aufzustellen, die ich dringend aus dem Labor in Nantes brauchte. Tom bellte. Ich stand widerwillig auf. Sicher ein Unfall. Ein verwundetes Pferd, das vielleicht getötet werden mußte. Ich ging hinunter und durch die Küche, um Eliane Bescheid zu sagen.
«Ich werde mich beeilen. Wenn es nicht zu dringend ist, werde ich morgen hingehen.»
«Es wird wieder so kommen, daß du kalt essen mußt», sagte Eliane, was bedeutete, ‹ich werde wohl wieder allein essen müssen!› Aber ich konnte mir nicht leisten, nachlässig zu sein. Mein Vorgänger hatte innerhalb von ein paar Monaten seine Klienten verloren, einfach deshalb, weil er nicht begriffen hatte, daß auf der Marsch die Tiere wichtiger sind als die Menschen. Ich ging die Allee hinunter. Durch das Torgitter erkannte ich die großen Umrisse und die dunkle Masse eines ungewöhnlich langen Wagens, ohne Zweifel eines amerikanischen. Beunruhigt legte ich einen Schritt zu und öffnete das Tor.
«Monsieur Rauchelle?»
«Ja.»
«Doktor Vial.»
Ich bat ihn einzutreten. Er zögerte; schließlich sagte er: «Nur eine Minute.»
Als ich neben ihm herging, dachte ich bei mir: ein Pariser, der das Wochenende in Saint-Gilles oder in Sables verbringt. Vielleicht, um sein Haus vor den Osterferien durchzulüften … Ungefähr fünfzig, mindestens … Reich … Die Kinder sind versorgt … Madame hat einen Hund, den sie mit Süßigkeiten überfüttert hat … Einen Pekinesen oder einen Dackel … Ich führte ihn in mein Sprechzimmer. Er sah sich um, legte seinen Filzhut und die Handschuhe auf den Untersuchungstisch, wies den Stuhl, den ich ihm hinschob, zurück und hielt mir sein Zigarettenetui hin. Er trug einen eleganten Tweedanzug mit einem drapierten Ziertaschentuch, und das gab ihm das Air eines Schauspielers. Seine Augen waren sehr blau, hart, hervortretend; die Gesichtshaut glatt, wohlgenährt, fleischige Ohren. Er erdrückte mich etwas.
«Würde es Ihnen etwas ausmachen, nach Noirmoutier zu fahren?» fragte er.
«Nein. Ich fahre nicht sehr oft hin wegen der Gois. Es ist so ein Zeitverlust, wenn man auf der anderen Seite durch die Flut festgehalten wird. Aber wenn es nötig ist …»
Er beobachtete mich bewegungslos. Er hörte kaum zu.
«Haben Sie schon einmal wilde Tiere behandelt?»
«Wilde Tiere? Na, was denken Sie! Sogar Stiere habe ich behandelt.»
«Nein», sagte er mit einem kaum wahrnehmbaren Zeichen der Ungeduld. «Darum handelt es sich nicht. Es geht um einen Geparden.»
Dieses Wort schreckte mich auf. Es tat mir weh. Ich zuckte die Schultern.
«Wollen Sie mir bitte erklären …»
«Natürlich.»
Er schob seinen Hut zurück und setzte sich auf die Ecke des Tisches.
«Mit zwei Worten: Ich bin Chirurg in Brazzaville. Ich habe gerade einige Monate in Frankreich verbracht und jetzt vor meiner Rückreise in Noirmoutier eine Freundin besucht, Madame Heller …»
Er suchte mit den Augen einen Aschbecher, vielleicht wollte er sich einen Halt geben. Ich hatte den Eindruck, daß er widerwillig sprach. Er fuhr fort:
«Eine seltsame Frau. Sie ist in den Kolonien geboren. Ich hoffe, dieses Wort erschreckt Sie nicht. Sie hat da unten gelebt, dort geheiratet. Sie ist wahrhaftig eine Afrikanerin. Und dann ist sie nach dem Tode ihres Mannes im vorigen Jahr nach Frankreich gegangen.»
«Nach Noirmoutier?»
Vial lächelte:
«Ihr Einwand ist berechtigt. Ich könnte sie mir eher in Paris vorstellen. Sie ist sehr gebildet, malt ganz vortrefflich. Aber sie hat kein Vermögen. Sie besaß nichts als dieses alte Haus, das sie von ihrem Mann geerbt hat. Also mußte sie sich bescheiden …»
«Trotzdem, Noirmoutier nach Brazzaville!»
«Es blieb ihr nichts anderes übrig», sagte Vial trocken. «Sie ist übrigens nicht unglücklich. Sie werden sehen, daß der Platz sehr hübsch ist. Das Haus steht in einem Pinienwald.»
«Dem Bois de la Chaise?»
«Ja, ich glaube. Von ihrem Atelier aus sieht Miriam das Meer, die Küste.»
Er hatte ‹Miriam› gesagt, ganz mechanisch. Er war also gewöhnt, sie Miriam zu nennen. Aber das bewies nichts.
«Und der Gepard?» fragte ich.
«Ja, der Gepard ist krank. Ich hatte ihr dieses Tier zum Abschied geschenkt. Ich wollte, daß sie etwas Lebendiges hat, das sie an Afrika bindet. Vielleicht hatte ich unrecht. Jetzt ist Nyété krank. Ich weiß nicht, was sie hat. Sie ist ein Weibchen, und die Weibchen sind zarter als die Männchen, sensibler. Ich habe den Eindruck, daß sie sich hier nicht eingewöhnen kann. Madame Heller versteht nicht, sie zu behandeln, meiner Ansicht nach jedenfalls. Ich möchte gern, daß Sie einmal hingehen. Verstehen Sie, für mich bedeutet dieses Tier etwas mehr als ein Gepard.»
Ja, ich begann zu verstehen. Vial erhob sich.
«Werden Sie hingehen?»
«Ja, morgen früh.»
«Danke.»
Er schien erleichtert und bemühte sich, herzlich zu sein.
«Sie erreichen mich in Sables d’Olonne, im Hôtel Remblai. In zehn Tagen fahre ich. Berichten Sie mir …»
Er verbesserte sich sofort.
«Sagen Sie mir, ob Sie etwas machen können. Natürlich trage ich die Kosten.»
Er wandte sich zur Tür, nun wieder ganz gelassen, ganz ein großer Herr.
«Eine undankbare Aufgabe, was ich da von Ihnen verlange. Aber Nyété ist sehr sanft. Ich bin überzeugt, daß Sie keine Schwierigkeiten haben werden.»
Er suchte nach einem letzten liebenswürdigen Wort, das er aber nicht fand, und drückte mir die Hand.
«Auf bald. Hôtel Remblai.»
Er fuhr geräuschlos an, und ich schloß das Tor. Ein Gepard! … Sicher eine Art Jaguar. Ich hatte bestimmt keine Angst, aber ich bereute es fast, Vial zugesagt zu haben.
«Du kannst auftragen!» rief ich Eliane zu, als ich in mein Arbeitszimmer hinaufging.
Ich blätterte in einigen Büchern und fand bald einen kurzen Artikel:
Gepard: Fleischfresser der Gattung Großkatze. Der Gepard, auch Jagdleopard oder Mähnenleopard genannt, ist in Südasien und Afrika zu Hause. Er ähnelt einer Riesenkatze, kann aber wie ein Hund abgerichtet werden. Sein Fell ist von einem falben Gelb und mit runden schwarzen Flecken bedeckt. Er ist 1 m lang. Er besitzt die Kraft, die Geschmeidigkeit und das kräftige Gebiß der Katzen, aber er hat nicht ihre spitzen Krallen und ihre Wildheit. Sein Haar ist gekräuselt wie das eines Hundes. Man nennt ihn auch Tschitah.
Ich schaute hoch: am nächtlichen Horizont blinkten die Leuchtfeuer der Insel. Es war gar keine Frage, ich mochte Vial nicht. Ich stellte fest, wann Niedrigwasser war: sechs Uhr fünfzehn. Der Vormittag war also hin. Meine Laune war nicht die beste, als ich mich zu Eliane setzte. Neugierige Fragen hatte ich jedoch nicht zu befürchten. Eliane fragte nie.
Ich habe vorhin geschrieben, daß ich Ihnen nicht mein Leben erzählen will. Aber gewisse Einzelheiten muß ich doch genau angeben. Sonst glauben Sie mir am Ende nicht. Ich fühle, daß jede Kleinigkeit zählt. Ich hätte Ihnen zum Beispiel unser Haus beschreiben sollen. Am Ausgang von Beauvoir führt die Straße zur Gois hinunter. Sie schlängelt sich zwischen den Salzteichen hindurch, beschreibt seltsame Kurven wie ein Bergpfad in einer tellerflachen Ebene. Hier und da liegen, wie zufällig hineingesetzt, Bauernhöfe, weißgetünchte Häuser, Schuppen oder Scheunen, deren Türen mit einem großen weißen Kreuz geschmückt sind. In der Bretagne stellt man Kruzifixe an den Wegkreuzungen auf. Hier malt man Kreuze an die Türen. Warum habe ich mich nicht in Beauvoir niedergelassen, das doch ein ganz bedeutender Flecken ist? Ich glaube, weil die gewaltige Traurigkeit dieser nackten Landschaft mein Herz anrührte. Einleuchtende Ausreden hatte ich genug zur Hand, um Eliane zu überzeugen. Das Gehöft Saint-Hilaire war für ein Butterbrot zu kaufen. Es lag günstig, ein bißchen ab von der Straße. Es hatte Nebengebäude, wo ich später Zwinger einrichten wollte. Ich würde den Garten instandsetzen lassen, den Brunnen zudecken, die Außenwände kalken … Eliane hörte mir mit dem kleinen nachsichtigen Lächeln der Frau zu, die sich nicht täuschen läßt.
«Wenn du es gerne möchtest», sagte sie.
Ja, ich wollte dieses Haus. Es war groß, hell, bequem. Es hatte einen Hintereingang, durch den ich gehen und kommen konnte, ohne jemand zu stören, ohne großen Schmutz zu machen. Ich hatte einen ganzen Flügel für mich allein und konnte von meinem Arbeitszimmer im ersten Stock durch das eine Fenster die unendliche Weite des Meeres sehen und durch das andere das unendlich weite Land. Das Meer, gelb und grün; das Land, grün und gelb. Ich kam mir vor wie ein Matrose, der in seinem Krähennest hängt, und aus der unendlichen Weite stieg irgend etwas unbestimmt Berauschendes und Schmerzliches auf. Eliane würde mich nicht verstanden haben, wenn ich versucht hätte, ihr zu erklären, was ich empfand. Ich habe es selbst nie klar gewußt. Ich liebte, so scheint es mir, die unvollendete Küstenlinie dieses Landes, die langsam aus dem Wasser aufstieg. Ich nahm teil an einer Art Genesis. Wenn ich manchmal morgens unter dem feinen Nieselregen durch die Felder ging und im Nebel auf den Deichen unbewegliche Pferde stehen sah, den Hals nach dem Meer gereckt, hatte ich das Gefühl, ein Mensch am Anfang der Zeiten zu sein. Die Tiere kamen durch das Gras auf mich zu. Ich begrüßte sie und sprach mit ihnen. Die Erde, der Regen, die Tiere, ich selber, wir waren eins, alles war der gleiche Urstoff. Eliane hätte mich nachsichtig verspottet, wenn ich zu ihr darüber gesprochen hätte. Sie ist nicht dumm. Aber sie ist eine Frau aus dem Osten. Mir ist durchaus klar, daß sie hier entwurzelt ist. Schon mein Beruf war nicht nach ihrem Geschmack. Wenn ich ihrem Rat gefolgt wäre, hätte ich mich in Straßburg niedergelassen und gegen hohes Honorar Katzen und Hunde behandelt. Ich würde zu einem dieser heruntergekommenen Ärzte geworden sein. Nein. Ich erstrebte etwas Besseres, und deswegen entschloß ich mich auch, sofort zuzugreifen, als ich eines Tages in einem Fachblatt las, daß in Beauvoir ein Tierarzt gesucht wurde. Auch das Haus kaufte ich so, nur meiner innern Stimme folgend. Eliane fand sich damit ab. Da ich gut verdiente, konnte ich ein großes Umbauprogramm vornehmen: Ölheizung, moderne Küche, Fernsehen. Eliane konnte beinahe glauben, sie sei in Straßburg. Beinahe … In Wirklichkeit fühlte sie sich fremd. Vergeblich riet ich ihr, doch auszugehen.
«Wohin soll ich gehen?»
«Ich möchte nicht, daß du dich langweilst.»
«Ich langweile mich nicht.»
Sie pflanzte Blumen, nähte, strickte, las oder zwang sich zu einem kurzen Radausflug, um mir eine Freude zu machen. Da wir noch kein Telefon hatten – seit Monaten schon vertröstete man uns, und meine Reklamation blieb erfolglos –, machte ich zweimal wöchentlich in Beauvoir die Einkäufe: Fleisch, Kolonialwaren, Gemüse. Wenn Eliane sich nicht wohl fühlte, half eine alte Frau aus, die uns gegenüber in einem baufälligen Haus wohnte. Sie war siebzig Jahre alt, und alle Welt nannte sie Mutter Kapitän. Vielleicht war das auch ihr richtiger Name. Freunde hatten wir kaum. Ich war so selten zu Hause! Natürlich kannte ich alle und jeden. Ich redete mal hier, mal dort. In meinem Beruf muß man ‹schwatzhaft› sein. Aber ich war mit niemand enger vertraut, und ich wüßte nicht leicht zu sagen, warum es so war; nicht etwa, daß ich ein verschlossener Mensch bin – im Gegenteil, ich bin eher gesellig. Aber selbst die freundschaftlichsten Gespräche langweilen mich sehr schnell. Sie dreschen nur leeres Stroh. Die Natur hier lehrt Stunde für Stunde, jahraus, jahrein alles, was sich zu wissen lohnt. Die Winde und das Licht, die Erde und der Himmel halten ständig Zwiesprache miteinander. Mutter Kapitän pflegte zu sagen: «Der Regen leistet mir Gesellschaft.» Ich bin vom gleichen Stamm wie sie. Ich höre zu, wie das Leben vorbeirinnt. Und ohne Zweifel trage ich ein ängstliches Gesicht zur Schau, das die Leute so oft täuscht.
«Will es heute morgen nicht recht gehen, Monsieur Rauchelle?»
«Doch, doch, es geht sehr gut.»
Ich weiß, daß sie hinter meinem Rücken flüstern: «Er arbeitet zuviel … Er wird es nicht durchhalten … Und seine Gesundheit ist ohnehin nicht die beste!» Ich weiß das alles und daß sie auf dem Holzweg sind. Jedenfalls dachte ich, daß sie auf dem Holzweg seien. Heute grüble ich über mich nach. Es wäre soviel besser gewesen, wenn ich wie sie wäre, mit ihrem gesunden Menschenverstand, der sich mit der Oberfläche der Dinge begnügt!
Aber ich komme wieder auf Eliane zurück. In stillschweigendem Einverständnis sprachen wir nie von meiner Arbeit. Eliane beklagte sich über nichts. Wenn ich todmüde nach Hause kam, zog ich einen sauberen Anzug an und ging in den anderen Teil des Hauses, wo Eliane mich erwartete. Ich küßte sie. Sie strich mir sanft über die Wange, um mir zu zeigen, daß sie sich mir zugehörig fühlte, mein Verbündeter blieb, meine Schwierigkeiten teilte, und dann nahm sie mich mit ins Eßzimmer. Der Tisch war immer mit Blumen geschmückt und das Essen schmackhaft. Fast nie gab es Fisch. Eliane konnte ihn nicht zubereiten. Aber es gab Fleisch, zurechtgemacht auf zwanzigerlei verschiedene Weise. Gerichte aus ihrer Heimat, die mich müde machten. Dann döste ich vor mich hin, während sie das Fernsehprogramm sah.
Ich hätte mich gern unterhalten. Aber so, wie sie nicht wußte, wohin sie spazierengehen sollte, so wußte ich nicht, was ich sagen sollte. Mit einem Wort, ich fand es gut, hier zu sein, und sie wußte, daß ich mich wohlfühlte, und das schuf zwischen uns eine friedliche, durchdringende, manchmal etwas melancholische Stille. Vielleicht muß jedes Glück einen solchen Beigeschmack von Trauer haben. Ich versuche, diese Eindrücke festzuhalten. Alles dies ist wichtig, und alles dies zerreißt mir das Herz, nun, da es vorbei ist. Ich sehe uns wieder vor mir, wenn wir schlafen gingen. Das Schlafzimmer war mit viel Geschmack eingerichtet. Es war das Werk eines Dekorateurs aus Nantes. Anfangs kam es mir ein wenig zu schön vor, es erinnerte mich an einen Katalog. Aber nach und nach hatte es sich uns angepaßt wie ein Kleidungsstück. Ich zog den Wecker auf, während Eliane ihre Haare für die Nacht zurechtmachte. Manchmal hielt ich mitten in einer Bewegung inne. Was! Ich war dreißig Jahre alt und lebte schon wie ein Greis. Nein, doch nicht. Eher wie ein Soldat. Ich hatte eine gewisse Disziplin auf mich genommen, ich hatte mich nicht Gewohnheiten unterworfen. Und Eliane …? Aber warum hätte ich sie mit sinnlosen Fragen quälen sollen? Ich löschte das Licht. Ich schloß die Fensterladen nür, wenn draußen die Stürme tobten und die Gischt über die Wiesen getrieben wurde. Ich liebte es, vom Bett die Sterne zu sehen und den Widerschein der Leuchttürme, in so schneller Folge, daß es phantastisch wirkte. Und dann …? Da ich mich entschlossen habe, alles zu sagen, muß ich auch diesen wesentlichen Punkt berühren. Die Liebe, das heißt die körperliche Liebe, nahm in unserem Leben keinen großen Platz ein. Sie war ein einfacher Ritus, durchaus angenehm. Eliane paßte sich an, wie an alles übrige auch. Sie hielt Genuß für einen Teil des Komforts. Sie gab sich mir hin, gewissenhaft, pünktlich, ohne Begeisterung, und sobald die Begierde gestillt war, schliefen wir schnell ein, nach einem letzten sittsamen Kuß.
So ähnlich vergingen alle unsere Tage und Nächte. Ich arbeitete viel. Meine Geldkassette füllte sich mit Banknoten, die ich jeden Monat auf die Bank trug. Ich hing nicht sehr am Geld. Ich war nicht ehrgeizig. Ich lebte nur für meinen Beruf. Hier muß ich noch einmal erläutern: Ich war in keiner Weise ein Wissenschaftler. Mein Studium hatte mich oft genug gelangweilt. Aber ich besaß, und zwar in einem ziemlich erstaunlichen Maß, die richtige Hand. Es fällt mir schwer, Ihnen zu erklären, was das bedeutet. Sie haben sicher schon von Rutengängern gehört; sie haben einen besonderen Sinn für das Wasser: sie fühlen es. Sie bleiben über Wasseradern unbeweglich stehen wie die Nadel auf dem magnetischen Pol. Ich hatte die Hand eines Heilkundigen. Meine Hände fanden instinktiv das kranke Organ, und das Tier ließ sogleich alles mit sich geschehen. Zwischen ihm und mir entstand eine Verbindung, ein Austausch, ich kann es nicht besser ausdrücken. Sicher ist das alles nicht sehr klar, aber die Wahrheit ist oft nicht klar, sie kann sogar unglaubwürdig erscheinen, wie Sie sehen werden. Das eine ist jedoch sicher, bei Tieren nahm ich Verbindung auf mit meinem wahren Sein. Ich kam heraus aus dieser Verschwommenheit, diesem Nebel, in dem meine Gedanken sich zu gern verloren. Ich konzentrierte mich. Ich wurde ungewöhnlich angespannt. Ich wurde zum Hund, Pferd oder Ochsen. In meinem Fleisch fühlte ich ihr Fleisch. Ich nahm sie durch meinen Körper wahr, und ich heilte mich durch ihren Körper. Ich glaube, daß die Musiker, die echten, etwas Ähnliches empfinden müssen, und es ist bestürzend. Darin liegt eine Freude, von der man nie genug bekommen kann. Es fällt mir schwer, Männer, Frauen, Menschen zu verstehen wegen dieser Wolke von Worten und Begründungen, mit der sie sich umgeben. Die Tiere sind nur Liebe und Leiden. Ich war der Schäferhund des Gebietes, das abgerichtete Tier, das den anderen Tieren das Leben erhielt.
Diese Worte wirken aufreizend, aber wahrscheinlich wende ich sie zum letztenmal an. Ich werde nie mehr in die Marsch zurückkehren. Ich habe diesen langen Einschub nur gemacht, damit Sie besser die Gefühle verstehen können, die mich nach dem Besuche Vials bewegten. Ein Gepard! Ich gebe zu, daß ich beunruhigt war. Ich hatte Angst, der Sache nicht gewachsen zu sein. Und wenn ich scheiterte, dann wäre es mit meiner Sicherheit zu Ende und mit meinem Glauben an mich selber, der meinen Tieren die Lebenskraft einflößte, so daß die Medikamente ihre Wirkung entfalten konnten. Das Wort Gepard hatte für mich einen unangenehmen Klang. Es hatte etwas Tückisches und Boshaftes. Ich aß schnell und schrieb, ehe ich schlafen ging, auf meinen Block: M.H. Ich hätte auch schreiben können: Miriam Heller. Warum die Initialen? Vorahnung? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich, daß ich laut vor mich hinbrummte: «Er hätte mir auch eine genauere Adresse angeben können.» Dann betrachtete ich den Himmel. Das Wetter war schön. Ich würde drei gute Stunden Zeit haben, mehr als genug, um ohne Risiko hin- und zurückzufahren.
Ich entschuldige mich noch einmal, daß ich hier einige unerläßliche Aufklärungen einfügen muß. Aber wer die Gois noch nicht gesehen hat, kann dem Verlauf der Erzählung nicht folgen. Und ich zweifle, daß Sie sich je in dieser Ecke der Vendée verloren haben, die im Winter verlassen und auch im Sommer ohne besondere Schönheit ist. Die Insel Noirmoutier ist mit dem Festland durch eine vier Kilometer lange Straße verbunden, die bei Flut immer wieder vom Meer bedeckt wird. Aber diese Straße ist anders als jede andere Straße. Sie schlängelt sich wie eine Piste durch den Sand, ist an bestimmten Stellen durchaus eine Straße, an anderen nur ein immer feuchter, schlechter Weg. Man nennt sie: die Gois. In regelmäßigen Entfernungen sind Pfähle gesteckt, die bei Flut ihren Lauf markieren. Sie ist praktisch nur etwas länger als drei Stunden befahrbar, nämlich bei Ebbe. Sobald der Südwestwind die Flut in die enge Hafeneinfahrt von Fromantine treibt, muß man aufpassen: das Meer kommt sehr schnell zurück, und da die Wagen nur im Schritt vorankommen, riskiert der unvorsichtige Fahrer, mitten in der Furt überrascht zu werden. Dann gibt es nur einen Ausweg: den Wagen zurückzulassen und nach der nächsten Schutzbake zu laufen, von denen es drei gibt. Es sind geländerumgebene Plattformen, die auf ihren Pfeilern über sechs Meter hoch aufragen und wie Galgen auf kegelförmigen Sockeln verankert sind. Bei Hochwasser steht das Meer höher als drei Meter auf der Gois. Ich hatte Vial nicht gesagt, daß mir die Gois eine Art Schrecken einflößte. Ich mußte sie trotzdem befahren, denn ich hatte stets einige Fälle auf der Insel, aber ich fuhr immer widerwillig hinüber. Es kamen übrigens ziemlich häufig Unfälle vor, trotz der Schilder, die an beiden Enden die Ebbezeiten angaben.
Um sechs Uhr machte ich mich mit meinem kleinen Citroën auf den Weg. Außer meinem Arztbesteck nahm ich ein Köfferchen mit, das eine ganze Anzahl Medikamente enthielt. In dieser Jahreszeit lag die Gois verlassen. Noirmoutier war nur ein lila Strich am Horizont. Man ahnte das Meer weit hinten am Rande des Schlicks, wo die Möwen sich tummelten. Weit in der Ferne, irgendwo in der Nähe der kleinen Insel Piliers, hörte man das dumpfe Tuten eines Dampfers, der die Einfahrt in die Loire suchte. Ich habe es noch im Ohr. Dieser Morgen war ganz und gar nicht wie die anderen Morgen. Ich war etwas besorgt. Ich fühlte mich jedoch sicher und war beinahe fröhlich wegen der scharfen Luft und dieses weiten, feierlichen Raumes, in dem ich mich tastend zwischen den Wasserlöchern vorwärtsbewegte. Die Lampen der Baken verblaßten im Licht der Morgendämmerung. Ich vermied, so gut es ging, die Löcher und das Hochspritzen des Salzwassers auf den Motor: für mich ist eine Maschine etwas Lebendiges, das ich sorgfältig pflege. Manchmal spürte der tapfere kleine Wagen festen Boden, und ich ließ ihm freie Fahrt. Ungefähr in der Mitte fuhr ich rechts ran, um den Bus nach Nantes vorbeizulassen, dessen Anhänger hin und her schleuderte. Milsant, der Fahrer, winkte mir einen Gruß zu. Dann stieg die Straße etwas an, und ich fuhr auf die Insel. Von Bois Gaudin nach Noirmoutier sind es nicht einmal fünfzehn Kilometer. Ich legte sie ohne Eile zurück. Alles schlief noch in Guérinière, und mir wurde plötzlich klar, daß ich zu früh bei Miriam eintreffen würde. Deswegen hielt ich am Hafen in Noirmoutier und trank einen Kaffee in einem Bistro, wo Fischer die Köpfe zusammensteckten und sich unterhielten. ‹Da der Gepard einer großen Katze ähnelt›, dachte ich, ‹wird das, was für eine Katze gilt, auch für ihn gelten. Wenn dieses Tier auch in Afrika geboren ist …› Aber dann dachte ich an die Vorlesungen unseres Biologieprofessors. Er behauptete, daß die Umwelt einen ungeheuren Einfluß auf die Tiere ausübe, genau wie auch auf die Menschen. «Vergessen Sie nie, meine Herren», schloß er, «die Heimat … das ist der springende Punkt!»
Ich sah auf die Uhr und ging hinaus. Ich war wieder beunruhigt, fühlte mich nicht wohl. Es drängte mich, bald wieder zurückzufahren. Der Wald von Chaise ist der Rest eines ausgedehnten Pinienwaldes, der früher wohl den ganzen Norden der Insel bedeckte. Die schönsten Villen lagen in diesem Wald, am Rand der Bucht von Bourgneuf, vor den Seewinden geschützt. Aber es gab da eine Unmenge von Besitzungen. Es würde nicht ganz einfach sein, die von Madame Heller herauszufinden. Ich ging in einen Laden. Madame Heller? Man sah mich mißtrauisch an. Nein, man hatte nie von dieser Dame gehört. Auch in der Bäckerei hatte ich nicht mehr Glück.
«Sie malt, sagen Sie? Wie sieht sie aus?»
«Ich weiß nicht. Ich habe sie nie gesehen.»
Dann kam mir die Idee, mich an den Fleischer zu wenden.
«Ach, das ist doch die mit dem Panther!» rief er. «Villa Maud … Sagen Sie, sind Sie nicht der Tierarzt aus Beauvoir?»
«Ja.»
«Dachte ich es mir doch …. Ich habe Sie einmal bei den Mazeau getroffen.»
«Ja, richtig.»
Ich ließ ihn ruhig reden, weil ich wohl wußte, daß er gesprächiger als Vial sein würde.
«Das ist eine gute Kundin», sagte er. «Sie ist nicht sparsam. Sie muß wohl auch recht begütert sein, denn so ein Tier, es ist toll, was das frißt.»
«Es ist ein Gepard», berichtigte ich, «kein Panther.»
«Ach, für mich gibt es da keinen Unterschied. Allen beiden würde ich eine Kugel in den Bauch jagen. Oder ich gäbe sie in einen Zoo … Aber so etwas im Hause haben? Sie hat einen Stich, die gute Frau.»
Und als ich lächelte, packte er mich am Revers meiner Windjacke und senkte die Stimme, obgleich der Laden leer war.
«Allen Ernstes», murmelte er, «sie ist verrückt. Eine Frau, die Sie tagsüber nie zu Gesicht bekommen. Sie geht nur nachts aus. Finden Sie das vielleicht normal?»
«Sie ist eine Künstlerin. Da muß man großzügig sein. Sie malt.»
«Sie malt! Sie malt! Ist das ein Grund? Stellen Sie sich vor, sie bezahlt mich per Scheck, anstatt herzukommen wie alle anderen. Für wen hält sie sich, hm? Schließlich ist man ja kein Wilder. Und warten Sie … das Schönste habe ich Ihnen noch gar nicht gesagt …»
Eine alte Frau betrat den Laden. Der Fleischer ließ mich los.
«Kommen Sie auf dem Rückweg noch mal herein! Dann trinken wir einen.»
«Aber wie komme ich zur Villa Maud?»
«Fahren Sie bis zur alten Zollschranke und dann die große Allee nach links. Es ist das letzte Haus.»
Unterwegs begann ich schon, mir Miriam vorzustellen. Es war das erste Mal, daß ich mir Mühe gab, ihre Gestalt, ihr Gesicht zu beschwören. Sicher war sie jung, etwas überspannt, so wie alle diese jungen Frauen, die im Sommer mit hoher Geschwindigkeit durch Beauvoir rasten. Von vornherein hatte ich eine Abneigung gegen sie. Und außerdem war ich überzeugt, daß sie Vials Geliebte gewesen war. Aber schließlich, was ging mich das an.
Ich fand schnell die Villa Maud. Es war ein einstöckiges Haus im Stil der Jahrhundertwende mit gedrechselten Holzverzierungen. Ein bißchen vernachlässigt sah es aus. Die Fensterladen waren geschlossen. Ich schob das Tor zurück und betrat den Garten. Es war übrigens kein richtiger Garten, sondern eher ein Stück steiniger Heide mit einigen herrlichen Pinien. Drei Stufen führten zum Haus. Ich suchte eine Klingel. Keine Klingel. Ich klopfte leise. Nichts. Miriam und ihr Gepard schliefen. Ich ging um das Haus herum und sah das Meer durch die Pinien schimmern. Auf dieser Seite lief ein sehr breiter Holzbalkon am Haus entlang. Ein Liegestuhl stand neben einem kleinen Tisch. Der Wind blätterte die Seiten eines offenen Buches, das vergessen auf dem Tisch lag. Ich ging zur Treppe zurück und rief:
«Ist da niemand?»
Gerade als ich die Stufen wieder hinuntergehen wollte, ging plötzlich die Tür auf, und ich sah eine Negerin.
2
SIE WAR UM DIE FÜNFZIG, kurz und aufgeschwemmt, mit einem Mopsgesicht und feuchten, sanften Augen. Nein, das war nicht möglich! Ich brachte kein Wort heraus. Schließlich stammelte ich:
«Entschuldigen Sie. Ich komme im Auftrag von Dr. Vial.»
«Treten Sie ein. Ich werde Madame Bescheid sagen.»
Natürlich, ich hätte mir denken können, daß Miriam eine Dienerin hatte. Aber als ich das Wohnzimmer betrat, war ich immer noch ganz durcheinander, und mir wurde klar, wie sehr mich dieser Besuch beunruhigte und aus der Bahn warf. Seit dem letzten Abend stand er mehr oder weniger bewußt im Mittelpunkt meiner Gedanken. Und nicht nur wegen des Geparden. Mir war, als sei meine Sicherheit in Gefahr. Alles war nur ganz verschwommen und flüchtig. Ich neige jetzt natürlich dazu, manches überzubewerten, das ist unvermeidlich. Aber schon damals – wie soll ich das sagen – war ich auf der Hut. Ich sah mich mißtrauisch in dem Zimmer um, in das ich geführt worden war. Es bot nichts besonders Bemerkenswertes. Ein altmodischer Salon, feucht und dunkel, nicht sehr sauber. Ein geschlossenes Klavier stand an der Wand, darüber hing die Fotografie eines bärtigen Mannes in der Uniform eines Artilleristen. Auf dem Tisch drei vertrocknete Mimosenzweige. Der Fußboden knarrte, und ich wagte nicht, hin und her zu gehen. Über mir hörte ich Stimmengemurmel. Ich bückte mich und hob unter einem Stuhl ein kleines Büschel roter Haare auf. Nyété hatte sich dort herumgetrieben. Die Haare waren lang, fühlten sich rauh an, an der Wurzel waren sie weiß, sicher Haare vom Oberschenkel.
Ich sah auf die Uhr: zehn vor acht. Die da oben ahnten wohl nicht, daß ich es eilig hatte. In diesem Augenblick knarrte die Treppe, und ich wußte, daß sie es war. Doch als sie eintrat, war ich einer neuen Überraschung ausgesetzt: Vor mir stand eine große schlanke Frau, die einen pflaumenblauen Morgenrock trug. Und was mir am meisten auffiel, war ihre kühle Vornehmheit. Ganz unbegründet hatte ich auf ein frivoles, leichtfertiges Wesen gewartet; ich stand vor einer Dame. Mir ist klar, daß dieses Wort sehr übertrieben und naiv klingen kann. Aber es gibt genau meinen ersten Eindruck wieder. Und weil ich schüchtern bin, zeigte ich mich sofort schwerfälliger, bäuerlicher, brummiger als sonst. Ich begrüßte sie mit einem kurzen Kopfnicken.
«Rauchelle», sagte ich, «Tierarzt aus Beauvoir. Dr. Vial hat mich geschickt.»
Sie lächelte und war eine andere Miriam, plötzlich einfach, liebenswürdig, mädchenhaft. Sicher war sie um die Vierzig, aber wenn sie so lächelte, wurde sie sofort zu einem großen Spielkameraden. Sie gab mir ohne Umstände die Hand. Ihre grauen Augen blitzten vor Interesse, Aufmerksamkeit, Herzlichkeit.
«Und Sie haben diesen ganzen Weg gemacht», sagte sie. «Phillippe ist lächerlich. Ich bin untröstlich, daß Sie sich wegen nichts solche Mühe gemacht haben. Nyété hat Heimweh. Sie wird es überwinden …»
Ich spürte sofort an einem Schwanken ihrer Stimme, daß auch sie an Heimweh litt, an einem unheilbaren Schmerz.