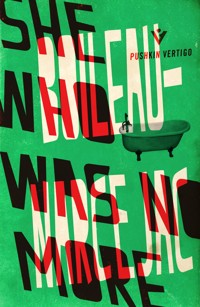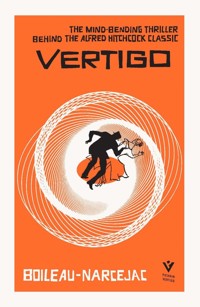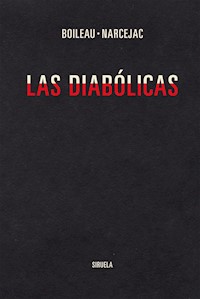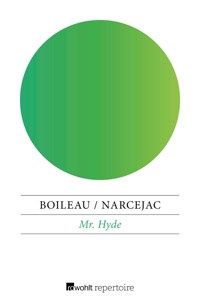4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Viele Jahre lang hat Raoul de Lespinière in dem abseits gelegenen, düsteren Haus in seiner erst schal, dann allmählich unerträglich gewordenen Ehe ausgehalten – einsam, in sich gekehrt, verbittert. Er ist zu alt für einen Aufbruch zu neuen Ufern. Dann aber … Es ist wie ein Wink des Schicksals: Dann trifft er zufällig seine verschollene Jugendliebe wieder. Und er beschließt spontan auszubrechen, seiner tristen Welt den Rücken zu kehren, mit der Wiedergefundenen ein neues Leben zu beginnen. Und sie willigt ein. In aller Heimlichkeit schmiedet er Pläne, besorgt Fahrkarten, Flugtickets, setzt den Termin fest … Aber als es soweit ist, kommt er nicht zum vereinbarten Treffpunkt. Er schickt auch keine Nachricht. Er ist spurlos verschwunden. Sein Sohn, ein paar Tage später krank aus den Tropen zurückgekehrt, muß diese spärlichen Fakten mühsam ermitteln. Aber sie sagen nichts aus über das Schicksal seines Vaters: Unfall? Selbstmord? Mord? Aber wo ist dann die Leiche?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Pierre Boileau • Thomas Narcejac
Ohne Spuren
Aus dem Französischen von Stefanie Weiss
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Viele Jahre lang hat Raoul de Lespinière in dem abseits gelegenen, düsteren Haus in seiner erst schal, dann allmählich unerträglich gewordenen Ehe ausgehalten – einsam, in sich gekehrt, verbittert. Er ist zu alt für einen Aufbruch zu neuen Ufern.
Dann aber …
Es ist wie ein Wink des Schicksals: Dann trifft er zufällig seine verschollene Jugendliebe wieder. Und er beschließt spontan auszubrechen, seiner tristen Welt den Rücken zu kehren, mit der Wiedergefundenen ein neues Leben zu beginnen. Und sie willigt ein.
In aller Heimlichkeit schmiedet er Pläne, besorgt Fahrkarten, Flugtickets, setzt den Termin fest … Aber als es soweit ist, kommt er nicht zum vereinbarten Treffpunkt. Er schickt auch keine Nachricht. Er ist spurlos verschwunden.
Sein Sohn, ein paar Tage später krank aus den Tropen zurückgekehrt, muß diese spärlichen Fakten mühsam ermitteln. Aber sie sagen nichts aus über das Schicksal seines Vaters: Unfall? Selbstmord? Mord?
Aber wo ist dann die Leiche?
Über Pierre Boileau • Thomas Narcejac
Die beiden französischen Autoren Pierre Boileau (1906–1989) und Thomas Narcejac (1908–1998) haben zusammen zahlreiche Kriminalromane verfasst. Ihre nervenzerreißenden Psychothriller haben viele Regisseure zu spannenden Filmen inspiriert, am bekanntesten sind wohl «Die Teuflischen» und sein amerikanisches Remake «Diabolisch» und «Vertigo – Aus dem Reich der Toten», sicher einer der besten Filme von Alfred Hitchcock.
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
Raoul de Lespinière
(Geldadel) versetzt eine verloren geglaubte Geliebte, läßt Flugtickets verfallen und verschwindet spurlos. Seine Frau
Sabine
kann ihn nicht ausstehen, bewahrt aber als geb. de Courtenay (Uradel) die Contenance. – Beider Sohn
Denis
leidet an Amöbenruhr und unter dem ungewissen Schicksal seines Vaters. Das stört
Ingrid Belleau
nicht weiter, denn sie ist schlichteren Gemüts und liebt Denis – was ihrem Kotzbrocken von Ehemann
Roger
(gar kein Adel, aber er stinkt vor Geld) begreiflicherweise nicht paßt.
Claire de Lespinière
liebt ihren Bruder gleichfalls; sie ist bildschön, kleptoman und geistig zurückgeblieben – während
Françoise Hinkle
clever genug ist, um immer darauf zu achten, daß ihr Brot nicht auf die Butterseite fällt. – Das alte Dienerehepaar
Désiré und Eugénie Fouchard
(«Domestikenadel», sozusagen) wissen unterschiedlich viel und sagen einhellig wenig. – Und schließlich ist da noch
die Brière
zu nennen – zwar keine Person, jedoch eine Landschaft, von der die meisten der Vorgenannten entscheidend geprägt sind.
Es versteht sich von selbst, daß die geschilderten Ereignisse und die auftretenden Personen frei erfunden sind.
1
Weißt Du noch, mein Lieber?
Du hast mir schon oft gesagt: ‹Was du alles so erlebt hast, das gibt Stoff für eine umwerfende Geschichte. Wenn du mir deine Erinnerungen überläßt, dann mach ich einen Roman draus …› Tja, und jetzt nehme ich Dich beim Wort. Ich habe Dein letztes Buch gelesen. Ausgezeichnet! Ich verlasse mich also auf Dich. Wenn Du’s versuchen willst – ich stehe Dir zur Verfügung. Zeit spielt für mich ja – leider! – keine große Rolle mehr. Wenn Du wüßtest, wie leer meine Tage sindl
Aber Du darfst keinen geordneten Bericht von mir erwarten. Nicht, daß ich Dir nun alles vorsetzen werde, was mir gerade in den Sinn kommt; Du mußt mir jedoch schon erlauben, daß ich mich beim Schreiben gehen lasse. Was mir im Augenblick vor allem guttut, das ist, mich reden zu hören. Ich bin so furchtbar allein … Zu entscheiden, was gebracht werden und was unter uns bleiben soll, das ist Dir überlassen. Dein Pech, wenn ich mich ab und zu wiederhole, oder vielleicht auch mal Einzelheiten vergessen habe, die Du für wichtig hältst … Später können wir das alles dann klären.
Also, gehen wir’s an. Wo soll ich anfangen? Ich werde Dir nicht auseinandersetzen, warum ich Arzt bei einer internationalen Hilfsorganisation geworden bin, ein M.S. F.[*], wie wir es nennen. Das weißt Du ja schon. Über meine ersten Erfahrungen haben wir uns früher schon unterhalten: Das Erdbeben von Lima, die Epidemie auf Madagaskar, die Massaker in Beirut … Mit siebenundzwanzig kannte ich schon alles – alle Verletzungen, Wunden und Schmerzen, die man sich vorstellen kann. Wenigstens glaubte ich das. Aber dann waren da die ‹Boat people›, und wenn’s Dir recht ist, soll meine Geschichte hier einsetzen. Und zwar mit einem Erlebnis, das mich tief erschüttert, verändert und sozusagen ‹umgeschmolzen› hat, wie das bei Menschen vorkommt, die eine Atomexplosion überlebt haben. Es hat ein Vorher und ein Nachher gegeben. Vorher war ich ein guter Routinearzt, ein Allround-Profi … Ich will Dir das kurz erläutern: Ein guter M.S.F., das ist keiner, der von Mitleid überwältigt ist und mit einemmal den Anblick von Hunger, Elend und Vernachlässigung nicht mehr ertragen kann. Es ist auch keiner, der sich wie ein Missionar dazu berufen fühlt, sein Leben in den Dienst eines humanitären Ideals zu stellen. Und er ist schon gar nicht einer jener warmherzigen Abenteurer, die wie Forscher auf der Suche nach dem Elend sind. Ich brauche wohl nicht eigens zu erwähnen, daß der M.S.F. niemals Partei ergreift oder bedingungslos und ausschließlich für die Dritte Welt ist. So nämlich stellt sich die breite Öffentlichkeit uns vor, wenn sie durch eine zufällig aufgeschnappte Reportage etwas über uns erfährt.
Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Bei uns ist ein guter Profi zuerst einmal ein guter und in seinem Fachgebiet versierter Arzt, der darüber hinaus auch in der Lage sein muß, in verwandten Fachbereichen etwas zu leisten. So bin ich zum Beispiel Spezialist für die sogenannten Tropenkrankheiten; wenn nötig, kann ich aber auch kleinere Operationen durchführen oder – was sein muß, muß sein – einen Anästhesisten ersetzen. Und natürlich ungeachtet der jeweiligen äußeren Umstände, das heißt der Gefahr, in die wir uns hin und wieder begeben. Der wirkliche Profi, ganz egal auf welchem medizinischen Spezialgebiet, ist einer, der seinen Beruf über alles andere stellt; der nur sagt, ich muß hin – ob es sich um einen Großbrand handelt, um ein von der Pest heimgesuchtes Dorf oder einen Verrückten, der eine Geisel genommen hat – egal, wie ich hinkomme … Doch ja, ich glaube, ich war ein guter Profi.
Und dann ging das große Auffischen los, das Auffischen von … Nein, dafür gibt es einfach keine Worte. Wir sind kreuz und quer durch den Golf geschippert wie die Männer von der Müllabfuhr. Wie durch ein Wunder hast du dann etwas daherschwimmen sehen, das weniger einem Boot als einem schwimmenden Zigeunerwagen glich, und der war voller blutiger, abgemagerter, ineinander verschlungener Gliedmaßen; tote Gesichter starrten dich aus weitgeöffneten Augen an. Und dann die Fliegen, selbst hier auf hoher See … Diese Wracks kündigten sich schon von weitem durch einen gräßlichen Gestank an – kein richtiger Verwesungsgeruch, sondern wie von einer Deponie, von einem Abfallhaufen: das typische Gemisch von verschimmelten Lebensmitteln, faulenden Lumpen, verendeten Tieren und Ungeziefer. Der Tod ist ehrfurchtgebietend; er wird betrauert, beweint. Aber ein Müllhaufen, der wird verbrannt … Und trotzdem mußten wir darin herumwühlen, befühlen, abtasten, verlesen und das heraussuchen, was vielleicht überleben konnte … Und es blieb keine Zeit für Gefühle, weil oft schon der nächste schwimmende Zigeunerwagen am Horizont auftauchte, meist umringt von einer Runde fröhlicher Haie. Und dann war tagelang wieder nichts zu sehen … Diese Leichenwanderungen unterlagen geheimnisvollen Gesetzen.
Die Geretteten kamen übrigens meist bald wieder zu Kräften, und wir entdeckten zu unserer Überraschung – eine ziemlich dumme Reaktion übrigens –, daß der eine von Beruf Rechtsanwalt, der andere Lehrer war … Sie versuchten, uns ihre Motive klarzumachen, waren aber derart glücklich über ihre Rettung, daß sie nichts mehr sagen konnten, ohne dabei zu lachen, und wir haben von ihren Erklärungen nicht viel mitbekommen. Wir haben uns auch nicht besonders darauf konzentriert; für uns war viel wichtiger, zu erfahren, wie viele Tage sie auf See zugebracht hatten, wie sie sich ernährt hatten und dergleichen.
Wir haben Notizen gemacht, Aufzeichnungen, eine ganze Menge. Es soll nämlich keiner glauben, wir seien nur die Sanitäter in vorderster Linie, das Erste-Hilfe-Personal. Wir sind auch Sachverständige und Beobachter, von denen Berichte verlangt werden. Eine Art Himmelfahrtskommando, gewiß, aber zugleich auch Schreibstubenhengste – Buchhalter, Statistiker, Archivare des Elends … Genug davon; über die M.S.F. ist schon genug geschrieben worden.
Ich komme also zu meiner Geschichte zurück, und das ist gar nicht so einfach – es gibt fast nichts zu erzählen. Tu mir aber den Gefallen und fang auf keinen Fall an, das, was jetzt kommt, irgendwie ‹literarisch aufzubereiten›! – Also zuerst die Begegnung: Ein kleines Schiff, offen, zur Hälfte vollgeschlagen. Ein Gewirr menschlicher Leiber. Ein paar ausgemergelte Gesichter, die noch die Kraft hatten aufzusehen, wer gekommen war: Piraten? Freunde? Und die dann zurücksanken, als ob das Ausmaß des Leidens ohnehin nicht mehr übertroffen werden könnte.
Die Männer waren alle tot. Männer sind oft weniger widerstandsfähig als Frauen. Nur ein paar alte Frauen waren noch übrig; sie kauerten, gelähmt von durchlebtem Schrecken und Erschöpfung, unter verrotteten Lumpen und mahlten unablässig mit den Kiefern, wie um das zu sagen, an dem sie erstickten.
Ich war in das Boot hinuntergestiegen, um die allernötigste Hilfe zu geben, denn oft waren Schiffbrüchige in dem Augenblick gestorben, in dem sie die Rettung vor Augen hatten – wie verschüttete Erdbebenopfer, die den Moment ihrer Befreiung nicht überleben. Und dann entdeckte ich sie, unter einem Haufen dreckiger Fetzen. Ich war erschüttert. Stell Dir einen Archäologen vor, der bereits Tonnen von Geröll und Steinen beiseite geräumt hat und plötzlich auf eine unversehrte Statue stößt, die aus der Nacht und dem Nichts auftaucht. Meine Statue lag da vor mir, mit geschlossenen Augen und einem Teint wie aus Porzellan. Ein Gesicht mit eurasischen Zügen und einem sehr klaren und friedlichen Ausdruck, aus dem sich das Leben noch nicht zurückgezogen hatte. Ich gab ihr schnell eine Spritze; ihre Ärmchen waren dünn wie kleine Zweige, und ich wagte kaum zuzustechen. Mein Sanitäter hat sie dann so gut es ging in meiner Kabine untergebracht. Ich war fest entschlossen, sie zu retten … Und wie Du siehst, habe ich mich schon mehr für sie interessiert als gut war. Sie war jung – fünfzehn oder sechzehn. Und sie war schön. Das war aber nicht der Grund, warum sie mir so am Herzen lag … Ich versuche das jetzt zu verstehen. Ich glaube, sie hatte Angst vor mir, und die wollte ich ihr nehmen. Sie war wieder zu Bewußtsein gekommen, und die Art, wie sie mich ansah …
Nein, ich kann Dir das einfach nicht erklären. Sie war von den Piraten, die das Boot geplündert hatten, mehrmals vergewaltigt worden. Ich habe das von meinem vietnamesischen Pfleger erfahren; mit ihm hatte sie ein paar Worte gewechselt. Aber mit mir? Nichts. Schweigen … Dieses Schweigen hatte nichts Feindseliges; es war nicht einmal eine Verweigerung – eher die instinktive Resignation des Tieres, das sich dem Tierarzt überläßt, weil es spürt, daß der letzten Endes doch der Stärkere ist; daß es zu spät ist, sich zu wehren. Ich glaube, sie hat den Mann in mir gesehen, ich meine, den Bruder derjenigen, die sie vergewaltigt hatten. Ich mußte mit ihr umgehen wie mit einem Baby, wenn ich sie versorgen wollte. Sie ließ alles mit sich geschehen wie eine Puppe, und das bedeutete soviel wie: Du bist hier, aber ich bin ganz woanders … Sie hatte einen komischen Namen: Thi-Ngan hieß sie. Ich habe sie manchmal an den Schultern gepackt und geschüttelt:
«Thi-Ngan, trink das jetzt, zum Teufel! Du mußt mir helfen!»
Und die einzige Antwort war dieser sanfte Blick aus den großen, samtschwarzen Augen, die mich ansahen, als ob ich an alldem schuld sei.
Sie war nicht besonders schlimm dran. Sie stand einfach unter Schock, und ich hätte sie bestimmt durchgebracht, wenn es möglich gewesen wäre, sie in einem Krankenhaus unterzubringen und intensiv zu betreuen, wie es normalerweise geschieht. Was aber konnte ich auf diesem Schiff tun, das mit Kranken und Verwundeten überladen war? Wir waren zwei M.S.F. an Bord, schlecht ausgerüstet und überfordert, drei oder vier Tagereisen von der Küste entfernt. Es war schon ein Wunder, daß ich für Thi-Ngan einen etwas ruhigeren Platz gefunden hatte, und auch hier waren das Stöhnen, die Schreie und alle möglichen Rufe nicht zu überhören, die sich mit dem Stampfen der Schiffsmaschine und dem Rauschen des Meeres vermischten und ein wirkliches Ausruhen unmöglich machten. Ich saß an ihrem Bett, wann immer ich mich eine Minute frei machen konnte. Ich hielt ihre Hand, und sie versuchte nicht, sie zurückzuziehen.
Ich wußte, daß sie sterben würde. Sie hatte beschlossen, fortzugehen, wie man aus einer miesen Spelunke wegläuft. Vielleicht hatte sie ein wenig Mitleid mit mir. Und an einem Abend geschah es – ganz sacht, diskret und zurückhaltend. Ihre Faust lockerte sich ein wenig, wie eine sich öffnende Blume. Ihre Augen hörten auf, Augen zu sein, und im selben Augenblick wurde mir klar, daß ich gerade das BÖSE entdeckt hatte. Glaub mir, das gibt es, die Entdeckung des BÖSEN. Das blitzartige Begreifen. Das ist, als ob es dich innerlich zerreißt. Und ich stand da wie ein Heiland ohne Botschaft, mit leeren Händen. Ich hatte nichts tun können. Man kann überhaupt nie etwas tun. Mag sein, daß ein Dichter, ein Schriftsteller am Fuß eines Pfeilers von Notre-Dame oder an einem Kirchenportal vom göttlichen Licht durchdrungen wird – ich gönne es ihm. Ich aber saß am Totenbett eines Kindes, das daran gestorben war, daß es Nein gesagt hatte. Und der Tod dieses Mädchens stellte mich selbst in Frage, klagte mich gewissermaßen an, mitschuldig zu sein an einer einzigen großen Lüge. Ich war unfähig, meine Empfindungen klar auszudrücken, aber ich war versucht, auch meinerseits Nein zu sagen … Nein zu allem. Zu den Folterknechten und zu ihren Opfern. Zu den Ertrunkenen der Überschwemmungskatastrophen. Zu den Erdbebenopfern. Zu den Verhungernden. Und zu all den vielen zu Skeletten abgemagerten Kindern mit den Köpfen von Marsmenschen.
Wie recht sie hatte, die kleine Thi-Ngan. Sie hatte nicht gestöhnt, nicht geweint. Sie hatte nicht rechts und nicht links geschaut. Sie hatte sich allem entzogen und mich in dem verwesenden Moder weiterstolpern lassen, der mich umgab. Ich dachte einen Moment daran, um meine Entlassung einzukommen. Es gab nichts mehr, was mich hier zurückhielt. Und wenn ich mich noch so sehr abmühte, ich würde doch nie etwas anderes abgeben als einen kümmerlichen Sensenmann, der ein paar Todgeweihte aufklaubte. Wirkliche Hilfe für den einzelnen? Lächerlich!
Um es kurz zu machen: Ich verbrachte die Nacht neben Thi-Ngans Leiche. Am nächsten Morgen war ich ein alter Mann geworden. Ich war, wie meine kleine Tote, zugleich hier und doch ganz woanders. Und das bedeutet, glaube ich, daß alles in mir kaputt war, was mit Gefühl und Empfindsamkeit zu tun hat. Ich nahm meine Tätigkeit wieder auf – ich steigerte womöglich meine Leistung, wenn in Zusammenhang mit der Tretmühle, die nun mal unser Los war, von ‹Leistungssteigerung› die Rede sein kann: Verbände anlegen, Spritzen geben, Medikamente verabreichen – und die verkauften die Kranken hinter unserem Rücken für eine Prise Kokain … Da fällt mir wieder das Lager von Aranya Prathet ein. Nein, ein Vernichtungslager war es nicht. Aber in einer Weise war es noch schrecklicher, weil es schmieriger war, unflätiger. Hunger und Zusammengepferchtsein hatten aus den Menschen eine Art Rohmaterial gemacht, einen übelriechenden Schlamm; eine in Auflösung befindliche, eitrige, verzweifelte Masse. Man konnte sich innerhalb des Lagers nicht fortbewegen, ohne über menschliche Körper zu steigen oder in Scheiße zu treten. Und das war mir alles egal. Du hast es ja so gewollt, sagte ich höchstens mal zu mir selbst. Ich blieb ungerührt hinter meiner Ablehnung verschanzt, die sich täglich mehr verhärtete wie die Kruste auf einer Wunde. Ich paßte nicht auf mich auf, und hätte doch auf meine Gesundheit achtgeben müssen. ‹Du kannst von Glück sagen, wenn du dir nicht selber was holst!› pflegte Dr. Meynard zu mir zu sagen – ein patenter Kerl und M.S.F. wie ich. Er behielt recht: Ich bekam die Amöbenruhr. Das ist eine scheußliche Sache, bei der man buchstäblich von innen her ausgesaugt wird. Gegen Vampire gibt es Knoblauch und Gebete. Gegen Amöben gibt es tatsächlich so gut wie nichts. Meine Freunde steckten mich kurzentschlossen in die nächste Boeing Richtung Paris.
Zwischenlandung in Paris. Ich konnte mich nicht auf den Beinen halten. Ich brachte nicht einmal die Energie auf, daheim Bescheid zu geben, daß ich eintreffen würde. Ich ließ mich vom Taxi bei unserer Zentrale absetzen. Ich erspare Dir den ganzen Zirkus beim Wiedersehen mit den anderen. Da waren noch … Aber wozu soll ich Dir Namen aufzählen, die Du doch nicht kennst. Mehrere andere waren wie ich auf der Durchreise; die einen Richtung Tschad oder in den Libanon, die anderen auf dem Weg in ein Sanatorium, nach Royat oder Vichy. Ich hätte mich für Châtelguyon entscheiden sollen; die Quellen sollen bei Amöbenruhr besonders wirksam sein. Aber dann wollte ich plötzlich doch lieber heim nach Kerrarec. Ich wollte mit meinem Vater über die Sache mit Thi-Ngan sprechen. Er würde mich verstehen, das stand für mich fest.
Ich aß mit Daviaud zu Abend. Daviaud ist unser Sekretär, unser Schatzmeister, unser Berater, unser alles. Ohne ihn, seine Autorität und auch seine Güte … Also, ich weiß nicht, ob unser kleiner Haufen sich nicht in alle Winde zerstreut hätte und ganz aufgeflogen wäre. Glaub nur nicht, daß es bei uns keine Streitereien gegeben hätte! Keiner wollte ohne Wenn und Aber gehorchen. Die einen plädierten dafür, daß wir uns dem Roten Kreuz anschließen sollten. Andere wiederum wollten am liebsten ‹vor Ort›, besonders in Thailand, Krankenstationen errichtet haben. Und dann gab es noch eine Gruppe – das waren die Jüngsten und Engagiertesten –, die für kurze und riskante Kommandounternehmungen mitten in einem Katastrophengebiet waren. Bei alldem führte die Verschiedenheit der Charaktere zu heftigen Auseinandersetzungen.
Daviaud führte mich in ein kleines und ruhiges Bistrot, wo mir ein Menü zubereitet wurde, das meinem angeschlagenen Innenleben angepaßt war. Er fragte mich lange über die Boat people aus.
«Und du?» fragte er mich plötzlich. «Da oben noch alles in Ordnung?» Er streckte den Arm über den Tisch und tippte mir freundschaftlich an die Stirn.
Ich zuckte die Achseln.
«Na schön», meinte er. «Ich laß dich in Ruhe. Wenn du das Gefühl hast, du bist so weit, daß du wieder anfangen kannst, dann gibst du mir Bescheid. Aber nimm dir Zeit … Du mußt bestimmt mit ein paar Monaten rechnen. Mit Amöben ist nicht zu spaßen … Fährst du sofort nach Hause?»
«Ja. Morgen, so gegen Mittag, bin ich in Nantes. Ich habe Anschluß nach Saint-Nazaire, und dort holt unser alter Fouchard mich ab, mit dem Wagen … Von Bangkok nach Paris geht’s schneller als von Paris nach Kerrarec. Aber was für ein Friede, da unten!»
«Apropos», fing Daviaud an, «wenn ich geahnt hätte … Dein Vater hat uns einen Brief für dich geschickt. Er wußte nicht, wo du zu erreichen bist, und hat sich deshalb an mich gewandt. Und ich hab den Brief der kleinen Liliane mitgegeben – weißt du, der Stewardess in der Boeing, die da runter fliegt. Ihr habt euch fast gekreuzt. Du bist vorgestern dort weg, und der Brief … Ach, was soll’s! Den schicken sie uns mit der nächsten Maschine zurück. In fünf oder sechs Tagen hast du ihn. Inzwischen kann dir dein Vater selbst erzählen, was drinsteht … Übrigens, viel Post hast du eigentlich nie bekommen, oder täusche ich mich?»
«Nein. Mein Vater hat noch nie gern geschrieben. In seinem letzten Brief hat er mir den Tod meiner Tante Antoinette mitgeteilt. Das konnte er ja nicht umgehen … Vielleicht hatte er jetzt wieder eine Nachricht von einem Todesfall.»
«Ach, du hast noch gar nicht dort angerufen? Dann tu’s doch jetzt!»
«Was für eine Idee!» Ich mußte unwillkürlich lächeln. «Es ist gleich elf, da schlafen sie alle im Schloß. Ich schicke morgen früh ein Telegramm, damit ich abgeholt werde. Das reicht völlig. Daß der Empfang kühl sein wird, das weiß ich auch so … Oh, mein Vater ist da nicht gemeint. Wir sind Freunde, er und ich. Aber ich höre jetzt schon meine Mutter lamentieren: Jaja, wenn einer krank wird, dann fällt’s ihm ein, daß er auch noch eine Familie hat …»
«Na, sachte, sachte. Du übertreibst wohl. Wie lang ist’s eigentlich her, daß du deine Leute nicht gesehen hast?»
«Bald zwei Jahre.»
«Ach – so lange? War mir gar nicht bewußt. Na, um so mehr Grund zum Feiern. Sie werden ein Kalb für dich schlachten.»
Diesmal brachte er mich wirklich zum Lachen. «Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn ich mich über ein Kalbsschnitzel hermache – in meinem Zustand? – Nein, nein; meine Tante Elisabeth wird sich meiner annehmen. Sie behandelt Gott und die Welt mit alten Hausmitteln. Und jetzt bin ich dran! Sie hat mich schon immer für ein ziemlich armes Würstchen gehalten, weil ich für so was die ganzen Examen brauchte … Was für ein Triumph für sie, mich in diesem Zustand zu sehen!»
«Denis, du Ärmster … Das klingt alles ziemlich mies. Komische Erholung, die du dir da ausgesucht hast.»
«Halb so wild. Ich hab doch die Brière – das ist das Sumpfland, an dem Kerrarec liegt. Die Brière, das bedeutet Ruhe und Frieden. Ich werde meine ‹Plate› wieder in Betrieb nehmen, mein altes Flachboot … Ich hoffe, dort hat sich nicht zuviel verändert. Ich kann durch ein Labyrinth von seichten Wasserarmen von Tümpel zu Tümpel staken – und da treiben keine Leichen im Wasser! Da ist nur Ruhe, Daviaud, Ruhe … Schwalben, Libellen. Und das Schilfrohr im Wind … Ja, ich weiß, das klingt idiotisch. Für das Romantische hab ich ohnehin nie viel übrig gehabt. Aber ich habe ein so starkes Bedürfnis, zurückzufallen in ein, na – animalisches Stadium gewissermaßen. Wie ein schnüffelnder Hund zum Beispiel … Oder nein, das auch nicht. Ein Hund ist nicht unschuldig; auch er geht auf Jagd, macht Beute.»
«Na, na – das hört sich aber schon ziemlich buddhistisch an! Gewaltlosigkeit und so … Bruder Floh und Schwester Laus, was?»
«Laß das. Mach dich nicht lustig über mich.»
Wir unterhielten uns noch lange. Daviaud hatte schon immer einen Hang zur Philosophie. Ich nicht. Aber wenn man einen bestimmten Punkt der Ermüdung erreicht hat, dann steigt die Diskussion einem zu Kopf wie Alkohol. Ich schlief spät ein und hätte beinahe meinen Zug versäumt.
Vom Pariser Bahnhof Montparnasse aus telegrafierte ich nach Hause. Comte de Lespinière, Gut Kerrarec über Herbignac, Loire-Atlantique: Ankomme heute 14 Uhr Saint-Nazaire. Gruß, Denis. Die Schalterbeamtin warf mir einen gehässigen Blick zu. Comte de Lespinière – ein Graf, so was ist doch heutzutage leicht anrüchig … Als ob ich etwas dafür könnte. Und wir sind nicht einmal besonders wohlhabend, offen gesagt.
Ich saß in meinem Zweiter-Klasse-Abteil; Bilder und Erinnerungen tauchten vor mir auf … Du bist ja mal nach Kerrarec gekommen; ich war damals im ersten medizinischen Semester und Du, wenn mir recht erinnerlich ist, im ersten juristischen … Wie weit das alles weg ist! Das Schloß hatte es Dir angetan, und ich gebe zu, daß es was hermacht, wenn man es von weitem sieht. Aber aus der Nähe! Und gar erst drinnen!
Du warst damals im bewohnbaren Teil untergebracht, und der ist tatsächlich eindrucksvoll. Nur ist da halt noch der Rest – der Flügel aus dem 16. Jahrhundert und die Speicherräume … Vor allem die Speicher. Ein Vermögen würde es kosten, das alles instandzusetzen. Und Du darfst nicht vergessen, daß in diesem Gemäuer nur noch sechs Menschen leben: mein Vater, meine Mutter, meine Tante Elisabeth, meine Schwester Claire und das Ehepaar Fouchard. Das ist alles, die Spinnen und Gespenster nicht mitgerechnet. Und was ihre Einkünfte betrifft … Gott, ich hab ja nichts vor Dir zu verbergen: Die Ländereien um das Schloß herum bringen fast keinen Ertrag; ohne die beiden Bauernhöfe und zwei Villen in La Baule wüßte ich nicht, wie sie über die Runden kommen sollten. Glücklicherweise versteht es meine ziemlich nüchtern veranlagte Mutter, allerhand herauszuholen aus diesen Anwesen. Was es wiederum meinem Vater ermöglicht, ein angenehm gemächliches Leben zu führen. Er malt – übrigens recht gut –, macht Jagd auf die vielen Wasservögel ums Schloß herum und geht angeln wie ein alter Wilddieb. In seiner Familie sind früher viele zur See gefahren und ich glaube, das Angebundensein geht ihm gegen den Strich. Er trauert seiner Zeit in der Résistance nach, als er auf die Deutschen ballern konnte, die nach der Landung der Alliierten bei Saint-Nazaire eingeschlossen waren. Das war seine große Zeit.
Du wirst es nicht für möglich halten, aber meine Eltern hacken immer noch aufeinander herum, wenn einmal diese Résistance-Scharmützel zur Sprache kommen. Das hängt damit zusammen, daß ein Vorfahr meiner Mutter bei den Royalisten war, die 1795 übers Meer fliehen wollten, vor ihrer Einschiffung gefaßt und hinterher erschossen wurden. Und deshalb haßt sie die Republikaner, diese ‹Schießhunde›. Eines Tages hat sie zu meinem Vater gesagt: Du wärst auch einer von denen gewesen, wenn du damals gelebt hättest … Das ist natürlich irre. Aber wie immer bei solchen irren Dingen: es stecken tiefverwurzelte und verborgene Ursachen dahinter. Und für die unterschwellige Feindseligkeit, die immer zwischen ihnen herrschte, habe ich vielleicht damals den Grund gefunden, als ich vom Tod meiner Tante Antoinette erfuhr.
Du weißt, wie das geht … Erinnerungen kommen hoch. Man sieht Parallelen, man zieht Schlüsse, die einem nie in den Sinn gekommen wären – und plötzlich sieht man klar.
Du mußt wissen, daß meine Tante Antoinette meinen Vater haßte … Weißt Du, ich erzähl Dir das alles, weil wir im Zug nach Nantes sitzen und Zeit haben. Ja, und ich habe ihre Bemerkungen noch im Kopf. Eines Tages zum Beispiel saßen wir bei Tisch und warteten auf meinen Vater, der noch nie ein Muster an Pünktlichkeit war. Als sie dann seine Schritte in der Diele hörte, hat sie höhnisch aufgelacht: ‹Ah! Da kommt er ja, unser Picasso!› hat sie mit unglaublicher Verachtung hervorgestoßen … Worte können manchmal töten.
Bei einer anderen Gelegenheit hat sie in meiner Gegenwart zu meiner Mutter gesagt: ‹Sabine, du Ärmste! Aber was kannst du von einem Maillard schon erwarten?› – Undjetzt halt Dich gut fest, denn der Grund für die ganzen Feindseligkeiten wird Dir völlig hirnverbrannt erscheinen: Meine Mutter ist eine geborene Courtenay; sie entstammt einer sehr alten Familie des französischen Hochadels. Schon im Mittelalter gab es Bischöfe und Gouverneure, die den Namen de Courtenay trugen. Im 18. Jahrhundert ist ein Marquis de Courtenay, der ein Kavallerieregiment anführte, in der Schlacht von Fontenoy gefallen; ein Baron de Courtenay war Deputierter bei den Generalständen, ehe er unter die Guillotine kam … Ich könnte noch lange so weitermachen. Dies nur zur Erklärung dafür, daß meine Mutter nicht gerade wenig von sich hält. – Mein Vater dagegen ist ein Maillard. Die Maillards waren Ende des XVII. Jahrhunderts eine gutbürgerliche Familie in Nantes, die es durch Handel zu Wohlstand gebracht hatte. Unter Ludwig XV. heiratete ein Pierre Louis Maillard, Kaufmann und Reeder, die Tochter eines höheren Beamten aus Santo Domingo und erwarb für fünfundsiebzig Millionen damaliger Francs das Amt eines Secrétaire du Roi, wodurch er gleichzeitig in den niederen Adelsstand erhoben wurde. Das muß ihm ein wenig zu Kopf gestiegen sein; er kaufte sogleich das Schloß von Lespinière – das heute nicht mehr existiert – und nannte sich auch danach. Er wurde also ganz legal Pierre Louis Maillard, Seigneur de Lespinière. – Als nächster taucht ein Raoul de Lespinière auf, der als Marineoffizier bei Trafalgar dabei war und später eine Abhandlung schrieb, die ihm zu einigem Ansehen verhalf: Betrachtungen über Raddampfer … Ich will Dich nicht langweilen; jedenfalls kommen wir schließlich zu Raoul Eudes Armand Maillard de Lespinière, meinem Vater. – Nicht gerade überwältigend, was?
Auf der einen Seite also der Abkömmling eines Kaufmanns, eines Händlers, der seinen Namen irgendwann gekauft hat – und auf der anderen die stolze Nachfahrin einer uralten Familie, deren Adel niemals etwas mit Geld zu tun hatte … Und weißt Du auch, von wem ich das alles habe? Von unserem guten Fouchard natürlich; schließlich werfen sich meine Eltern nicht gegenseitig ihre Herkunft an den Kopf – so weit geht’s denn doch nicht. Aber die Fouchards sind nach ihrem Verständnis gewissermaßen ebenso ‹adlig› wie die Courtenays, weil sie seit Generationen in deren Diensten stehen. So ist das nun mal in unserem Wilden Westen. Und so mancher Ahnenforscher könnte vom alten Fouchard eine Menge lernen … Wenn er mich zum Angeln mitnahm ins Sumpfland, dann hat er beim Pfeifestopfen oder zwischen zwei Fängen die Vergangenheit vor mir ausgebreitet. Gott, was hat der Alte mich genervt! Die großen Taten meiner Vorfahren gingen mir zum einen Ohr hinein, und zum anderen wieder raus. Ich träumte davon, abzuhauen, weit weg. Ich fühlte mich mehr als Maillard, denn als Courtenay – darauf werde ich übrigens noch zurückkommen. Das ist wichtig … Jedenfalls habe ich damals bei der Nachricht von Tante Antoinettes Tod plötzlich verstanden, was sie seinerzeit mit ihrem ‹Was kannst du von einem Maillard schon erwarten?› ausdrücken wollte.
Für sie – und für meine Mutter ebenfalls, nehme ich an – hatten die Courtenays sich durch die Ehe mit meinem Vater unter ihr Niveau begeben. Du wirst mir entgegenhalten, daß meine Mutter über die Maillards Bescheid wußte, ehe sie heiratete. Warum also? Du kannst dir wohl denken, daß ich sie nie danach gefragt habe. Ich nehme an, mein Vater war eben nach ihrem Geschmack: Ein gutaussehender Mann, liebenswürdig, fröhlich – warum also nicht? Um so mehr, als meine Mutter allmählich über die zarten Mädchenjahre hinaus war. Und dazu noch die beiden älteren Schwestern vor Augen: Beide unverheiratet und noch altjüngferlicher, als den Jahren nach gerechtfertigt … Als abschreckendes Beispiel sozusagen.
Ich habe allen Grund zu der Annahme, daß sie anfangs glücklich waren zusammen. Fremdgegangen ist er erst viel später. Ich habe nach und nach kapiert, daß mein Vater sich bestimmte Freiheiten herausnahm, sich Seitensprünge leistete. In meiner Gegenwart fiel kein böses Wort; ihre Streitigkeiten waren wie fernes Wetterleuchten, und ich bekam nur ab und an ein flüchtiges Aufblitzen mit. – Ja, und dann ist Claire zur Welt gekommen, die Nichtgewollte … Armes Ding. Sie ist viel jünger als ich, sehr schön und … Na, im Klartext: ein bißchen zurückgeblieben. Sie hat sich geistig nicht normal entwickelt; ich weiß nicht, warum. Mit zweiundzwanzig, bald dreiundzwanzig Jahren ist sie auf dem Stand von zwölf. ‹Ja, wenn er weniger fremdgegangen wäre!› glaube ich meine Tanten noch zu hören. Denn für sie wie für meine Mutter stand ohne Zweifel fest: Schuld war mein Vater. Von einem Maillard kann man eben nichts Gutes erwarten … Du siehst, wie kompliziert und zugleich erbärmlich das alles ist.
Und während sich auf Kerrarec diese kleinkarierten Querelen abspielten, sind irgendwo am anderen Ende der Welt Menschen durch Hunger und Terror umgekommen … Siehst Du, deswegen mochte ich Kerrarec nicht. Ich bin M.S.F. geworden, weil ich abhauen wollte. Und meine drei Uradligen haben nichts kapiert. Bei meinem Vater weiß ich es nicht; vielleicht hat er mich im stillen beneidet … Und jetzt bin ich zurückgekommen, krank an Leib und Seele, von irgendeinem Instinkt getrieben … Auch die Lachse kommen zu dem Bach zurück, in dem sie geschlüpft sind.
Ich bin ins Träumen gekommen, wie Du siehst. Ich habe eine Landschaft an mir vorüberziehen lassen, die mir noch vertraut ist. Hinter Angers, die Loire unter einem pastellfarbenen Himmel; die lieblichen Windungen, Uferböschungen im Frühlingsgrün … Aber paß bitte auf, wenn Du diese Passage meiner Heimkehr beschreibst: Ich verbitte mir, daß Du schreibst, ich sei gerührt gewesen. Im Gegenteil. In Wirklichkeit bin ich erstaunlich gleichgültig gewesen. Der lachende Maientag, die Lieblichkeit der Landschaft – die Dichter mögen das beschreiben. Ich dagegen hatte noch Blut und Eiter an den Händen und vor Augen ein Bild, das nie mehr verblassen würde. Ich fühlte mich ausgehöhlt wie ein vom Metzger ausgenommenes Tier. Und ich stellte mir die zu erwartenden Kommentare meiner Lieben vor: Mein armer Kleiner, du mußt ja furchtbar müde sein … Ja, ja, wir wissen aus der Zeitung, was da unten alles los ist … Das sind doch alles Wilde, nicht wahr? Und was hast du jetzt davon, daß du dich für sie aufgeopfert hast?
Dieser ganze Quatsch stand mir bevor. Und obendrein würde Tante Elisabeth mir eine Tasse Borretsch vorsetzen – oh, pardon: eine Tasse borrago officinalis. Sie spinnt nicht nur, meine gute Tante. Sie spinnt auf Lateinisch.
2
Er erwartete mich in Saint-Nazaire, der gute alte Fouchard. Er trug eine Jagdhüteruniform; in der einen Hand hielt er die Mütze, und mit der anderen hielt er mir die Tür unseres uralten Peugeot auf.
«Was sind denn das für neue Sitten?» sagte ich. «Du könntest mich zur Begrüßung umarmen.»
Er stotterte vor Freude. Vielleicht dachte er an die Zeit zurück, als er mich auf den Knien reiten ließ.
«Es ist nur, weil … Monsieur le Comte …»
«Na hör mal! Ich bin für dich doch nicht Monsieur le Comte! Du kannst mich Monsieur Denis nennen, wenn du willst.»
«Ja, schon, aber … Sie wissen ja nicht … Es ist wegen Monsieur le Comte …»
«Wieso? Ist was passiert?»
«Monsieur le Comte ist weg.»
«Weg? Was soll das heißen? Wohin denn?»
«Das weiß niemand. Er ist verschwunden.»
«Na hör mal! So furchtbar weit kann er ja nicht sein.»
«Seit vier Tagen suchen wir nach ihm.»
«Komm, wir können hier nicht stehenbleiben.» Ich stieg in den Wagen. «Mann, ich bin gerade erst angekommen, ich hab von nichts ’ne Ahnung! Und hier werde ich mit der Nachricht empfangen, daß mein Vater weg ist, und dann ist er auch noch verschwunden – das ist schließlich nicht unbedingt dasselbe, ja? Hatte er vielleicht vor, zu verreisen? Hat er irgendwelche Vorbereitungen getroffen?»
«Nein, eben nicht. Er ist gegen drei Uhr nachmittags aus dem Haus, als ob er spazierengehen wollte. Und dann ist er nicht zurückgekommen.»
Mir fiel der Brief wieder ein, von dem Daviaud gesprochen hatte – Du erinnerst Dich; der Brief, der nun seit mehreren Tagen hinter mir her reiste … Vermutlich hatte mein Vater nach einer besonders heftigen Auseinandersetzung beschlossen, das Haus zu verlassen – das war für mich die einzige Erklärung.