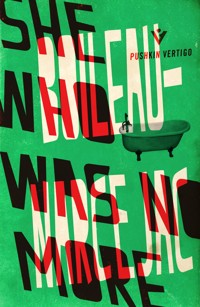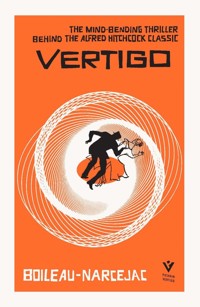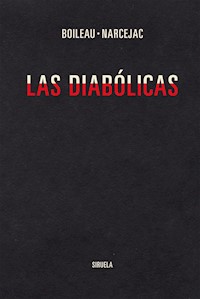4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Klassiker des Psychothrillers – die Vorlage für Alfred Hitchcocks weltberühmten Film Dies ist eine Dreiecksgeschichte, wenn auch nicht im üblichen Sinn: Es geht um drei Frauen, die offenbar wider alle Vernunft ein und dieselbe sind: Pauline, Madeleine und Renée. Eine von ihnen ist seit vielen Jahren tot; die zweite stirbt im Verlauf der Ereignisse, und die dritte scheint mit beiden identisch zu sein …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Pierre Boileau • Thomas Narcejac
Vertigo
Aus dem Reich der Toten
Aus dem Französischen von Marianne Caesar
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Ein Klassiker des Psychothrillers – die Vorlage für Alfred Hitchcocks weltberühmten Film
Dies ist eine Dreiecksgeschichte, wenn auch nicht im üblichen Sinn: Es geht um drei Frauen, die offenbar wider alle Vernunft ein und dieselbe sind: Pauline, Madeleine und Renée. Eine von ihnen ist seit vielen Jahren tot; die zweite stirbt im Verlauf der Ereignisse, und die dritte scheint mit beiden identisch zu sein …
Über Pierre Boileau • Thomas Narcejac
Die beiden französischen Autoren Pierre Boileau (1906–1989) und Thomas Narcejac (1908–1998) haben zusammen zahlreiche Kriminalromane verfasst. Ihre nervenzerreißenden Psychothriller haben viele Regisseure zu spannenden Filmen inspiriert, am bekanntesten sind wohl «Die Teuflischen» und sein amerikanisches Remake «Diabolisch» und «Vertigo – Aus dem Reich der Toten», sicher einer der besten Filme von Alfred Hitchcock.
Inhaltsübersicht
Für Pierre Véry
Erster Teil
1
«Ich möchte, daß du meine Frau beschattest», sagte Gévigne.
«Ich soll … Na hör mal! – Betrügt sie dich?»
«Nein.»
«Warum also?»
«Das isc nicht so einfach. Sie ist … sonderbar. Ich mache mir Sorgen.»
«Wovor hast du Angst?»
Gévigne überlegte. Er sah Flavières an. Er war unsicher, das spürte Flavières. Gévigne hatte sich nicht verändert seit ihrer gemeinsamen Studienzeit, damals vor fünfzehn Jahren. Nach außen hin war er herzlich und lebhaft, redete gern und viel, aber im Grunde war er verschlossen, schüchtern und unglücklich. Eben hatte er Flavières mit ausgebreiteten Armen begrüßt. ‹Roger, alter Junge! Schön, dich wiederzusehen …› Viel zu theatralisch! Und erst sein lautes Lachen! Die fünfzehn Jahre waren nicht spurlos an ihnen beiden vorübergegangen. Sie hatten sich äußerlich sehr verändert. Gévigne war beinahe kahl; er hatte ein Doppelkinn. Seine Augenbrauen waren fast rostrot geworden, und die Nase war mit Sommersprossen bedeckt. Flavières war mager geworden; sein Rücken war gebeugt – seit der Geschichte damals. Seine Hände wurden feucht, wenn er daran dachte, daß Gévigne ihn fragen könnte, warum er nicht mehr Polizist, sondern Anwalt war.
«Ich habe nicht wirklich Angst um sie», fuhr Gévigne fort. Er bot Flavières eine Zigarre an aus einem kostbaren Etui. Auch seine Krawatte war kostbar, und der Nadelstreifenanzug saß hervorragend. Ein Brillantring blitzte, als er ein Streichholz aus einem Heftchen riß, das aus einem sehr teuren Restaurant stammte. Mit gespitzten Lippen blies er langsam den Rauch in die Luft.
«Eine komische Sache», meinte er.
Ja, Gévigne hatte sich sehr verändert. Er hatte das Gefühl der Macht gekostet. Wahrscheinlich war er Mitglied von mehreren Aufsichtsräten, hatte viele Freunde, Verbindungen und Einfluß. Seine Augen waren immer noch so flink und unruhig, und man konnte auch jetzt Angst in ihnen aufsteigen sehen, die er in der nächsten Sekunde hinter gesenkten Lidern verbarg.
«Eine komische Sache?» Flavières hob fragend die Brauen.
«Ja, gewissermaßen …» Gévigne zögerte. «Meine Frau ist glücklich und zufrieden. Wir sind seit vier Jahren verheiratet; wir leben in gesicherten Verhältnissen. Mein Betrieb in Le Havre läuft auf Hochtouren seit der Mobilmachung – der Grund, weswegen ich nicht eingezogen worden bin. Wir gehören also zu den Privilegierten, sozusagen.»
«Keine Kinder?»
«Nein.»
«Und weiter?»
«Wie schon gesagt, Madeleine hat alles, was sie braucht. Und trotzdem stimmt da etwas nicht. Sie war immer ein bißchen wunderlich, hatte Launen, war depressiv. Aber seit ein paar Monaten ist es plötzlich schlimmer geworden. Beunruhigend schlimmer geworden.»
«Warst du mit ihr bei einem Arzt?»
«Sicher; bei mehreren Kapazitäten … Es fehlt ihr nichts. Überhaupt nichts.»
«Nichts Organisches», räumte Flavières ein. «Und psychisch?»
«Nichts. Nicht so viel!» Er schnalzte mit den Fingern und wischte etwas Asche von seiner Weste. «Ganz schön kompliziert ist das alles, das kannst du mir glauben. Am Anfang hab ich auch gedacht, es handele sich um eine fixe Idee, um irgendeine Angst – vielleicht durch den Krieg. Sie versinkt zum Beispiel plötzlich in Schweigen, und wenn man mit ihr spricht, hört sie kaum zu. Oder sie starrt auf einen Gegenstand … Schrecklich ist das! Man könnte meinen, sie sieht irgend etwas – wie soll ich sagen … unsichtbare Dinge … Wenn sie dann wieder zu sich kommt, wirkt sie verstört, und es fällt ihr schwer, sich in ihrer gewohnten Umgebung zurechtzufinden … Sie erkennt mich dann kaum wieder.»
Er legte seine Zigarre auf den Aschenbecher und starrte ins Leere. Er hatte wieder diesen hilflosen Ausdruck, den Flavières aus ihrer Studienzeit kannte.
«Wenn sie nicht krank ist, dann simuliert sie eben», sagte Flavières etwas ungehalten.
Gévigne hob seine fette Hand, als wollte er Flavières’ Bemerkung im Flug abfangen.
«Daran habe ich auch gedacht. Ich habe sie beobachtet. Ich bin ihr einmal gefolgt. Sie ist in den Bois de Boulogne gegangen, hat sich auf eine Bank am See gesetzt – über zwei Stunden saß sie völlig regungslos da – und hat nur aufs Wasser geschaut.»
«Daran finde ich nichts Beunruhigendes.»
«Doch. Sie schaute aufs Wasser – wie soll ich sagen – ganz konzentriert, wie gebannt. Als ob es für sie ungeheuer wichtig wäre … Und am Abend hat sie dann behauptet, sie sei nicht aus dem Haus gegangen. Ich habe ihr natürlich nicht gesagt, daß ich ihr gefolgt bin. Das verstehst du doch.»
Flavières war irritiert. Das war ja etwas ganz Neues! Früher war Gévigne nicht so rücksichtsvoll.
«Hör zu», sagte er, «laß uns mal logisch vorgehen. Entweder deine Frau betrügt dich oder sie ist krank oder sie simuliert. Ziemlich kompliziert das Ganze.»
Gévigne griff wieder nach seiner Zigarre, nachdem er mit dem kleinen Finger einen langen weißen Aschenkegel abgestreift hatte. Er lächelte traurig.
«Früher hatte ich auch einmal den Verdacht. Aber inzwischen bin ich sicher, daß Madeleine mich nicht betrügt. Und krank ist sie auch nicht. Professor Lavarenne hat mir versichert, daß sie normal ist. Und warum sollte sie simulieren? Wer simuliert schon, nur weil es ihm Spaß macht? Kein Mensch setzt sich zwei Stunden auf eine Bank im Bois und starrt aufs Wasser, wenn er keinen Grund dazu hat … Es gibt noch mehr Argumente, die dagegen sprechen.»
«Hast du mit ihr gesprochen?»
«Ja, sicher. Ich habe sie gefragt, was sie bedrückt. Daraufhin hat sie wieder ins Leere gestarrt.»
«Was hat sie dir denn geantwortet?»
«Daß ich mir keine Sorgen machen solle. Sie träume gar nicht. Sie hätte nur ganz normale Sorgen, wie jeder andere auch.»
«War es ihr peinlich?»
«Ja. Sie war sehr verlegen, fast verstört.»
«Glaubst du, daß sie dich angelogen hat?»
«Nein, nein. Ich glaube, sie hat Angst … Ich muß dir noch was sagen; vielleicht lachst du mich aus. Erinnerst du dich noch an diesen deutschen Film, den wir damals zusammen gesehen haben? ‹Jacob Boehme› …?»
«Ja.»
«Dann erinnerst du dich auch an die Frau, die man in Trance überrascht hat. Sie hat versucht zu leugnen, wollte ihre Visionen nicht preisgeben … Madeleine sieht manchmal aus wie diese Frau, genau so verstört, und ihre Augen sind genau so ruhelos …»
«Nun mach aber einen Punkt! Du wirst doch nicht im Ernst behaupten, daß deine Frau in Trance versinkt!»
«Ich wußte, daß du so reagieren würdest. Ich habe das zuerst auch für unmöglich gehalten. Ich habe mich dagegen gewehrt. Ich konnte mich einfach nicht damit abfinden.»
«Ist sie eine gute Katholikin?»
«Wie jeder von uns … Sie geht sonntags zur Messe … Aus Gewohnheit.»
«Kann sie in die Zukunft sehen?»
«Nein. Ich möchte das mal so ausdrücken: Sie ist auf irgendeinen Klick hin in einer anderen Welt.»
«Gegen ihren Willen?»
«Ich glaube schon. Ich beobachte sie ja seit langem. Ich hab das oft erlebt. Sie spürt, wenn es soweit ist. Dann wird sie unruhig, muß mit jemandem reden … Manchmal steht sie dann auf, öffnet das Fenster, als ob sie keine Luft bekommt, oder sie stellt das Radio auf volle Lautstärke … Dann gehe ich zu ihr. Wenn ich mich mit ihr unterhalte, fängt sie sich wieder. Dann bleibt sie auf der Erde … Ich rede sicher lauter ungereimtes Zeug; entschuldige! Aber es ist wirklich nicht einfach zu beschreiben … Und wenn ich so tue, als hätte ich nichts bemerkt, dann entgleitet sie mir. Du kannst zusehen, wie sie langsam erstarrt, wie ihre Augen einen Punkt fixieren. Dann seufzt sie, fährt sich mit dem Handrücken über die Stirn, und in den folgenden zehn Minuten bewegt sie sich wie eine Schlafwandlerin.»
«Sind ihre Bewegungen ruckartig?»
«Nein … Ehrlich gesagt, ich bin noch keinem Schlafwandler begegnet. Aber ich hatte nie das Gefühl, daß sie schläft. Sie wirkt nur zerstreut … Ich weiß, das klingt alles verrückt. Aber ich kann es nicht besser beschreiben. Sie ist dann wirklich nicht sie selbst. Sie ist … eine andere.»
Gévigne hatte Angst.
«Eine andere», wiederholte Flavières. «Was willst du damit sagen?»
«Na, es soll ja Phänomene geben, die …» Gévigne hielt inne, legte seine zerkaute Zigarre wieder auf den Aschenbecher und preßte die Hände gegeneinander. «Laß mich die Sache zu Ende bringen», fuhr er hastig fort. «Es hat in Madeleines Familie eine seltsame Frau gegeben … Sie hieß Pauline Lagerlac. Sie war die Urgroßmutter von Madeleine – eine direkte Verwandte also. Mit dreizehn oder vierzehn Jahren wurde sie krank … Wie soll ich dir das bloß erklären? Sie hatte Krämpfe, und es heißt, daß man in ihrem Zimmer Geräusche gehört hat, die man sich nicht erklären konnte …»
«Klopfen an der Wand?»
«Ja.»
«Schleifen auf dem Parkett, als ob Möbel hin und her geschoben würden?»
«Ja.»
«Hm … So etwas soll es geben», sagte Flavières. «Man hat keine Erklärung dafür.»
«Ich bin nicht besonders beschlagen auf dem Gebiet», fuhr Gévigne fort, «aber eins steht fest: Pauline Lagerlac war immer ein bißchen wunderlich. Ursprünglich wollte sie Nonne werden, aber dann hat sie geheiratet. Und ein paar Jahre später hat sie sich das Leben genommen – keiner weiß warum.»
«Wie alt war sie?»
Gévigne tupfte sich mit dem Taschentuch die Lippen. «Fünfundzwanzig», sagte er leise. «Wie Madeleine.»
Die beiden Männer sahen sich schweigend an.
Flavières überlegte. «Weiß deine Frau davon?» fragte er.
«Nein. Meine Schwiegermutter hat mir das alles erzählt, kurz nach unserer Hochzeit. Ich hatte es total vergessen, bis Madeleine … Wenn ich natürlich gewußt hätte … Meine Schwiegermutter ist inzwischen tot. Und sonst weiß niemand etwas darüber.»
«Hattest du den Eindruck, daß sie dir die Geschichte aus einem bestimmten Grund erzählt hat?»
«Nein, ich glaube nicht. Sie hat das nur einmal ganz beiläufig erwähnt. Und ich weiß noch, daß sie mir verboten hat, mit Madeleine über Pauline zu sprechen. Sie war nicht gerade erbaut davon, daß sie eine Verrückte in der Familie haben. Ihre Tochter sollte nichts davon erfahren.»
«Hat diese Pauline Lagerlac sich aus einem bestimmten Grund umgebracht?»
«Nein, anscheinend nicht. Sie war glücklich verheiratet. Sie hatte einen kleinen Sohn von ein paar Monaten, und jeder glaubte, daß sie durch das Kind ihr Gleichgewicht wiederfinden würde. Und dann, völlig unerwartet …»
«Ich sehe immer noch keinen Zusammenhang zwischen Pauline und deiner Frau.»
«Keinen Zusammenhang?» sagte Gévigne niedergeschlagen. «Gleich wirst du ihn sehen: Als Madeleines Eltern starben, hat sie auch ein paar Schmuckstücke geerbt, die von ihrer Urgroßmutter stammten. Unter anderem eine Bernsteinkette. Die hat es ihr besonders angetan … Sie betrachtet sie oft, hält sie in den Händen … Manchmal denke ich – wie soll ich sagen –, daß die Kette sie traurig macht … Wir haben auch ein Porträt von Pauline Lagerlac, von ihr selbst gemalt. Sie malte nicht schlecht. Madeleine sitzt oft stundenlang vor dem Bild. Es scheint sie zu faszinieren … Einmal kam ich dazu – es ist schon eine ganze Weile her –, wie sie das Bild auf den Tisch im Salon gestellt hatte, daneben einen Spiegel. Sie hatte die Bernsteinkette angelegt und versucht, sich so zu kämmen wie Pauline Lagerlac, mit einem Chignon im Nacken … Danach hat sie sich immer so frisiert», sagte Gévigne gequält.
«Sieht sie Pauline ähnlich?»
«Vielleicht … Ein bißchen.»
«Ich muß dich noch einmal fragen: Wovor hast du Angst?»
Gévigne seufzte, nahm seine Zigarre und betrachtete sie zerstreut. «Ich traue mich gar nicht, dir zu sagen, was ich denke … Weißt du, Madeleine ist nicht mehr wie früher. Manchmal glaube ich, daß die Frau, mit der ich zusammenlebe, gar nicht Madeleine ist.»
«Nun hör schon auf!» Flavières stand auf und zwang sich zu einem Lachen. «Wer soll sie denn sonst sein? Pauline Lagerlac …? Du phantasierst, mein Lieber! – Was willst du trinken? Porto, Cinzano, Cap Corso?»
«Einen Porto.»
Und als Flavières ins Eßzimmer ging, um die Gläser zu holen, rief Gévigne ihm nach:
«Und du, was machst du? Ich rede die ganze Zeit nur von meinen Problemen. Bist du verheiratet?»
«Nein. Mir war bisher nicht danach.»
«Ich habe zufällig gehört, daß du nicht mehr bei der Polizei bist», fuhr Gévigne fort.
Stille nebenan. Dann fragte Flavières: «Willst du, daß ich dir helfe?»
Gévigne löste sich aus seinem Sessel, ging auf die offene Tür zu. Flavières entkorkte gerade eine Flasche.
«Schön hast du’s», sagte Gévigne und lehnte sich mit der Schulter an die Türfüllung. «Entschuldige, daß ich dich mit meinen Geschichten überfalle. Ich freue mich unheimlich, dich wiederzusehen. Ich weiß, ich hätte vorher anrufen sollen, aber ich habe so viel um die Ohren …»
Flavières richtete sich auf und betrachtete den Korken. Der Kelch war an ihm vorübergegangen. «Du hast da was von Schiffsbau erzählt», sagte er, während er die Gläser füllte.
«Ja. Wir bauen im Moment Schiffsrümpfe. Ein ziemlich großer Auftrag. Die vom Ministerium scheinen mit dem Schlimmsten zu rechnen.»
«Irgendwann muß doch dieser komische Krieg einmal zu Ende sein. Wir haben schon Mai … Auf dein Wohl, Paul!»
«Auf deines, Roger!»
Sie tranken und sahen sich dabei in die Augen. Im Stehen war Gévigne klein und gedrungen. Er stand vor dem Fenster, und das Licht fiel voll auf sein Gesicht. Ein römisches Gesicht; fleischige Ohren, edle Stirn. Trotzdem war er kein Adonis. Ein paar Tropfen provenzalisches Blut hatten ihm dieses Profil eines Prokonsuls gegeben.
Nach dem Krieg wird dieser Kerl um ein paar Millionen schwerer sein, dachte Flavières. Aber gleich darauf schämte er sich dieses Gedankens. Was war denn mit ihm? Profitierte er nicht auch dadurch, daß er nicht eingezogen worden war? Er war dienstuntauglich. Damit mußte er sich abfinden. Er stellte sein Glas auf das Tablett zurück.
«Die Geschichte fängt an, mich zu interessieren … Hat deine Frau Verwandte?»
«Ein paar entfernte Vettern, zu denen wir keinen Kontakt haben. Sonst so gut wie keine Verwandtschaft.»
«Wie hast du sie kennengelernt?»
«Das war ganz romantisch …» Gévigne betrachtete sein Glas, suchte nach Worten. Immer diese Angst, sich lächerlich zu machen! Genau wie früher … Endlich entschloß er sich zu reden. «Ich bin ihr in Rom zum erstenmal begegnet. Auf einer Geschäftsreise. Wir wohnten im selben Hotel.»
«In welchem Hotel?»
«Im Continental.»
«Was hat sie in Rom gemacht?»
«Sie studierte Malerei. Sie malt sehr gut, glaube ich. Du kennst ja meine Einstellung zur Malerei …»
«Hat sie dort Unterricht gegeben?»
«Wo denkst du hin! Sie malte nur so, zum Vergnügen. Sie hatte es nie nötig, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Mit achtzehn hatte sie immerhin schon ihren eigenen Wagen. Ihr Vater war Großindustrieller …»
Gévigne ging zurück in das Arbeitszimmer. Flavières fiel sein sicherer Gang auf. Früher war er unsicher und eckig gewesen. Das Vermögen seiner Frau hatte ihm die Sicherheit gegeben.
«Malt sie immer noch?»
«Sie hat es nach und nach aufgegeben. Sie hat keine Zeit mehr dazu … Eine Frau hier in Paris hat andere Dinge im Kopf.»
«Aber die Anfälle, von denen du erzählt hast – die müssen doch eine Ursache haben! Gibt es da nicht irgendeinen Auslöser? Vielleicht ein Streit? Oder eine schlechte Nachricht? Sicher hast du dir deswegen schon Gedanken gemacht.»
«Das hab ich, das kannst du mir glauben. Aber ich habe nichts gefunden … Den größten Teil der Woche bin ich ja in Le Havre; das darfst du nicht vergessen.»
«Haben die Anfälle erst begonnen, seitdem du so oft weg bist?»
«Nein. Als ich kürzlich an einem Vormittag aus Le Havre zurückkam – es war an einem Samstag –, war Madeleine fröhlich wie immer. Und am Abend schien sie mir zum erstenmal eigenartig. Aber ich habe dem weiter keine Bedeutung beigemessen. Ich war sehr müde an diesem Tag.»
«Und vorher?»
«Vorher … Manchmal hatte sie schlechte Laune. Aber es war anders an diesem Samstagabend.»
«Bist du sicher, daß an diesem Tag nichts Außergewöhnliches passiert ist?»
«Ganz sicher. Ich weiß das so genau, weil wir den ganzen Tag zusammen waren. Ich bin morgens gegen zehn nach Hause gekommen. Madeleine war gerade aufgestanden. Wir haben uns unterhalten … Frag mich nicht, worüber; ich habe es vergessen. Ich weiß nur noch, daß wir zu Hause zu Mittag gegessen haben.»
«Wo wohnst du?»
«Wie? – O ja, du hast recht; ich habe ja nie was von mir hören lassen. Ich habe ein Haus in der avenue Kléber gekauft, ganz in der Nähe vom Etoile … Hier ist meine Karte.»
«Danke.»
«Nach dem Essen sind wir ausgegangen … Ich erinnere mich so genau, weil ich einen Termin im Ministerium hatte. Danach sind wir spazieren gegangen, an der Oper. Und dann … Verdammt, das ist alles. Ein Nachmittag wie jeder andere.»
«Und der Anfall?»
«Nach dem Abendessen.»
«Weißt du noch das Datum?»
«Das Datum?» Gévigne holte sich den Terminkalender von Flavières’ Schreibtisch und blätterte. «Ja, jetzt erinnere ich mich. Es muß Ende Februar gewesen sein», sagte er. «Weil ich da im Ministerium war … Ich sehe gerade, der 26. Februar war ein Samstag. Es muß der 26. gewesen sein.»
Flavières setzte sich auf die Armlehne eines Sessels neben Gévigne. «Wie bist du auf die Idee gekommen, mich zu besuchen?»
Gévigne preßte wieder die Handflächen gegeneinander. Er hatte zwar viele seiner Ticks abgelegt, aber den hatte er beibehalten. Wenn er sich nicht wohl in seiner Haut fühlte, hielt er sich an sich selbst fest.
«Du bist immer mein Freund gewesen», sagte er leise. «Und ich erinnerte mich, daß du dich damals für Psychologie und auch für Parapsychologie interessiert hast … Wäre es dir denn lieber gewesen, ich wäre zur Polizei gegangen?»
Als er das leise spöttische Lächeln Flavières’ sah, meinte er: «Eben, weil du nicht mehr bei der Polizei bist, bin ich zu dir gekommen.»
«Ja …» Flavières strich über das weiche Leder seines Sessels. «Ja, ich bin nicht mehr bei der Polizei.» Er sah auf und suchte Gévignes Blick. «Weißt du auch warum?»
«Nein, aber …»
«Irgendwann würdest du es doch erfahren … Diese Dinge lassen sich nicht lange verbergen.» Er versuchte zu lächeln, seine Sicherheit wiederzugewinnen. Aber Zorn und Scham machten seine Stimme heiser. «Ich habe etwas Furchtbares erlebt … Noch einen Schluck Porto?»
«Nein, danke.»
Flavières goß sich ein. Er behielt das Glas in der Hand. «Eine ganz dumme Geschichte. Ich war damals Inspecteur … Jetzt kann ich es ja sagen: Ich habe diesen Beruf nie geliebt. Wenn mein Vater mich nicht gezwungen hätte … Aber er hatte es zum Commissaire divisionnaire gebracht, und für ihn gab es nur diesen einen Beruf. Ich hätte mich weigern müssen. Keiner hat das Recht, seinem Sohn einen Beruf aufzuzwingen …
Nun, eines Tages mußte ich einen Burschen festnehmen. Er war nicht besonders gefährlich; er flüchtete nur unglücklicherweise auf ein Dach … Ich war mit einem sehr netten Kollegen unterwegs. Leriche hieß er.»
Flavières leerte sein Glas. Tränen brannten ihm in den Augen. Er hustete, hob resigniert die Schultern.
«Du siehst – jedesmal, wenn ich daran denke oder davon rede, verliere ich den Boden unter den Füßen … Das Dach war sehr steil. Man hörte die Autos tief unten durch die Straße fahren. Der Mann versteckte sich hinter dem Kamin. Er hatte keine Waffe. Es blieb nichts anderes übrig: Einer von uns mußte zu ihm hin. Ich konnte nicht …»
«Dir war schwindlig!» sagte Gévigne. «Ja, ich erinnere mich … Du hattest das früher schon.»
«Leriche ist hinuntergeklettert … Er ist abgestürzt.»
«Oh!» Gévigne senkte die Augen.
Flavières blieb vornübergebeugt sitzen. Er dachte an nichts mehr. Dann fuhr er leise fort: «Es ist besser, daß du es weißt.»
«Jeder kann mal die Nerven verlieren», murmelte Gévigne.
«Natürlich», sagte Flavières schroff.
Sie schwiegen.
Schließlich hob Gévigne die Arme: «Es ist furchtbar traurig, aber … Dich trifft keine Schuld!»
Flavières öffnete das Zigarettenkästchen. «Bedien dich, alter Freund.»
Jedesmal, wenn er seine Geschichte erzählte, fühlte er dieselbe ungläubige Bestürzung. Keiner verstand ihn. Wie sollte er den Schrei Leriches begreiflich machen, diesen entsetzlichen Schrei, der nicht enden wollte, der zuerst schrill war und immer dumpfer wurde … Vielleicht hatte Gévignes Frau einen heimlichen Kummer? Gab es eine schrecklichere Qual als eine solche Erinnerung? Vielleicht hörte sie auch einen Schrei, der sie bis in den Schlaf verfolgte? Vielleicht hatte sie auch zusehen müssen, wie ein Mensch für sie starb?
«Wirst du mir helfen?» fragte Gévigne.
«Was soll ich tun?»
«Auf sie aufpassen. Ich will wissen, was du von Madeleine hältst. Es hat mir schon sehr geholfen, daß ich mit jemandem über sie sprechen konnte … Du tust mir doch den Gefallen, ja?»
«Wenn es dich beruhigt …»
«Mein guter alter Roger! Du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich bin … Bist du heute abend frei?»
«Nein.»
«Schade; ich wollte dich zum Essen einladen, bei mir zu Hause … Morgen?»
«Nein. Es ist besser, wenn sie mich nicht kennenlernt. Das erleichtert mir meine Aufgabe.»
«Du hast recht», räumte Gévigne ein. «Aber du mußt sie ja irgendwann mal sehen.»
«Geh mit ihr ins Theater. Dort kann ich sie unauffälig kennenlernen.»
«Morgen gehen wir ins Marigny. Ich habe Logenplätze.»
«Ich werde hinkommen.»
Gévigne nahm Flavières’ beide Hände. «Danke … Ich wußte, daß ich auf dich zählen kann! Du läßt mich nicht im Stich. Apropos Theater …» Er griff in die Brusttasche, zögerte aber dann. «Sei mir nicht böse, alter Freund … Aber wir müssen noch etwas regeln. Du verstehst … Ich finde es schon ungeheuer nett, daß du dich um Madeleine kümmern willst.»
«Schon gut», sagte Flavières, «ich habe jede Menge Zeit.»
«Ist das wahr?»
Flavières schlug ihm auf die Schulter. «Der Fall interessiert mich, nicht das Geld. Ich glaube nämlich, wir haben manches gemeinsam, sie und ich, und … Ich sehe eine Chance, herauszufinden, was mit ihr los ist, was sie dir verheimlicht.»
«Aber ich versichere dir, sie verheimlicht mir nichts!»
«Wir werden sehen.»
Gévigne nahm Hut und Handschuhe. «Geht deine Praxis gut?»
«Aber ja», sagte Flavières, «ich kann mich nicht beklagen.»
«Wenn ich dir irgendwie nützlich sein kann … Von Herzen gern. Bei mir läuft alles phantastisch. Besonders im Augenblick.»
Kriegsgewinnler, dachte Flavières. Der Gedanke war ihm so plötzlich gekommen, daß er sich abwandte, um Gévignes Blick nicht zu begegnen. «Hier entlang», sagte er. «Der Aufzug funktioniert nicht.»
Sie standen im engen Treppenhaus. Gévigne kam ganz nah an Flavières heran.
«Tu, was du für nötig hältst», flüsterte er. «Und sobald du etwas herausgefunden hast, ruf mich im Büro an. Oder besser, besuche mich. Meine Firma ist in dem Gebäude neben dem Figaro … Um etwas möchte ich dich aber noch bitten: Madeleine darf nie erfahren, weswegen ich hier war! Wenn sie merken würde, daß sie beschattet wird … Nicht auszudenken, was dann passieren könnte!»
«Du kannst dich auf mich verlassen.»
«Danke.»
Gévigne stieg die Treppe hinunter. Er drehte sich noch zweimal um und winkte.
Flavières ging in seine Wohnung zurück und lehnte sich aus dem Fenster. Er sah, wie sich eine große schwarze Limousine vom Trottoir löste und auf die Kreuzung zuglitt.
Madeleine … Er liebte diesen Namen, der ein bißchen nach Sehnsucht klang. Warum hatte sie diesen Dicken geheiratet? Sicher betrog sie ihn. Sie spielte ihm eine Komödie vor. Es geschah Gévigne ganz recht, daß sie ihn betrog. Wegen seiner Nouveau-Riche-Allüren, seiner dicken Zigarren, seiner Schiffe, seiner Aufsichtsratspöstchen … Und überhaupt.
Flavières konnte Menschen mit so viel Selbstsicherheit nicht ausstehen. Trotzdem hätte er wer weiß was darum gegeben, wenn er auch nur einen Bruchteil von Gévignes Selbstsicherheit besessen hätte.
Er schloß das Fenster mit einem Knall. Dann trieb es ihn in die Küche, wo er sich einredete, er müsse etwas essen … Aber was? Er inspizierte die Konserven, die er in einem Schrank aufbewahrte. Auch er hatte Vorräte eingekauft, obwohl er es für idiotisch hielt, da der Krieg aller Wahrscheinlichkeit nach doch nicht mehr lange dauern würde.
Als. er die vielen Lebensmittel sah, wurde ihm plötzlich übel. Er holte sich ein paar Biskuits und eine angebrochene Flasche Weißwein. Eigentlich wollte er sich in die Küche setzen, aber dann fand er es dort doch zu ungemütlich, und er ging wieder in sein Arbeitszimmer, einen Keks knabbernd. Auf dem Weg dorthin schaltete er das Radio ein. Er wußte im voraus, was kommen würde: Spähtrupptätigkeit … Artilleriebeschuß auf beiden Seiten des Rheins … Aber die Stimme des Sprechers brachte ein bißchen Leben in seine vier Wände. Er setzte sich und trank einen Schluck Wein.
Bei der Polizei hatte er keinen Erfolg gehabt. Er taugte nicht für diesen Beruf … Wozu taugte er überhaupt? Er zog eine Schublade heraus, entschloß sich für einen grünen Aktenordner und schrieb in die rechte obere Ecke: Dossier Gévigne. Dann legte er ein paar weiße Bögen hinein.
Lange saß er in seinem Schreibtischsessel, ohne sich zu rühren, und starrte ins Leere.
2
Warum stelle ich mich nur so an? dachte Flavières wütend. Er spielte mit dem Opernglas und gab sich alle Mühe, unbeteiligt auszusehen. Er brachte es einfach nicht fertig, Madeleine durch das Glas zu betrachten.
Er saß zwischen lauter Uniformen. Die Damen in Begleitung der Offiziere hatten alle denselben Ausdruck von hochmütiger Selbstzufriedenheit. Flavières haßte sie. Er haßte die Armee, den Krieg und dieses viel zu luxuriöse Theater mit seinen martialischen und frivolen Geräuschen.
Als er den Kopf wandte, sah er Gévigne, die Hände auf der Brüstung der Loge. Madeleine, leicht zurückgelehnt, hatte den Kopf graziös zur Seite geneigt. Sie war brünett, schlank; ihr Gesicht konnte er nicht erkennen. Sicher war sie hübsch, nur ein bißchen zu mager. Vielleicht war auch der schwere Haarknoten im Nacken daran schuld.
Wie konnte nur diese elegante Frau den dicken Gévigne lieben? Wie konnte sie seine Zärtlichkeiten ertragen?
Der Vorhang war aufgegangen. Das Stück interessierte Flavières nicht. Er schloß die Augen und dachte an die Zeit, als er mit Gévigne in einem Zimmer gewohnt hatte, um Geld zu sparen. Sie waren beide schüchtern, und die Kommilitonen machten sich lustig über sie, was sie selbst absichtlich noch provozierten. Es gab Burschen, die ungeheuren Erfolg bei Frauen hatten. Besonders einer. Er hieß Marco und war weder schön noch intelligent. Als Flavières ihn eines Tages nach seinem Erfolgsrezept gefragt hatte, hatte Marco ihm grinsend geantwortet: ‹Du mußt mit ihnen reden, als ob du schon mit ihnen geschlafen hättest … Das ist das ganze Geheimnis!)