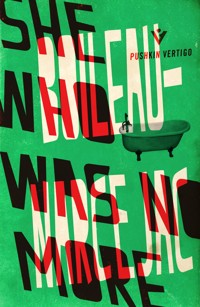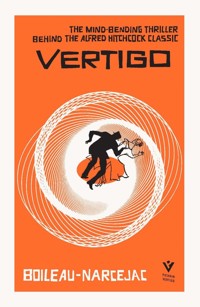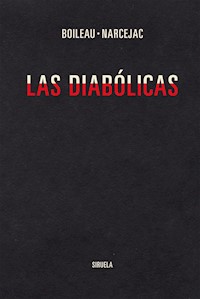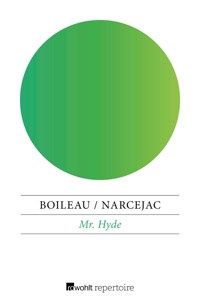9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wieder eine Warnung für Berthe Combaz. Keine Drohung, nur eine Feststellung. Beim erstenmal war es nur eine Frage gewesen, aber nichtsdestoweniger ebenso beunruhigend: «Wenn es nun kein Unfall war?» Dabei hat der Profi Gallois nur einen banalen Zusammenstoß auf der Piste gehabt, als er den neuen Combaz-Ski testen wollte. Dann allerdings hatte er vollends die Kontrolle über die Ski verloren und war gegen eine Tanne gerast. Schädelbruch. Tot. War es kein Unfall? Die polizeilichen und medizinischen Ermittlungen ergaben einwandfrei, daß es ein Unfall war. Aber wieso hat Gallois kurz vor dem Unfall eine große Summe Geldes auf seinem Konto erhalten? Werkssabotage oder die Konkurrenz? Der neue Combaz-Ski, von dem ehrgeizigen Ingenieur Langogne entwickelt, soll durch seine neue Beschichtung Traumzeiten ermöglichen, und Berthe Combaz, Erbin der großen Skisport- und -modenfirma Combaz, braucht diesen ‹Traumski›, um die konjunkturell bedingte Flaute im Geschäft zu überwinden. So riskiert sie alles … Georges Blancart, Freund von Berthe und Geliebter von Evelyne, Berthes Tochter, sieht die Katastrophe unausweichlich über sie hereinbrechen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Pierre Boileau • Thomas Narcejac
Schußfahrt
Aus dem Französischen von Elke Bahr
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Wieder eine Warnung für Berthe Combaz. Keine Drohung, nur eine Feststellung. Beim erstenmal war es nur eine Frage gewesen, aber nichtsdestoweniger ebenso beunruhigend:
«Wenn es nun kein Unfall war?»
Dabei hat der Profi Gallois nur einen banalen Zusammenstoß auf der Piste gehabt, als er den neuen Combaz-Ski testen wollte. Dann allerdings hatte er vollends die Kontrolle über die Ski verloren und war gegen eine Tanne gerast. Schädelbruch. Tot.
War es kein Unfall? Die polizeilichen und medizinischen Ermittlungen ergaben einwandfrei, daß es ein Unfall war. Aber wieso hat Gallois kurz vor dem Unfall eine große Summe Geldes auf seinem Konto erhalten? Werkssabotage oder die Konkurrenz? Der neue Combaz-Ski, von dem ehrgeizigen Ingenieur Langogne entwickelt, soll durch seine neue Beschichtung Traumzeiten ermöglichen, und Berthe Combaz, Erbin der großen Skisport- und -modenfirma Combaz, braucht diesen ‹Traumski›, um die konjunkturell bedingte Flaute im Geschäft zu überwinden. So riskiert sie alles …
Georges Blancart, Freund von Berthe und Geliebter von Evelyne, Berthes Tochter, sieht die Katastrophe unausweichlich über sie hereinbrechen.
Über Pierre Boileau • Thomas Narcejac
Die beiden französischen Autoren Pierre Boileau (1906–1989) und Thomas Narcejac (1908–1998) haben zusammen zahlreiche Kriminalromane verfasst. Ihre nervenzerreißenden Psychothriller haben viele Regisseure zu spannenden Filmen inspiriert, am bekanntesten sind wohl «Die Teuflischen» und sein amerikanisches Remake «Diabolisch» und «Vertigo – Aus dem Reich der Toten», sicher einer der besten Filme von Alfred Hitchcock.
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
Berthe Combaz
kämpft um ihre Existenz.
Evelyne Combaz
kämpft um Liebe.
Georges Blancart
sieht so lange zu, bis er das Nachsehen hat.
Langogne
entwickelt einen Wunderski und erlebt sein blaues Wunder.
riskieren Hals- und Beinbruch.
Marèze
begibt sich auf Glatteis.
Massombre
schnüffelt so lange, bis er die Nase voll hat.
1
«Mein lieber Georges», hatte Paul zu mir gesagt, «du magst verängstigt sein, besorgt, nervös oder was immer – aber krank bist du nicht. Das ärgert dich, nicht wahr? Dir wär es lieber, wenn ich von Depression oder vielleicht sogar von Neurose sprechen würde. Nichts davon! Du bist einfach … du hast eben fünfundsechzig Jahre auf dem Konto …»
«Und vier Monate.»
«Na schön, und vier Monate. Das richtige Alter, um Bilanz zu ziehen. Also zu deiner Bilanz, zunächst in Sachen Vermögen. Gib es zu – du bist privilegiert.»
«So reich bin ich nun auch wieder nicht.»
«Ich würde gerne mit dir tauschen – Miethäuser, ein Besitz am Meer, vermutlich einträgliche Geldanlagen und vor allem deine Gymnastikhalle, in der die prächtigsten Muskeln von Grenoble spielen, sowie dein Institut für Bewegungstherapie, wo man die schönsten Arthrosen bewundern kann. Übertreibe ich? Warte, ich bin noch nicht zu Ende … Deine erste Ehe war ein Reinfall, sei’s drum. Wenn man mit Zwanzig heiratet, kann man nichts anderes erwarten. Aber was war dann? Nun gut, Schwamm drüber, es ist wohl besser so. Ich werde den Namen Berthe Combaz nicht in den Mund nehmen, obwohl … Darf ich mir eine Bemerkung erlauben? Also, wenn du dich entschließen könntest, sie zu heiraten, nachdem ihr schon so lange zusammen seid – dann brauchtest du meiner Meinung nach keinen Seelendoktor … Soviel zu deiner Bilanz. Es ist die eines Mannes, dem alles geglückt ist. Schau dich nur an, alter Junge. Nein? Es ist dir wohl unangenehm, weil du zu denen gehörst, die sich selbst nicht mögen und die es vorziehen, Beruhigungspillen zu schlucken und sich unter Drogen zu setzen.»
«Nein, ganz und gar nicht. Ich will nur … Ach, wenn ich nur wüßte, was ich will!»
Darauf sagte Paul: «Nimm eine Zigarette, die ist heute erlaubt. Und hör mir zu. Ich weiß ein Heilmittel, das ich zwar nicht jedem empfehlen würde, aber ich denke, daß es dir helfen könnte, denn du wirst dich wohl seit der Schulzeit nicht ganz verändert haben. Erinnerst du dich? Du hast Gedichte gekritzelt, unvollendete Erzählungen verfaßt, und alle waren der Meinung: Blancart ist zum Schreiben geboren.»
«Irrtum! Leider bin ich zu überhaupt nichts geboren.»
«Nun gut, mein lieber Georges, dann wirst du eben jetzt geboren werden. Hier hast du meine Medizin: Von heute an wirst du ein Tagebuch führen. Nein, reg dich bitte gar nicht erst auf – du warst drauf und dran, zu einem Analytiker zu gehen, du warst bereit, lang und breit dein Leben zu beichten, nicht wahr? Na bitte, und ich verlange nur von dir, daß du es zu Papier bringst, alles … Nicht unbedingt deine seelischen Zustände – auf die können wir pfeifen –, aber das wirkliche Leben, die Äußerungen deiner Mitmenschen, die Welt, wie sie dich umgibt. Das wird dich zwingen, hinzuschauen, hinzuhören und dich selbst ein wenig zu vergessen, falls das möglich ist. Glaub mir, das ist besser als jede Arznei, und so wie ich dich kenne, wirst du Gefallen daran finden.»
«Mit anderen Worten: eine Neufassung von der SUCHE NACH DER VERLORENEN ZEIT für den Hausgebrauch?»
«Idiot! Du sollst dich einfach auseinandersetzen mit deiner Langeweile, deinem Überdruß, deinem Spleen – oder wie immer du es nennen willst –, du sollst diesen Spleen zwingen, sich auszudrücken. Er hat sich in dir versteckt, und du brauchst ihn nur aus dir herauszupressen wie den Eiter aus einem Geschwür. Dabei geht es nicht um Literatur, um schriftstellerische Klimmzüge – zumindest sind sie nicht unbedingt erforderlich. Hast du begriffen?»
«Nicht ganz. Wenn ich beispielsweise zum Dessert Camembert hatte, muß ich dann schreiben: Ich habe Käse gegessen – einfach so, dumm wie gedruckt?»
«Nein, du wirst schreiben: Ich habe Camembert gegessen. Das wichtige Wort ist ‹Camembert›. Es geht um den Sinn fürs Konkrete, Georges, weil du dabei bist, genau den zu verlieren. Dein Halt in der Realität ist dir abhanden gekommen.»
«Nehmen wir an, ich schriebe ein Tagebuch – muß ich es dir zu lesen geben?»
«Nicht nötig. Wenn die Methode anschlägt, wirst du von selbst weitermachen. Wenn nicht, wirst du es eben drangeben.»
Schließlich hatte Paul noch gesagt: «Ruf mich an von Zeit zu Zeit.»
Ich habe ein Heft gekauft und nicht gewußt, womit ich beginnen sollte. Vielleicht hätte ich Paul doch von Evelyne erzählen sollen. Alles kommt von Evelyne, und alles läßt sich auf sie zurückführen. Sie ist meine Krankheit. Es ist, als ob man einen strahlenden Lichtpunkt fixierte. Er blendet. Er breitet sich aus, wird im Kopf immer größer. Alles ringsum versinkt. Der Punkt bleibt noch lange auf der Netzhaut, schwebt wie ein Glühwürmchen durch das Straßenbild – genauso ist es mit Evelyne. Sie ist da, in diesem Moment, sie ist zwischen mir und meinem Blatt Papier. Sie drängt sich in meinen Blick: knabenhaft, unbekümmert, mit der Haartracht eines tollwütigen Hundes. Von vorn wirkt sie schon zu erwachsen, im Profil noch wie ein kleines Mädchen, eine Knospe. Paul hat recht, ich habe wirklich viel zu sagen, jedenfalls über Evelyne, zu ihr fällt mir ständig mehr ein. Was da mit mir passiert, ist von unendlicher Banalität, aber auch der Krebs ist schließlich banal, und trotzdem gibt es zu diesem Thema zahllose Bücher. ‹Wie ich meinen Krebs besiegt habe› und ähnliche Titel. Warum soll ich es also nicht auch versuchen? Was will ich denn im Grunde? Doch nur eines: Vergessen. Ich will nichts weiter als morgens lange schlafen mit der Aussicht auf einen Tag voller angenehmer kleiner Tätigkeiten – Freunde besuchen und abends vielleicht mit Berthe zum Essen ausgehen, falls sie bereit ist, ihre Sorgen wie ich an der Garderobe abzugeben. Großer Gott, endlich ein leeres Herz haben zu können!
Zurück zum «wirklichen Leben», wie Paul das nennt. – Ich habe Grenoble gestern nachmittag verlassen. Meine Direktoren verstehen ihr Geschäft, in dieser Hinsicht kann ich unbesorgt sein. Vorher ein Anruf bei Berthe.
«Ich fahre jetzt nach Port Grimaud, aber wir treffen uns Sonntag morgen in Isola. Fährst du mit Debel?»
«Ja, Langlois hat abgesagt, ist leicht erkältet. Langogne wird mit dem Lieferwagen vorausfahren, um ein ruhiges Plätzchen ausfindig zu machen. Obwohl ich glaube, daß jetzt zu Anfang der Saison noch nicht viel Betrieb sein wird in Isola. Wir werden zu viert sein und dort zum Mittagessen eintreffen.»
«Niemand ahnt etwas?»
«Kein Mensch.»
«Und Evelyne?»
«Oh, Evelyne! Wir haben uns dauernd in der Wolle. Ihre neueste Idee ist, eine kleine Wohnung mieten zu wollen. Und was immer ich sage oder tue, kümmert sie wenig, wie du dir denken kannst. Georges … glaubst du, daß es klappen wird?»
«Natürlich.»
Ihre Stimme zittert vor Nervosität, meiner fehlt es an Überzeugungskraft. Plötzlich diese Stille zwischen uns. Wir legen gleichzeitig auf. Jetzt meine Fahrt Grenoble-Port Grimaud minutiös zu beschreiben – so weit will ich denn doch nicht gehen! Was Paul da von mir verlangt, ist einfach lächerlich. Ich fühle mich schlicht außerstande, Dinge zu Papier zu bringen, die ich auswendig kann. Und diese Ski-Angelegenheit, mit der Berthe mich seit Monaten von früh bis spät langweilt, werde ich hier auch nicht nachbeten. Aber ich werde trotzdem aufrichtig sein – versprochen ist versprochen.
Ich erreiche mein Haus bei Einbruch der Nacht und beginne sofort mit meinen Notizen. Alles wird niedergeschrieben, ich nehme mir kaum die Zeit, meinen Mantel über den Sessel zu werfen – Pardon, Paul, meinen Kamelhaarmantel, um präzise zu sein. Dann greife ich zum Telefon. Hoffentlich ist dieser Rumtreiber schon zu Hause …
«Hallo, Massombre? … Ah, sehr erfreut, Sie zu hören. Hier spricht Blancart. Ich bin in Port Grimaud. Was gibt es Neues?»
«Sie sucht eine Wohnung.»
«Das weiß ich schon. Ihre Mutter hat es mir erzählt.»
«Nun, das ist alles.»
«Berichten Sie von den Einzelheiten.» (Seltsam – ich verlange von ihm genau das, was Paul mir abfordert. Nur bin ich schließlich kein Privatdetektiv.)
«Einzelheiten? … Nun, zunächst hat sie im Schnellimbiß gegenüber vom Bahnhof zu Mittag gegessen.»
«Allein?»
«Ja. Sie hat zwar ein paar Worte gewechselt mit einem Bärtigen, aber ganz kumpelhaft, wenn Sie wissen, was ich meine. Dann hat sie ihre Mahlzeit rasch beendet und danach bei den Maklern die Runde gemacht. Ohne nennenswerten Erfolg nach meinem Eindruck.»
«Und der Bärtige?»
«Den hat sie nicht wiedergetroffen.»
«Ist er in ihrem Alter?»
«Ja, Typ Student mit einem Hauch von Penner.»
«Und der andere? Der große Dünne?»
«Ist verschwunden.»
«Danke. Berichten Sie weiter.»
«Wissen Sie, Monsieur Blancart, Sie werfen Ihr Geld zum Fenster raus. Es ist zwar mein Job – ob ich sie nun beobachte oder eine andere, kann mir egal sein –, aber in diesem Fall ist es für die Katz.»
«Ich bezahle Sie dafür, daß Sie mir von ihr erzählen. Das ist alles.»
«In Ordnung, dann hab ich nichts gesagt.»
«Sperren Sie weiterhin die Augen auf. Guten Abend.»
Anfangs hatte ich Skrupel – ein alter Knabe wie ich an den Rockschößen eines 22jährigen Mädchens, das widerstrebte mir eigentlich. Es widerstrebte mir weniger, damit zu leben und darunter zu leiden, aber es einzugestehen … Deshalb erfand ich Ausreden, als ich die Dienste von Massombre in Anspruch nahm. «Sie müssen wissen, ihre Mutter ist geschieden und ihr Vater stadtbekannt in allen Kneipen. Was mich betrifft, ich bin für sie eine Art Onkel, der sich Mühe gibt, sie zu beschützen.» Kopfschüttelnd hatte mich Massombre beobachtet mit wachsamen Augen, die unter leicht ergrauten Brauen hervorsahen. «Ja, ich verstehe vollkommen.»
Er war natürlich sofort im Bilde, trotzdem hätte ich ihm gerne einiges erklärt. Ich brauchte seine Hilfe, aber vor allem seine Achtung; er sollte mich nicht falsch einschätzen. Und dann war das alles plötzlich wie weggefegt – die Skrupel, das Zögern, die Schamhaftigkeit. Was immer Massombre von mir denken mochte, es war mir gleich, solange er nur Evelyne im Auge behielt … Dieser Bärtige fing an, mir im Kopf herumzuspuken.
Ich bin nach draußen gegangen. Die Sterne standen zum Greifen nah, die Luft war trotz der winterlichen Jahreszeit mild und warm wie ein lebendiges Wesen. Ich hatte ein Gefühl von Unwirklichkeit, kam mir vor wie in einem Film: die Boote, die blumenumstandenen Häuser waren Kinokulissen, und ringsum herrschte die Stille eines riesigen Filmstudios. Fast erwartete ich das Geräusch der Szenenklappe, während ich langsam auf den Rand des Kanals zuschritt. In dieser Nacht war ich nur ein Statist im Theater des Absurden, war um nichts realer als die zu perfekt geweißten Häuserfassaden, die kleinen, artig geschwungenen Brücken, dieses ganze herzergreifende Disneyland, das mich schwach machte vor Elend und Einsamkeit.
Und ausgerechnet hier hatte ich für sie dieses Puppenhaus gekauft – provenzalisches Mauerwerk mit weißem Außenputz, alte Balken und überall an den Wänden die goldenen Reflexe des immer leicht bewegten Wassers. Sie war zur Besichtigung erschienen, hatte ihre Nase spöttisch da und dorthin gesteckt und gesagt: «Nun ja, nicht schlecht. Aber weißt du, Georges, ohne ein Segelboot vor der Tür wirkt es einfach kleinbürgerlich.» Daraufhin habe ich einen Motorsegler erstanden, Modell Excalibur. Er liegt vertäut am Rande meines kleinen Gartens. Das hübsche Spielzeug hat mich ein Vermögen gekostet, und von Zeit zu Zeit gondele ich mit ihm ein wenig durch die Kanäle, um der Maschine etwas Bewegung zu verschaffen. Aber überwiegend bleibt das Boot angeleint, die Spaziergänger verweilen davor und bewundern es. «Herrlich! Was für ein Glück manche Leute doch haben!» Wenn die wüßten …
Der Sinn meiner Aufzeichnungen soll darin liegen, alles loszuwerden, was ich Paul im Gespräch nicht zu gestehen wagte, und es sieht ganz danach aus, als würde Paul recht behalten. Je mehr ich schreibe, desto tiefer dringe ich in meine verborgensten Winkel, in die ich bisher nie hineingeleuchtet habe. Seit mehr als einem Jahr steht mein hiesiges Grundstück zum Verkauf, aber tatsächlich habe ich nicht die geringste Lust, mich von dem Besitz zu trennen. Dem Makler habe ich einen Preis angegeben, der selbst einen Ölscheich entmutigen würde. Ich drohe in Wirklichkeit nur mit dem Verkauf, und seither ist Evelyne außer sich. «Wenn du das tust, spreche ich nie wieder mit dir!»
«Aber ich bitte dich, mein Mädchen, die Tage, die du hier verbringst, lassen sich doch an einer Hand abzählen …»
«Na und? Schließlich ist es auch ein bißchen mein Haus, oder?»
Für einen solchen Verzweiflungsschrei würde ich alles geben, selbst wenn ich ihn nur einmal im Jahr zu hören bekäme. Ich habe vorgetäuscht, unerbittlich zu sein, habe von brachliegendem Kapital gesprochen, von aussichtsreichen anderen Projekten und dergleichen. Ich weiß, Geld – das sie völlig hemmungslos ausgibt – bedeutet ihr viel, und meine Argumente werden ihr zu denken geben, aber diesmal funktioniert es nicht. Sie will mich davon überzeugen, daß Port Grimaud etwas Außergewöhnliches hat. Ich behaupte das Gegenteil. Wir streiten uns. Was ich von ihr habe, sind Kräche, Vorwürfe und Spott – mit jemandem wie mir braucht man nicht zimperlich zu sein. Ich bin Mamas alter Freund Georges, dessen man sich jederzeit bedienen kann und den man flüchtig auf die Wange küßt, wenn er einem gerade einen Scheck zugesteckt hat mit den Worten «Pssst, davon braucht niemand zu wissen». Georges, den sie vor ihren Freunden sicher als Fossil bezeichnet, als alten Knacker …
Genug der Abschweifungen, zurück zu meinem eigentlichen Vorhaben. – Dank dieses Hauses in Port Grimaud bin ich für Evelyne wenigstens vorhanden. Und das bedeutet für mich, noch lebendig zu sein. Aus diesem Grund ertrage ich auch die gelegentlichen Besuche von Kauflustigen. Madame Siponelli aus dem Maklerbüro führt die Kundschaft von Zimmer zu Zimmer und enthält sich jeden Kommentars. Sie läßt bewundern. Derweil habe ich mich ins Gästezimmer zurückgezogen und lausche hinter angelehnter Tür, um mir kein Wort entgehen zu lassen. Im allgemeinen interessieren sich Paare für das Objekt. Der Mann, der den Preis im Kopf hat, begnügt sich gewöhnlich mit unverbindlichem Gemurmel. Es sind immer die Frauen, die sich nicht lassen können. «Reizend! Wirklich entzückend! Und was für ein schöner Blick! … Dieser hinreißende Garten … wie geschmackvoll! … Henri, du sagst ja gar nichts?» Darauf er mit einem Hauch von Feindseligkeit: «Wie war noch der Preis?»
«Dreiundzwanzig Quadratmeter», antwortet Madame Siponelli, «und das Erdgeschoß mit der Terrasse hat noch einmal zweiundzwanzig. Wir nennen diesen Haustyp ‹Fischerhütte›.»
Man flüstert, man bespricht sich. Ich spitze die Ohren und denke, daß ich gut daran getan habe, mich hier einzukaufen. Die Begehrlichkeit der Interessenten zeigt mir, daß man sich in dieses Haus verlieben kann und daß Evelyne am Ende hierbleiben wird. Die Stimmen entfernen sich. Am Ufer bleibt das Paar noch einmal stehen, die Frau wirft einen langen Blick zurück auf das Haus. Ich beobachte sie aus einem Winkel des Fensters und ahne, daß sie soeben leise klagt: «Wie schade!»
Hörst du das, Evelyne? … Für diese Leute bin ich ein beneidenswerter Mann. Wenn ich dich nächstens wiedersehe in Grenoble, werde ich dich ein bißchen ärgern und dir sagen: «Beinahe hätte ich verkauft.» Und du wirst antworten: «Ich verabscheue dich» – und damit wird dann auch für mich ein Krümchen Liebe abgefallen sein.
Es gefällt mir nicht besonders, dieses Port Grimaud am Morgen. Es ist zu farbig, geschminkt, aufgedonnert – kurzum touristisch. Mir ist das nächtliche, das unerkannte Port Grimaud lieber, in dem die Reflexe des Wassers irrlichtern. Das Meer ist überall, aber bei Tage ist es nichts weiter als ein zahmes Wasser. Sein wirkliches Leben beginnt bei Nacht, in den schwachen Stunden. Ein leises, demütiges Leben aus heimlichem Geplätscher, sanfter Brandung und freundlichem Hauch. Ein Meer, das den nächtlichen Wanderer umgarnt. – Ich gehe langsam nach Hause, werfe noch einen Blick auf mein Boot, auf dem ich auch schon übernachtet habe. Um die Instandhaltung des Bootes kümmert sich ein alter Fischer, der mich stets militärisch grüßt mit einer Hand an seiner traurig schlaffen Seglermütze. Von der Terrasse aus höre ich schon das Läuten des Telefons. Bestimmt ist es Berthe, die so lange anrufen wird, bis ich mich melde. Besser, es gleich hinter sich zu bringen.
«Berthe? … Ist etwas passiert?»
«Nein, ich wollte nur wissen, ob du gut angekommen bist.»
«Bin ich, wie du hörst. Übrigens ist es schon nach elf, du solltest bereits schlafen.»
«Kann ich nicht. Ich bin voller Ungeduld, nach Isola zu kommen. Ich wünsche mir so, daß alles klappt. Langogne ist seiner Sache ganz sicher. Er ist jetzt schon begeistert, aber das ist er ja immer. Was mich betrifft, ich warte dein Urteil ab.»
«Mein Urteil … das ist sehr freundlich, aber ich laufe doch inzwischen so wenig Ski.»
«Trotzdem! Der Unterschied soll gewaltig sein. Du wirst sehen.»
«Was knabberst du da?»
«Bonbons – wenn ich aufgeregt bin, kann ich einfach nicht anders, das weißt du genau.»
Was sie nicht erwähnt, ist die Tatsache, daß sie nur Lust hat zu plaudern. Sie lehnt in ihren Kopfkissen, hat die Packung Stuyvesant nebst Feuerzeug zu ihrer Linken, die Bonbontüte sowie den Aschenbecher zur Rechten – und ihr Opfer an der Strippe. Mal Françoise Debel, mal Lucienne Favre oder eine andere. Heute abend bin ich dran. Sie wird mir ihren Tagesablauf erzählen und gelegentlich ein «Hörst du mir zu?» einflechten, um sicherzustellen, daß ich mich ebenfalls wachhalte.
«Wenn ihr alle dafür seid», fährt Berthe fort, «dann müssen eine Menge Dispositionen getroffen werden. Mir dreht sich jetzt schon alles im Kopf. Eine so große Sache zu lancieren! … Wenn wir uns irren, können wir einpacken, aber wenn es klappt, werden wir einen Haufen Geld machen.»
Evelynes Sprache hat auf Berthe abgefärbt, das gehört nicht zu ihrem üblichen kleinen Schwatz. Sie ist zweifellos im Begriff, mir irgendwelche Geständnisse zu machen. Ich kann es förmlich riechen.
«Georges, vielleicht wird das meine letzte Schlacht sein …»
«Aber, aber!» besänftige ich sie höflich.
«Doch, doch! Die Fabrik ist nicht dafür ausgestattet, große Serien zu produzieren. Außerdem wird sich die Frage nach dem passenden Preis stellen. Er muß konkurrenzfähig sein, aber ich darf die Kosten nicht aus dem Auge verlieren. Die Partie ist noch keineswegs gewonnen.»
«Wir sind doch da, um dir zu helfen.»
«Ja, darauf baue ich auch, denn ich habe nicht mehr den alten Schwung. Alles ist so kompliziert geworden – die Banken, die Werbung, das Personal mit seinen Forderungen … Es gibt Augenblicke, wo ich alles hinwerfen möchte. Stell dir vor … wenn ich verkaufe, würden wir erstens ein ausgezeichnetes Geschäft dabei machen, und außerdem könnten wir uns ein nettes kleines Leben zu zweit aufbauen. Du wirst auch alles zu Geld machen, wir werden fortgehen und endlich weit weg vom Schnee leben! Zum Beispiel in Port Grimaud, warum nicht? … Hörst du mir zu?»
«Natürlich. Aber vorher muß sich der neue Ski Combaz durchsetzen.»
«Ich geh dir auf die Nerven, was? Ich weiß, was du denkst … Du sagst dir, daß Berthe Combaz nicht der Typ ist, auf einen fetten Brocken zu verzichten, dafür liegt ihr zuviel an Macht und an Geld … Evelyne schmettert mir das auch bei jeder Gelegenheit um die Ohren … Macht nichts, also gut, geh schlafen. Wir werden morgen in Isola darauf zurückkommen. Langogne wird alles Nötige mitbringen. Versuch, pünktlich um elf Uhr dazusein. Gute Nacht, mein kleiner Georges. Wie ist das Wetter in Port Grimaud?»
«Ideal.»
«Lügner, du redest Unsinn. Aber ich mag dich trotzdem.»
Sie legt auf, ich auch. Ihre krankhafte Sucht, über alles und jeden zu verfügen – vor allem über mich! Ich werde mir noch einen Kaffee machen. Siehst du, Paul, ich notiere und notiere. Jetzt zum Beispiel könnte ich schreiben, daß ich übellaunig bin, aber du hast ja gesagt: «Deine seelischen Zustände – auf die können wir pfeifen.»
Soll Berthe also meinetwegen zum Teufel gehen mitsamt ihrem verdammten Ski. Aber es drückt mir auf die Seele, dieses «Du wirst auch alles zu Geld machen» – ob es mir paßt oder nicht, wohlgemerkt. – Die Fortsetzung werde ich mir morgen erzählen. Alles in allem finde ich diese Art seelischer Schädlingsbekämpfung zunehmend unterhaltsam.
Ein neuer Tag. Er liegt vor mir wie ein abschüssiger Pfad, der ins Nichts führt. Jeder Morgen beginnt mit dieser Stimmung. Und während ich später in Isola den Hanswurst abgeben werde, wird Evelyne … Wer weiß, vielleicht erwacht sie eben jetzt in den Armen eines guten Freundes, denn sie ist ja mit aller Welt gut Freund – außer mit mir! Massombre kann ihr schließlich nicht überallhin folgen … Wenn man es recht bedenkt, hat die Situation etwas Komisches: Meine Eifersucht bezieht sich nicht auf Berthe, sondern auf Evelyne, während Berthe wiederum meinetwegen eifersüchtig ist und sich fragt, warum ich immer ausweiche, sobald sie das Gespräch auf unsere gemeinsame Zukunft lenkt. Und dann Marèze, Berthes Ex-Mann, der sich dauernd betrinkt, um ihr ein schlechtes Gewissen zu verursachen, weil er es nicht schafft, sich von ihr zu lösen. Langogne wiederum ist ein Sonderfall. Er ist eifersüchtig auf diesen Ski, der ist sein Schatz, den niemand auch nur berühren darf. Überall wittert Langogne Verräter, die ihm seine Erfindung stehlen wollen. Wahrhaftig, wir Menschen ähneln einem Knäuel von Schlangen, das in der Wärme eines Misthaufens überwintert. Wenn ich mich beim Erwachen aus dieser Winterstarre lösen muß, empfinde ich alles als Angriff. Der Rasierer schrammt mir die Haut auf, der Kaffee schmeckt wie Gift, mein Peugeot verhöhnt mich, weil er nicht auf Anhieb startet. Und Madame Guillardeau, meine Haushälterin in Port Grimaud, meine Hüterin, die Seele meines Heims, ist unpünktlich. Ich werde sie aus Isola anrufen müssen, um ihr mitzuteilen, daß ich erst in einer Woche wieder dasein werde.
Warum eigentlich ausgerechnet Isola? Diese Frage geht mir nicht aus dem Kopf, denn die Gegend rund um Grenoble ist nicht eben geeignet, auf diskrete Weise einen sagenhaften neuen Ski zu testen. Hatte Langogne diesen Einfall oder stammt er von mir? Ich erinnere mich nicht, vermute aber, daß es meine Idee war. Ich hatte wohl vergessen, daß die Straßen im Dezember nicht gerade leicht zu befahren sind und daß in Isola noch nicht sehr viel Schnee liegen wird. Daran zu denken, macht mich nicht fröhlicher, und ich beschließe, mich mit Radiohören abzulenken. Vorhang. Ankündigung auf der Bühne meines Inneren: Keine Vorstellung. –
In Isola werde ich ungeduldig erwartet. Berthe kommt mir entgegen, ausgestattet mit Pelzmütze, Pelzmantel und Trapperstiefeln. Hinter ihrem dampfenden Atem erscheint eine frostrote Nase.
«Alles gut gelaufen?»
«Was?»
«Nun, die Fahrt von Port Grimaud hierher?»
«Sehr gut. Trockene Straßen und fast kein Verkehr.»
Sie tritt einen Schritt zurück.
«Wie siehst du denn aus, mein armer Liebling? Man sollte meinen, du hättest nichts anzuziehen. Ein Glück, daß fast kein Mensch im Hotel ist! Also los, wir wollen uns beeilen.»
Sie nimmt mich bei der Hand, und wir überqueren im Laufschritt den Parkplatz. Debel sitzt in der Bar vor einem Whisky. Ganz der alte Debel mit dem rosigen, bartlosen Gesicht und den jungenhaft fröhlichen, blauen Augen, die ein wenig hervorstehen. Fünfzig Jahre ist er alt und sieht aus wie dreißig, während ich … Bei Langogne allerdings ist es genau umgekehrt. Statt der dreißig, die er zählt, gäbe man ihm gut und gerne fünfzig. Seine faltige Stirn, Augenbrauen so dick wie Raupen und eine Brille, die er dazu benutzt, sich zu kratzen oder seinen Redefluß gestisch zu untermalen. Überhaupt dient ihm die Brille eher dazu, seine Hände beschäftigt zu halten, und wenn die Gläser einmal zufällig vor seine Augen geraten, entdeckt man dahinter einen unruhigen, versteckten Blick, der sich dem Gegenüber entzieht.
«Willst du einen Kaffee?» fragt Berthe.
«Nein, danke.»
«Nun, dann wollen wir aufbrechen.»
Schon sind wir wieder unterwegs. Berthe und Langogne vorneweg, Debel und ich folgen mit einigen Schritten Abstand.
«Solange der Vorstand keine Entscheidung getroffen hat», meint Debel, «vergeuden wir nur unsere Zeit. Und ich fürchte ohnehin, daß wir enttäuscht sein werden. Was ist bei Skiern noch groß zu erfinden?»
Langogne hat unterdessen die Türen des Lieferwagens geöffnet und entnimmt ihm mit äußerster Vorsicht ein langes, in ein Leinenfutteral gehülltes Paket. Mit zunehmendem Eifer erklärt er:
«Rein äußerlich haben diese Bretter nichts Besonderes zu bieten. Auf den ersten Blick sind es die serienmäßigen Ski Combaz – klassische Bindung, gleiche Länge, gleiche Elastizität. Nur die Beschichtung unterscheidet sich.»
Er übergibt Debel einen Ski und reicht mir den anderen.
«Das Gewicht ist natürlich dasselbe. Aber streicht einmal über die Unterfläche, ohne die Wachsschicht einzudrücken – übrigens habe ich heute ein ganz gewöhnliches Wachs genommen, um die Demonstration noch überzeugender zu machen –, eure Fingerspitzen werden fühlen, wie glatt das ist. Erstaunlich, nicht wahr? Als ob in diesem Ski Tempo steckte. Monsieur Blancart, was meinen Sie? Sie haben doch so viel Erfahrung.»
«Das schon, aber es ist lange her.»
«Ein Grund mehr. Ihr Eindruck wird um so beweiskräftiger sein.»
Er nimmt die Skier wieder an sich und legt sie über seine Schulter. Unermüdlich setzt er seine Werbung fort:
«Hier entlang, wir haben es nicht weit. Die wirklich wichtigen Prüfungen werden später erfolgen. Was mich für den Moment interessiert, ist lediglich die erste Probe eines einst guten Skiläufers auf dem Schnee für jedermann.»
Etwas gelangweilt bringt Debel die Skistöcke. Er hat eine seltsam buntscheckige Mütze auf dem Kopf, wohl um unter den Ortskundigen nicht deplaziert zu wirken. Er friert und wäre offenkundig lieber woanders. Ich gehe zu Berthe, während Langogne die Bodenbeschaffenheit prüft und sich wachsam im Gelände umsieht.
«Weiß Evelyne Bescheid?»
Sie zieht die Schultern hoch.
«Nein, mein armer Georges. Du wiederholst dich, ich hab dir doch gesagt – nein. Sonst läuft sie womöglich zu ihrem Vater, um ihm alles brühwarm zu erzählen.»
An einer Stelle, wo einige schüchterne Anfänger lachend ihre ersten Laufversuche unternehmen, bleibt Langogne stehen. Niemand beachtet uns.
«Hier», entscheidet Langogne, «ebener Boden, fester Schnee. Ein herkömmlicher Ski wüßte auf dieser Unterlage nicht, wie ihm geschieht, und man müßte mit den Stöcken nachhelfen. Also, Monsieur Blancart, auf die Bretter, jetzt sind Sie dran!»
Ich finde allmählich Gefallen an diesem Versuch. Es ist wahr, ich habe das Skilaufen immer genossen – und es ist ebenso wahr, daß es den Grundstock zu meinem Vermögen gelegt hat. Zerrungen, Brüche, wiederherzustellende Gliedmaßen – alle Sorten Unfälle sind bei mir vorstellig geworden. Mal sehen, ob der Ski Combaz mir weitere Begegnungen dieser Art bescheren wird …
2
Ich habe die richtigen Griffe nicht verlernt, stehe schon auf den Skiern und stütze mich kaum auf die Stöcke. Ein leichter Druck – unglaublich! Ich gleite langsam vorwärts. Es erinnert eher an Eiskegeln als an Skilaufen.
«Lassen Sie’s laufen», ruft Langogne.
Ich lege mehrere Meter zurück – ohne Anlauf und ohne das geringste Gefälle ausmachen zu können. Diese Skier scheinen mit einer Art Spürsinn begabt zu sein, der sie von einer unsichtbaren Erhebung zur nächsten kaum wahrnehmbaren Neigung trägt. Es hat fast etwas Beunruhigendes, aber die Verheißung einer Behendigkeit von Luft weckt in meinen alten Beinen eine verloren geglaubte Munterkeit.
«Geben Sie Tempo», rät Langogne.
Instinktiv nehme ich Anlauf. Knieschwung, Hüftschwung, ich fühle mich prächtig – und bremse im gleichen Augenblick. Das geht mir zu schnell, ich laufe mir selbst davon. Wahrhaftig, ich reite auf dem Wind …
«Vorwärts! Vorwärts!»
Die anderen sind außer sich vor Begeisterung. Ich ziehe es vor, anzuhalten, was nicht ohne Schleudern abgeht. Mein Atem geht heftig wie nach einem Sprint. Langogne tritt zu mir.
«Also, Monsieur Blancart, wie ist Ihr Eindruck? Ehrlich und frei heraus!»
«Sie sind ein Zauberer, Langogne.»
«Nicht wahr?» ruft er unbeschwert. «Versuchen Sie’s von weiter oben mit ein wenig Gefälle. Es lohnt sich.»
«Nein, danke. Das würde mit einem netten Sturz enden. Einen Sonntagsreiter sollte man nicht auf ein Vollblut steigen lassen.»
«Siehst du, wir haben nicht gelogen», sagt Berthe.
«Hast du’s schon mal versucht?»
«Aber sicher, in Alpe-d’Huez. Nur für eine allererste Fühlungnahme – und im Nu lag ich am Boden.»
«Ja», erläutert Langogne, «mit diesem Gerät muß man eine Zeitlang neu lernen. Dennoch – wenn man erst daran gewöhnt ist, wird man vielleicht nicht gleich doppelt so schnell sein wie andere, aber ich kann zusichern, daß man – bei gleichem Gewicht und gleichen Vorkenntnissen – auf einer herkömmlichen Abfahrt mehrere Sekunden gewinnt.»
«Das wird sich noch zeigen müssen», bemerkt Debel. «Bis jetzt habt ihr nur die Meinung von uns dreien. Glaubt ihr nicht auch, daß das ein bißchen knapp ist?»
Langogne ist unzufrieden. «Sie vergessen das Urteil des Laboratoriums, und Sie kennen mich schlecht, wenn Sie annehmen, daß ich mir die Sache leichtmache.»
Berthe schlägt sich auf Langognes Seite.
«Monsieur Langogne arbeitet an dem Ski … wie lange schon? Seit mehreren Jahren, nicht wahr?»
«Seit vier Jahren. Nicht am Ski selbst, sondern an dem Kunststoff, mit dem die Unterseite ausgerüstet ist. Wenn Monsieur Blancart nicht weitermachen will …»
«Nein», sage ich, «ich bin hinreichend überzeugt.»
«Nun, dann wollen wir zurückgehen. Ich werde Ihnen alles Weitere beim Mittagessen auseinandersetzen. Was mich betrifft, ich bin halb erfroren.»
Er verstaut die Skier in ihrem Etui mit der liebevollen Vorsicht eines Geigers, der seine Stradivari einpackt. Berthe nimmt meinen Arm.
«Ich muß gestehen», sagt sie, «daß ich euch für diese fünfminütige Probe eine ziemlich lange Anreise zugemutet habe. Aber erstens hat die Saison hier gerade erst begonnen, zweitens – und vor allem – kann ich sicher sein, nicht auf ungebetene Zuschauer zu stoßen. Du weißt, diese Sorte neugieriger Leute, die sich wundert ‹Was haben Sie denn da an den Füßen? Das fährt ja von allein.› Und solche Neugierigen, die uns kennen, gibt es reichlich rund um Grenoble. Na, bist du wirklich überzeugt? Du hast uns nicht nur einen Gefallen …»
«Aber nein, ich versichere es dir. Langogne hat ein tolles Ding erfunden. Ich nehme an, ihr seid durch ein Patent geschützt?»