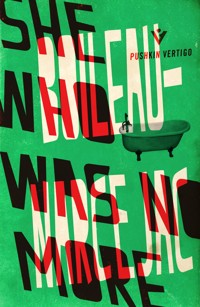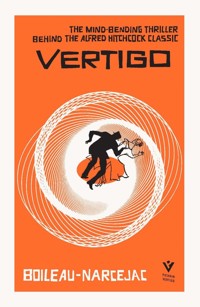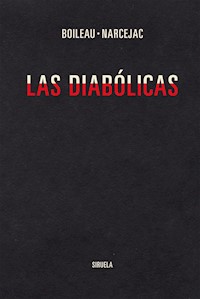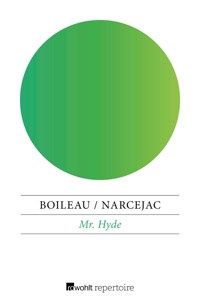4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jacques Christen wollte ein großer Geiger werden ... statt dessen wurde er Paul de Baer. Warum er seine Identität aufgab, das heißt, was ihn bewegte, und was die anderen bewegte, die ihm den Vorschlag machten – das ist eine komplizierte Geschichte. Der seltsame Diener Frank hatte sich dem jungen Musiker genähert, wie sich der Böse jenem Peter Schlemihl genähert hat, der seinen Schatten verkaufte. Aber Christen verkauft nicht seinen Schatten – er verkauft sich selber. Wer zahlt am Ende? Seine undurchsichtigen Auftraggeber? Die Frau, die ihn liebt? Die Rechnung wird präsentiert. Aber dann ist es in Wirklichkeit eine recht alte Rechnung – ein Wechsel aus der Vergangenheit, prolongiert auf die Gegenwart. Es gibt Justizirrtümer. Wie sollte der nicht irren, der das Recht in die eigene Hand zu nehmen glaubt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Pierre Boileau • Thomas Narcejac
Die Karten liegen falsch
Aus dem Französischen von Justus Franz Wittkop
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Jacques Christen wollte ein großer Geiger werden ... statt dessen wurde er Paul de Baer. Warum er seine Identität aufgab, das heißt, was ihn bewegte, und was die anderen bewegte, die ihm den Vorschlag machten – das ist eine komplizierte Geschichte. Der seltsame Diener Frank hatte sich dem jungen Musiker genähert, wie sich der Böse jenem Peter Schlemihl genähert hat, der seinen Schatten verkaufte. Aber Christen verkauft nicht seinen Schatten – er verkauft sich selber.
Wer zahlt am Ende? Seine undurchsichtigen Auftraggeber? Die Frau, die ihn liebt? Die Rechnung wird präsentiert. Aber dann ist es in Wirklichkeit eine recht alte Rechnung – ein Wechsel aus der Vergangenheit, prolongiert auf die Gegenwart.
Es gibt Justizirrtümer. Wie sollte der nicht irren, der das Recht in die eigene Hand zu nehmen glaubt?
Über Pierre Boileau • Thomas Narcejac
Die beiden französischen Autoren Pierre Boileau (1906–1989) und Thomas Narcejac (1908–1998) haben zusammen zahlreiche Kriminalromane verfasst. Ihre nervenzerreißenden Psychothriller haben viele Regisseure zu spannenden Filmen inspiriert, am bekanntesten sind wohl «Die Teuflischen» und sein amerikanisches Remake «Diabolisch» und «Vertigo – Aus dem Reich der Toten», sicher einer der besten Filme von Alfred Hitchcock.
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
Jacques Christen
ein heruntergekommener Musiker
Frank Mayer
ein undurchsichtiger Diener
Paul de Baer
ein unsympathischer Toter
Gilberte de Baer
eine rätselhafte Witwe
Martin
ein schweigsamer Kranker
(Diese Angaben sind z.T. unrichtig)
Der Alte: Das bin ich. So nennen sie mich … Sie wollen einen verrückten, grausamen Einzelgänger in mir sehen. Sie reden von meiner ‹wunderbaren Intelligenz›, von meiner ‹grenzenlosen Macht›. Wenn man all den Büchern Glauben schenken wollte, die meiner bescheidenen Person einen übertriebenen Wert beilegen, dann wäre ich wirklich zu so etwas wie dem ‹Fürsten dieser Welt› geworden. Allwissend. Allgegenwärtig. Herr über Leben und Tod … Sie machen einen Mythos aus mir. Ich stehe jenseits von Gut und Böse. Einen wahren Kult treibt man mit mir. Ich habe es satt. Um mit dieser absurden Legende aufzuräumen, habe ich mich heute entschlossen, mich sozusagen zu ‹entmythologisieren›. Ich bin nur ein Mensch wie alle anderen; etwas skeptischer vielleicht, weil ich allzu viel Unvernünftiges gesehen und auch selbst manches Unvernünftige getan habe. Der Krieg ist mein Handwerk; das stimmt. Die Besiegten haben mir niemals ein übertriebenes Mitleid eingeflößt. Aber da sind auch die vielen, vielen Unschuldigen, die für andere bezahlen, durch verirrte Kugeln sterben, aus Versehen umgebracht werden. Die Geheimaktion ist stets der Grund zu unnötigen Tragödien, die niemand vorausgesehen hat und die unwiderruflich bleiben.
Ich denke oft über diese Tragödien nach. Sie haben etwas … Wie soll ich sagen? Etwas Tückisches, Verfängliches und Unerklärliches. Sie sind der schlammige und blutige Abfall beim Kampf im Untergrund. Ich habe Erfolge erzielen können. Ich habe sie vergessen. Dagegen verfolgt mich die Erinnerung an diese absurden Toten. Wäre ich ein Schriftsteller, von ihnen würde ich erzählen, um dem Publikum zu zeigen, daß die Spionageaffären durchaus nicht das sind, wofür man sie gemeinhin hält.
Übrigens interessiert mich der Spion sehr viel weniger ak seine Frau oder sein Bruder oder sein Freund – die Menschen, die zugrunde gehen werden, weil sie jemand lieben, der zwei Gesichter, zwei Leben, zwei Gefühlswelten hat, ohne daß man es weiß. Der Spion trägt eine Maske, und diese Maske hält man für sein wahres Gesicht. Man irrt sich, und die Tragödie beginnt; die Tragödie des Irrtums ist die unerträglichste von allen.
Da mir jedes literarische Talent abgeht, will ich mich darauf beschränken, für diese erste Geschichte nur das Rohmaterial vorzulegen: intime Tagebuchblätter und Berichte. An Hand dieser Dokumente wird der Leser nach und nach eine Wahrheit Gestalt annehmen sehen, der ich nicht gern ins Gesicht blicke. Mag er selbst urteilen. Ich habe es bereits getan.
Das Tagebuch von Jacques
Es ist blödsinnig, ein Tagebuch zu führen; ich weiß es wohl. Aber in den letzten drei Wochen sind mir so viele Dinge zugestoßen, und zwar derartig ungewöhnliche Dinge, daß ich einen Standpunkt suchen und mir die Zeit nehmen muß, mit mir ins reine zu kommen und mich so zu sehen, wie ich ‹vorher› war, wenn ich mich nicht ganz und gar verlieren will; das fühle ich. Wahrhaftig, ich weiß kaum noch, ob ich Jacques Christen bin oder der andere. Soweit ist es schon. Ich hätte nicht darauf eingehen dürfen. Jetzt bin ich eine Art Gefangener auf Ehrenwort. Ich kann nicht ausbrechen. Dazu ist es zu spät. Wenigstens werde ich mit gutem Recht sagen können, falls ich einmal diese Aufzeichnungen zu meiner Verteidigung vorlegen muß, daß ich teils gegen meinen Willen hierherkam.
Ich müßte eigentlich die ganze Geschichte von Anfang an bis ins kleinste Detail rekonstruieren. Aber gerade dies ist mir widerlich. Ich bin niemals besonders methodisch veranlagt gewesen. Ich liebe die Unordnung, und ich glaube wohl, daß mein ganzes Unglück nur daraus entstanden ist. Ich habe immer in den Tag hinein gelebt. Ich habe stets auf morgen verschoben, was ich heute hätte besorgen können. Alle, die Interesse an mir genommen haben – und Gott weiß, wie ich es darauf angelegt habe, sie zu entmutigen –, haben immer wieder gesagt, daß ich es mit meinen Gaben weit bringen könnte … Und es ist wahr: Mit zwanzig Jahren war ich ein wirklich vielversprechender Geiger. Wenn jemand an meiner Stelle den Willen aufgebracht und mich gezwungen hätte, dieses Talent auszunützen, das sich fast mühelos entfaltete, wenn irgend jemand mich an die Hand genommen hätte, wie ein Manager es mit einem Boxer tut – ich wäre vielleicht einer der ganz Großen geworden. Aber ich hatte kein Geld; ich verstand es nicht, Gönner zu finden; ich wußte nicht, daß der Erfolg sich nicht dem Besten, sondern dem Schlauesten zuneigt. Und außerdem war ich ein hübscher Bursche. Ich sage das ganz naiv, denn eigentlich habe ich nie ganz begriffen, was das heißt: hübsch zu sein. Ich habe bloß so viele Frauen mit dem gleichen ein wenig schmerzlichen Akzent mir immer wieder sagen hören: Gott, siehst du gut aus!, daß ich es schließlich selber glauben muß. Oh, ich habe mich nicht dazu zwingen müssen. Es schmeichelte mir natürlich. Es war ein reizendes Spiel, von einer zur anderen zu flattern, sie mit der Musik einzulullen, sie ganz sachte einzufangen … Es hat mir schon Spaß gemacht! Ich bemerkte gar nicht, daß ich damit die Zeit vergeudete, in der ich hätte vorankommen müssen. Ich nahm Engagements an, über die ich hätte rot werden sollen. Ich spielte in Kasinos, in Musikcafés. Meine Lehrer hatten mir den Rücken gekehrt. Und doch kam es mir gar nicht zum Bewußtsein, daß ich herunterkam. Erst in Cannes … Damals in Cannes wurde es mir auf einmal in erschreckender Weise klar. Ich spielte dort in einem Lokal, das gerade ‹chic› war. Die Atmosphäre von Freizeit, Sonne, von leichten Liebesabenteuern, von Reichtum sagte mir zu. Ich spielte die kleinen effektvollen Stücke, die zur Teestunde die weiblichen Badegäste so bezaubern: Chinesisches Tamburin, Csárdás … Man applaudierte mir; ich verneigte mich tief, wie ein Gaukler, der ich ja auch war. Eines Tages machte ich mich ohne besonderen Anlaß an das ‹Air› von Bach. Ich fühlte sofort, wie sich von Tisch zu Tisch Stille ausbreitete. Die Leute hielten mit Schwatzen inne. Ich erriet, daß man anderen einen Wink gab, den Mund zu halten. Ich sehe noch einen Kellner vor mir, wie er mit einem Tablett voller Flaschen unbeweglich verharrte. An jenem Tag erfüllte mich die Musik. Ich weiß nicht, warum sie gerade mich gewählt hatte, der ich in jenen Minuten doch so unwürdig war. Noch lange werde ich an die Augenblicke zurückdenken, die auf die letzte Note folgten, an das verblüffte Schweigen, an das Klirren eines fallenden Löffels und an den einsetzenden Begeisterungssturm, so plötzlich, so jäh, daß ich die Augen schloß … Es war so stark, so süß, so überwältigend, was mich in jenem Augenblick erfüllte, daß ich plötzlich allem übrigen abschwor. Im Mund hatte ich den galligen Geschmack von Verachtung und von Schande. Am Abend dachte ich daran, mich umzubringen. Vielleicht hätte ich in jenem Augenblick Schluß machen sollen. Doch ich war viel zu geneigt, mich selbst zu bemitleiden. Und außerdem rechnete ich noch mit einer Chance. Ich war eine Art Zigeuner geworden, ich ekelte mich vor mir selbst, aber wider alle Wahrscheinlichkeit hoffte ich noch. Ich war noch keine dreißig Jahre alt.
Ich will nicht schildern, wie man mit offenen Augen, mit dem klaren Bewußtsein von dem, was man verloren hat, den Abhang hinabschlittert. Sehr bald schon wußte ich, daß ich es nicht einmal fertigbringen würde, wenn nicht ein Wunder eintrat, mich auf dem damaligen Stand zu halten. Sogar mein Talent war mir eigentlich im Weg, denn einem Mittelmäßigen springt man bei, mich aber mied man. Ich verbreitete Unbehagen. Ich gab Anlaß, daß man sich genierte. Und da ich verzweifelt Geld brauchte, nahm ich unbesehen jedes Angebot an. Doch da ich das Recht verscherzt hatte, anspruchsvoll zu sein, beutete man mich aus; es war ein Teufelskreis, aus dem ich nicht herauskam. Und je tiefer ich mich verstrickte, desto einsamer war ich. Natürlich begann ich zu trinken. Aber wenn der Alkohol meinen Charakter schließlich völlig zerstörte, ließ er mein Gedächtnis und meine Hand doch gänzlich intakt. Der Virtuose in mir lebte behaglich weiter, und so manchesmal wunderte ich mich selbst darüber. Ich hatte eine elegante Manier erfunden, rasch über schwierige Stellen hinwegzugleiten, ihren pedantischen oder zu mechanischen Aspekt zu vertuschen. Ich bewahrte ein weiches Vibrato, eine königliche Klangfülle, die, selbst wenn ich den Kopf verlor, ohne eine Spur von Leichtfertigkeit die geheimnisvolle Gefühlstiefe ausdrückte. In meinem tiefsten Innern gab es etwas wie eine sehr reine Quelle, die durch nichts getrübt werden konnte. Zuweilen nahm mich der Geschäftsführer in einem Nachtlokal, wo ich spielte, am Ende der Woche beiseite und sagte mir: «Sie spielen gewiß gut, Sie sind ganz ohne Zweifel ein großartiger Geiger, aber … Verstehen Sie, es ist nicht das, was wir hier brauchen!» Ich trollte mich also. Ich wohnte in immer finstereren Zimmern. Ich trug immer schäbigere Anzüge. Ich hatte Geliebte für einen Abend, die mich anhörten und dann maulten: «Na, weißt du, ein Bruder Lustig bist du gerade nicht!» Denn ich sah schon, was mich erwartete. Das Geigenspiel aufgeben? Ich hatte es versucht. Aber nach kürzester Zeit griff ich wieder zum Fiedelbogen. Unterricht geben, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen? Mir geht jede pädagogische Begabung ab. Man kann auch nicht lehren, was aus dem Instinkt kommt. Vielleicht hätte ich in einem Orchester spielen können. Dazu hätte ich aber an Proben teilnehmen und einen Dirigenten ertragen müssen. Nein. Ich hatte mich schon so sehr ans Bummeln gewöhnt, daß ich mir bei einer wohlgeregelten Existenz wie im Gefängnis vorgekommen wäre. Auch ans Komponieren hatte ich gedacht, aber ich hatte nicht genug Talent, um ein Werk durchzukonstruieren, und die kommerzielle Musik widerte mich an. Wozu Auswege suchen? Ich ließ mich treiben. Ich steuerte mein Leben nicht mehr und hatte nicht einmal mehr den Wunsch, es zu steuern. Es ist gar nicht unbedingt unangenehm, Treibgut zu sein.
Damals trat der Mann zum erstenmal in Erscheinung. Sosehr ich mir auch Mühe gebe, es gelingt mir nicht, mich daran zu erinnern, was meine Aufmerksamkeit geweckt hat. Vielleicht spionierte er schon mehrere Tage hinter mir her? Vielleicht hatte er mich im Jumbo bemerkt, wo ich zur Apéritif-Stunde und abends mit einem erbärmlichen Pianisten zusammen spielte? Da ich damals sehr wenig aß, und zwar aus gutem Grund, versetzte mich die geringste Menge Alkohol in eine Art Dämmerzustand. Ich war wie ein Fisch, der jenseits der Wände seines Aquariums höchstens ungewisse Formen und Bewegungen wahrnimmt. Mich betrafen sie nicht. Es war jene Welt, in die ich doch nie wieder zurückkehren würde. Ich spielte und wartete nur darauf, Feierabend machen zu dürfen. Dann ging ich, den Geigenkasten unterm Arm, zu meinem Hotel in der Rue des Abbesses oder auch zur hellerleuchteten Place Clichy hinunter, um in einer Snack-Bar ein Sandwich zu knabbern.
Er saß zwei Tische weit von mir entfernt, als ich gewahr wurde, daß ich ihn kannte. Ich hatte ihn vermutlich unbewußt in der Menge bemerkt, und nun auf einmal sagte mir sein Gesicht etwas. Ich sah ihn mir aufmerksamer an. Ich war sicher, ihn bereits gesehen zu haben. Es war ein Mann von etwa fünfzig Jahren, unauffällig gekleidet, robust, ja sogar massig. Sein Gesicht war plump, bäuerisch, aber mit großen Tränensäcken unter den Augen, die ihm ein Aussehen gaben, als habe er viel erlebt, viel nachgedacht. Er trug eine Bürstenfrisur. Er rauchte eine lange, sehr dünne Zigarette, deren Asche von Zeit zu Zeit auf seine Krawatte herabfiel, ohne daß er darauf achtete. Zweifellos ein Ausländer. Seit Anfang Juli wimmelte Montmartre von Touristen, auf die längs des Boulevards riesige, funkelnde Autobusse warteten. Ich vergaß den Mann wieder. Tags darauf entdeckte ich ihn im Jumbo. Er trank Bier und las eine Zeitung. Nie sah er zu mir herüber. Die Musik interessierte ihn nicht. In der Pause goß ich einen Scotch hinunter, und dann kümmerte ich mich nicht mehr um den Mann. Ich spielte wie ein Roboter, ohne an irgend etwas zu denken. Es war mir sehr heiß. Ich war übermüdet. Um Mitternacht packte ich ein. Er ging im selben Augenblick hinaus wie ich. Zufall? Ich bemerkte, daß er groß und ein wenig gebeugt war. Er trug einen Fotoapparat am Schulterriemen. Vielleicht ein Holländer? Ich ging ein paar Schritte über den Boulevard. Er überquerte die Fahrbahn und war dann verschwunden. Wo war ich ihm schon einmal begegnet? Meine Gewißheit wuchs, daß dieses Gesicht mir vertraut war. Doch woher? Diese Säcke unter den Augen …
Ich ging zu Bett. Meine üblichen Sorgen hielten mich lange Zeit wach. Ich hatte im ganzen Viertel Schulden. In vierzehn Tagen ging mein Engagement zu Ende. Ich würde das Hotel und die Wäscherei bezahlen können. Aber die anderen? Ich hörte, wie meine Nachbarin nach Hause kam. Auch ihr schuldete ich eine größere Summe. Sie war Garderobenfrau in einem Nachtlokal und verdiente ganz anständig. In ihrer Jugend war sie Tänzerin gewesen, und obwohl sie über vierzig war, sah sie noch sehr gut aus. Jedermann nannte sie Lili. Nur ich nicht. Ich habe es nie verstanden, mit Frauen einen kameradschaftlichen Ton zu finden. Sie dagegen – es klingt fast lächerlich –, sie hatte vor mir eine Art Respekt. Ein Wink von mir hätte genügt … Ich zog es jedoch vor, ihr Geld zu schulden. Erst bei Morgengrauen schlief ich ein.
Um ein Uhr sah ich ihn in der Snack-Bar, in seine Zeitung vertieft. Er konnte nicht gewußt haben, daß ich kommen würde. Er war also nicht meinetwegen dort. Ich bestellte zwei Sandwiches. Der Mann las den Börsenbericht. Er hatte einen anderen Anzug an, einen grünlichen, ausgebeulten, aber gut geschnittenen Tweed-Anzug. Ich trödelte. Es waren nicht viele Gäste da, und es eilte mir nicht. Wenn der Mann mit jemand verabredet war, wollte ich sehen, mit wem. Etwas vor zwei Uhr faltete er seine Zeitung sorgfältig zusammen, zählte das Kleingeld, das er auf das Tischchen legte, und stand auf. Ich beugte mich zum Kellner.
«Kennen Sie den Herrn, der gerade hinausgeht? Kommt er oft hierher?»
«Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?»
«Ob ich … Nein. Wieso?»
«Hat er denn niemals mit Ihnen gesprochen?»
«Nein, nie.»
«Das ist aber merkwürdig.» Er sah dem Mann nach, der bei grünem Licht über den Fahrdamm ging. «Es sind noch keine vier Wochen her, da hat er mich gefragt, ob ich Sie kenne. Na, ich hab ihm gesagt, daß Sie im Jumbo spielen; ich denke, da ist nichts dabei. Und sonst …»
«Was sonst?»
«Tja, er hat mir noch andere Fragen gestellt: ob Sie Freunde hätten, ob Sie sich mit Weibern träfen … Im ersten Augenblick hab ich sogar geglaubt, er ist von der Polente, aber er hat mir fünfhundert Francs[*] gegeben.»
«Haben Sie ihn dann öfter gesehen?»
«Nein. Ich hatte ihn ganz vergessen. Erst vorgestern ist er dann wieder hergekommen. Wahrscheinlich will er irgendwas von Ihnen – was Geschäftliches oder so.»
«Etwas Geschäftliches?» Ausgerechnet von mir! … Die Sache beschäftigte mich mehr und mehr. Als ich in meinem Gedächtnis kramte, war mir so, als hätte ich ihn im Belzebub gesehen, einem Nachtlokal, wo ich ein paar Tage lang gearbeitet hatte, und das war tatsächlich fünf Wochen her. Wenn der Mann aber über mich Einkünfte einholen wollte, so mußte er mir gefolgt sein, mußte rechts und links die Leute ausgefragt haben. Ich mußte mir darüber Gewißheit verschaffen. Ich begann mit meinem Hotel. Nein, niemand hatte sich nach mir erkundigt. Dieselbe Antwort beim Zigarrenhändler. Dieselbe Antwort beim Bäcker. Reihum suchte ich die Geschäfte in der Nähe auf. Nicht die geringste Spur von dem Mann. Ich fragte im Belzebub. Nichts. Ganz grundlos fühlte ich mich deprimiert. Es ist merkwürdig: ich bin sehr sorglos, und doch messe ich winzigen Kleinigkeiten einen Wert bei, der bis zur Besessenheit gehen kann. Jemand interessierte sich für mich? Gut. Ich brauchte ja doch nur abzuwarten, bis er mich ansprach. Aber ich hörte nicht auf, die abenteuerlichsten Hypothesen aufzustellen. Sie folgten einander wie die Bilder in einem Traum; ich hatte nicht die Macht, ihnen Einhalt zu gebieten. Ich machte mich daran, mich zu betrinken. Schlag zwei Uhr landete ich an der Place Pigalle. Ich war betrunken; das heißt bei mir, ich fühlte mich schwerfällig und flau, aber im Innern von wunderbarer Klarsicht erfüllt … Nun, keine wirkliche Klarsicht – eher eine Fähigkeit, zwischen absurden Gedanken plausible Bezüge herzustellen. Aber aus dieser merkwürdigen Gabe habe ich bittere Freuden geschöpft. Ich war also sicher, die Wahrheit entdeckt zu haben: der Mann war ein eifersüchtiger Liebhaber. Er war ganz offensichtlich der Freund von Berthe, ein Geschäftsmann, der alle vierzehn Tage nach Paris kam. Berthe war vor ein paar Monaten meine Geliebte gewesen. Sie hatte mich sehr bald schon verlassen, weil – wie sie sagte – ihr Freund sehr eifersüchtig war. Sie hatte Angst vor ihm. Und jetzt wollte der Mann mich aufspüren. Damit war alles klar … oder nein. Er hatte mich doch aufgespürt. Worauf wartete er, um mich zur Rede zu stellen? Ich begann, sein Manöver zu durchschauen. Er wollte mir Angst einjagen, indem er um mich herumschlich.
Sehr erregt über meine Entdeckung verließ ich die Bar, wo ich einen Cognac mit Soda getrunken hatte, und wollte den Platz überqueren, um ein Päckchen Gauloises zu kaufen.
Da legte sich eine Hand auf meinen Arm. «Jacques Christen?»
Er war es.
Er war einen Kopf größer als ich, und seine Schultern überragten mich. Er hatte graue Augen, die Augen eines Pokerspielers; er musterte mich mit dem Blick, mit dem man einen käuflichen Gegenstand prüft. «Sie haben ja schon wieder getrunken», stellte er fest.
«Na, erlauben Sie mal!»
«Kommen Sie!»
Er zog mich zu einer schwarzen Limousine, öffnete den hinteren Wagenschlag, drängte mich hinein und setzte sich neben mich.
«Ich habe nicht die Absicht, Sie zu entführen», nahm er das Gespräch wieder auf. «Wir wollen uns nur ein bißchen unterhalten. Fünf Minuten haben Sie doch wohl Zeit? Dann fahren wir nach der Rue des Abbesses, Sie holen Ihre Geige, und ich bringe Sie ins Jumbo.»
Er sprach langsam, mit einem starken Akzent; vermutlich war er deutscher Herkunft. Auf jeden Fall war er nicht der eifersüchtige Liebhaber, wie ich angenommen hatte.
«Schauen Sie sich das an …» Er hielt mir ein Foto hin.
Ich begriff immer weniger. «Das bin ich!» sagte ich.
«Schauen Sie genauer hin.»
Das Foto war nicht sehr gut. Es schien von einem Paß abgelöst worden zu sein und ließ an einer Ecke einen Teil eines runden Stempels erkennen.
«Doch, das bin ich.»
«Tut mir leid», sagte der Mann. «Sie sind doch Jacques Christen, geboren zu Straßburg am 22. Januar 1920. Erster Preis am Konservatorium im Jahre 1938 und jetzt arbeitslos oder doch so gut wie arbeitslos … Das Foto hingegen stellt einen gewissen Paul de Baer dar, geboren in Zabern am 13. März 1918. Vergleichen Sie!»
Er nahm aus seiner Brieftasche zwei Fotos, auf denen ich mich sofort erkannte.
«Ich hab Sie auf der Straße aufgenommen», sagte er. «Sie werden verzeihen, aber Ihre Ähnlichkeit mit de Baer ist so groß, daß man schon ganz genau hinsehen muß, um den Unterschied zu bemerken. Schauen Sie, das Ohrläppchen und dann die Falte da am linken Mundwinkel.»
Vielleicht hatte er recht; ich war jedoch von dem Foto Paul de Baers fasziniert. Das Bild war ein bißchen flau, aber man hätte schwören können, daß de Baer ein Zwilling von mir sei.
«Unglaublich!» murmelte ich.
Er nickte. «Es scheint allerdings unglaublich, aber solche Ähnlichkeiten kommen viel häufiger vor, als man denkt.» Er lehnte sich zurück, um besser zu beobachten. «De Baer war nicht ganz so mager», fuhr er fort. «Und außerdem – verzeihen Sie – war er sehr reich, und Reichtum stempelt einen Menschen genauso ab wie die Armut. So wie Sie heute aussehen, sehen Sie ihm gar nicht mehr so sehr ähnlich. Aber das steht auf einem anderen Blatt.»
«Wenn ich recht verstanden habe, ist er tot?»
«Ja. Deswegen brauche ich Sie.»
Ich sah ihn verblüfft an.
Er streckte hinter meinen Schultern den Arm auf der Rückenlehne aus. «Reden wir ernsthaft miteinander, Christen», sagte er in verändertem Ton. «Sie sind fix und fertig; das wissen Sie selbst. Nirgends mehr was zu pumpen. Keinen Job mehr in Aussicht. Mit dem Anzug, den Sie da anhaben, können Sie mit keinem Engagement mehr rechnen. Oder bilden Sie sich das ein? Und überhaupt, Geige … Ja, wenn Sie Saxophon oder Trompete spielten, dann wollte ich nichts sagen, dann hätten Sie vielleicht noch eine kleine Chance.»
Ich wollte widersprechen, aber er winkte ab.
«Ich bin im Bilde. Sie sind am Ende der Rutschbahn. Aber ich kann Sie aus dem Schlamassel ziehen. Passen Sie mal auf … wenn ich Ihnen eine Million Francs gäbe – für’s erste, versteht sich –, würden Sie dann für mich arbeiten?» Und um mir zu zeigen, daß sein Angebot ernst gemeint war, zog er ein Scheckbuch heraus.
Eine Million! Ich gestehe, daß mir die Zahl im ersten Augenblick geradezu physisch wehtat. Ich legte die Hand über die Augen. So gern wäre ich erwacht, so gern hätte ich begriffen.
«Ich sagte ‹arbeiten›, das ist nicht ganz exakt», berichtigte er sich. «Denn eigentlich möchte ich Sie mieten; Sie, Ihr Gesicht, Ihre Gestalt; ich miete Ihre Ähnlichkeit, wenn Sie so wollen. Und mir liegt daran, Sie auch gleich zu beruhigen; es handelt sich nicht um irgendwelche dunklen Geschäfte, mit denen Sie sich kompromittieren könnten … Im Grunde ist alles sehr einfach. Paul de Baer war, wie gesagt, ein reicher Mann, das typische Familiensöhnchen, das sich mit allem abgibt, sich für nichts interessiert und sich in zehn Jahren ruiniert. Er war verheiratet – ist es noch – mit einer charmanten Frau, die ihn sehr geliebt hat. Das hinderte de Baer nicht daran, sie zu hintergehen und ihr Vermögen zu vergeuden. Kurzum, eines schönen Tags hat de Baer sich zusammen mit seiner neuesten Eroberung, einer Amerikanerin mit einem sehr großen Bankkonto, nach New York eingeschifft. Er reiste unter falschem Namen – sei es, daß er doch noch gewisse Skrupel hatte, sei es, daß er seine Spur verwischen wollte. Das Schiff war die Stella Maris – vielleicht erinnern Sie sich, daß sie untergegangen ist. Es war auf dieser Reise. De Baer und seine Geliebte werden vermißt. Ich weiß, daß er tot ist, denn ich war über alle seine Geheimnisse auf dem laufenden; sonst aber weiß es niemand, nicht einmal seine Frau. Sie glaubt, daß sein Seitensprung sich diesmal in die Länge zieht. Seit einem Jahr wartet sie auf seine Rückkehr.»
Ich begriff noch nicht ganz, worauf er eigentlich hinauswollte, aber ich empfand Enttäuschung. Meine Ähnlichkeit mieten! Was für ein Unsinn …
Er riß mich aus meinen Gedanken. «Ich komme jetzt zu dem delikaten Punkt. De Baer hatte einen Onkel, einen Bruder seines Vaters. Dieser Onkel Henri lebt noch. Er lebt zurückgezogen in Colmar, und da er krebskrank ist, sind seine Tage gezählt. Aber auch er ist sehr reich … Ich übergehe Einzelheiten, darauf können wir später noch zurückkommen. Er ist sehr reich, und Paul de Baer soll ihn beerben. Sie sehen, wie die Dinge liegen. Einerseits Gilberte, Pauls Frau, die er hintergangen und ausgepowert hat; auf der anderen Seite die Erbschaft Onkel Henris, die blödsinnigerweise verlorengeht, wenn de Baer nicht im richtigen Augenblick auftaucht, denn ein anderer Erbe ist nicht da.»
«Ist die Erbschaft bedeutend?»
«Beträchtlich. Über den Daumen gepeilt, so etwa hundert Millionen. Der Onkel war im Kaffee-Großhandel. Er hatte Plantagen in Brasilien und ein ganzes Verteilernetz im Elsaß und im Rheinland.»
«Und was machen Sie bei der Sache?»
«Ich habe schon bei den Eltern Paul de Baers in Diensten gestanden und dann bei ihm. Ich heiße Frank Mayer. Nein, ich will bei der ganzen Geschichte gar keinen Vorteil haben, ich denke dabei nur an Gilberte de Baer. Darum habe ich, als ich Sie sah und erfuhr, daß Sie Geige spielen, sofort begriffen, daß es vielleicht ein Mittel gibt, die Erbschaft doch noch zu retten … Passen Sie auf: Wenn der Onkel gestorben ist, was nicht mehr lange auf sich warten lassen wird, bestellt der Notar Paul de Baer zu sich. Seit vielen Jahren hat er ihn nicht mehr gesehen, denn de Baer lebte in Cap Martin auf einem großen Grundstück, das seiner Frau gehört. Aber der Notar kennt de Baer sehr gut; er ist ein alter Freund der Familie, und früher hat er sogar mit Paul und Gilberte musiziert … Ach so, ich vergaß, Ihnen zu sagen, daß de Baer ein recht guter Geiger war. Man wird also den Notar hinters Licht führen müssen; man muß ihm eine Stunde lang vorspiegeln, Sie seien de Baer. Das ist leicht, vorausgesetzt, daß Sie in die Haut des Verschwundenen schlüpfen. Die Ähnlichkeit allein tut es nicht. Worauf es ankommt, sind bestimmte Bewegungen, die Sprechweise – die ganze Art, wie Paul de Baer sich gegeben hat. Das ist es, was Sie lernen und sich aneignen müssen.»
«Und seine Frau?»
«Ich habe Ihnen bereits gesagt, daß Gilberte auf ihren Mann wartet.»
«Aber … Sie wird also nicht ins Bild gesetzt?»
«Auf keinen Fall. Ich kenne sie recht gut. Niemals würde sie sich auf so etwas einlassen. Es geht darum, ihre Interessen gegen ihren eigenen Willen wahrzunehmen.»
Ich mußte lachen, obgleich mir gar nicht zum Scherzen zumute war. «Sie halten mich für einen Esel», sagte ich. «Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe Ihnen höflich zugehört. Ihre Geschichte ist amüsant, aber unglaubwürdig. Nicht mit mir, verehrter Herr Mayer, oder wie Sie heißen mögen. Ich habe immerhin ein bißchen Grips.»
Während ich sprach, hatte er rasch den Scheck ausgefüllt; er unterzeichnete ihn.
«Ich weiß», sagte er. «Glauben Sie mir, ich habe alle Aspekte des Problems geprüft. Aber es gibt natürlich eine Menge Details, von denen Sie noch nichts wissen und die Ihre Beurteilung beeinflussen werden. Ich muß Ihnen Paul de Baer ein wenig erklären. Glücklich war der Junge nie. Schon sehr früh hat er seinen Vater verloren. Die Mutter ließ ihm jede Laune durchgehen. Paul hatte kein Lebensziel. Eine Zeitlang hat er sich für seine Geige begeistert. Später war es dann Zeichnen und Architektur. Aber bei nichts hielt er aus. Kurz nach seiner Heirat fing es damit an, daß er ausrückte – vielleicht, weil er sich seiner Freiheit beraubt fühlte. Tagelang verschwand er und kam ohne einen Sou zurück; er sprach dann mit niemand und schloß sich in seinem Zimmer ein. Wenn er dann wieder ausrückte, waren wir fast erleichtert … Rundheraus gesagt, er war keine sehr ausgewogene Persönlichkeit … Das ist noch milde ausgedrückt. Darum gebe ich Ihnen mein Wort darauf, daß Gilberte nicht den geringsten Verdacht schöpfen wird, wenn ich sie anrufe und ihr erkläre, daß ich Sie wiedergefunden hätte und daß Sie an Gedächtnisschwund litten.»
Ich öffnete die Wagentür und stieg aus. Ich war zwar geduldig, aber ich hatte wahrhaftig genug von diesem dummen Zeug. Ein Doppelgänger, der überdies noch an Gedächtnisschwund leidet! Das war nun wirklich ein bißchen zuviel. Ich ging wütend davon, ohne mich umzublicken. Nur der Gedanke an den Scheck wurmte mich. Eine Million! Damit ließ sich ganz von vorn anfangen. Was war dieser Frank eigentlich? Ein Schwindler? Ein Gauner? Ein Irrer? Ich bog in die Rue Houdon ein. Ein diskretes Hupen ließ mich zusammenfahren. Die Limousine folgte mir in langsamer Fahrt. Frank grinste, er wies mir den Scheck. Ich versuchte, rascher zu gehen, obwohl es sehr heiß war. Das Surren des Motors begleitete mich. Bruchstückhaft ging mir die unglaubhafte Geschichte noch einmal durch den Kopf: Der Notar … Gilberte … Wenn diese Frau nicht wäre, der Rest konnte allenfalls hingehen. Aber die Rückkehr des Gatten, der sein Gedächtnis verloren hat! Entweder es stimmte alles und man hatte mir eine üble Rolle zugedacht, oder alles war Schwindel – und dann war diese Gilberte ein Luder … In diesem Augenblick hatte ich mein Hotel erreicht. Ich stürzte ins Vestibül – hinter mir hupte es noch einmal kurz – und rannte die Treppen hinauf.
Meine Zimmernachbarin kam mir entgegen. «Ist Ihnen schlecht?» rief sie.
«Nein, nichts. Die Hitze …»
«Aber haben Sie wenigstens etwas gegessen?»
«Natürlich.»