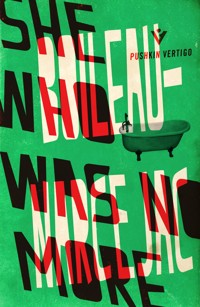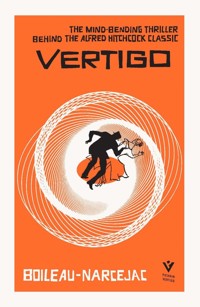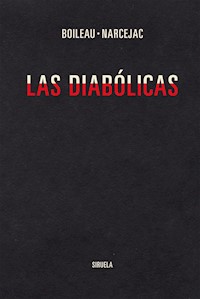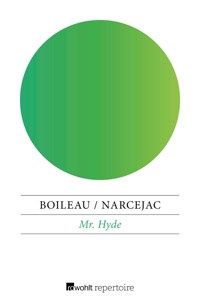
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
René Jeantôme, Autor eines einzigen Buches, leidet immer stärker darunter, daß die Quelle schöpferischer Intuition seit einiger Zeit versiegt zu sein scheint. Die Lektüre anderer Autoren quält ihn, die unermüdliche Schreiblust seiner Frau, einer berühmten Erfolgsautorin, ekelt ihn an, und der Gedanke an ein neues Werk, den großen Durchbruch, lähmt ihn vollends. Sein Arzt, der Neurologe Dr. Brillouin, rät ihm, ein Tagebuch zu führen, um die Worte wieder fließen zu lassen. Als Jeantôme von dem Mord an der alten Dame erfährt, interessiert er sich für die näheren Umstände und ist schockiert: Der Mörder hat die Tat genau vorbereitet, alles nach seinem Willen arrangiert und zum Schluß noch selbst den Rettungswagen angerufen, damit die ‹Männer in Weiß›, wie Jeantôme sie nennt, sie vor der Polizei finden konnten. Die ‹Männer in Weiß› haben in seiner Kindheit eine Rolle gespielt. Denn sie waren gekommen, als die Mühle brannte. Jemand hatte auf der Bahre gelegen. Aber er hatte nicht das Gesicht erkennen können. Und jetzt kamen die alten Erinnerungen wieder hoch, stiegen bekannte Bilder in ihm auf. Innerhalb von vierzehn Tagen sterben drei sehr alte Damen und ein alter (angeblicher) Offizier. Alle sind reich bis wohlhabend und alleinstehend. Dennoch scheidet für die Polizei ein schlichter Raubmord aus. Zu bizarr sind die Begleitumstände. René Jeantôme fühlt sich verfolgt – von einem Täter, der seine Gedanken lesen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Pierre Boileau • Thomas Narcejac
Mr. Hyde
Aus dem Französischen von Stefanie Weiss
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
René Jeantôme, Autor eines einzigen Buches, leidet immer stärker darunter, daß die Quelle schöpferischer Intuition seit einiger Zeit versiegt zu sein scheint. Die Lektüre anderer Autoren quält ihn, die unermüdliche Schreiblust seiner Frau, einer berühmten Erfolgsautorin, ekelt ihn an, und der Gedanke an ein neues Werk, den großen Durchbruch, lähmt ihn vollends. Sein Arzt, der Neurologe Dr. Brillouin, rät ihm, ein Tagebuch zu führen, um die Worte wieder fließen zu lassen.
Als Jeantôme von dem Mord an der alten Dame erfährt, interessiert er sich für die näheren Umstände und ist schockiert: Der Mörder hat die Tat genau vorbereitet, alles nach seinem Willen arrangiert und zum Schluß noch selbst den Rettungswagen angerufen, damit die ‹Männer in Weiß›, wie Jeantôme sie nennt, sie vor der Polizei finden konnten.
Die ‹Männer in Weiß› haben in seiner Kindheit eine Rolle gespielt. Denn sie waren gekommen, als die Mühle brannte. Jemand hatte auf der Bahre gelegen. Aber er hatte nicht das Gesicht erkennen können. Und jetzt kamen die alten Erinnerungen wieder hoch, stiegen bekannte Bilder in ihm auf.
Innerhalb von vierzehn Tagen sterben drei sehr alte Damen und ein alter (angeblicher) Offizier. Alle sind reich bis wohlhabend und alleinstehend. Dennoch scheidet für die Polizei ein schlichter Raubmord aus. Zu bizarr sind die Begleitumstände. René Jeantôme fühlt sich verfolgt – von einem Täter, der seine Gedanken lesen kann.
Über Pierre Boileau • Thomas Narcejac
Die beiden französischen Autoren Pierre Boileau (1906–1989) und Thomas Narcejac (1908–1998) haben zusammen zahlreiche Kriminalromane verfasst. Ihre nervenzerreißenden Psychothriller haben viele Regisseure zu spannenden Filmen inspiriert, am bekanntesten sind wohl «Die Teuflischen» und sein amerikanisches Remake «Diabolisch» und «Vertigo – Aus dem Reich der Toten», sicher einer der besten Filme von Alfred Hitchcock.
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
René Jeantôme
ein Literat, ein Phantast, ein Phantom?
Myriam alias Valérie La Salle
eine Erfolgsautorin, ein Phänomen, eine Voodoo-Frau?
Dr. Brillouin
ein Neurologe. Nur ein Nervenarzt?
M. Lhomond
ein Buchhändler, ein Antiquitätenhändler, ein Informationshändler?
Claire
eine Sekretärin, eine Vertraute, eine Freundin?
leben und sterben zwischen alten Möbeln und alten Erinnerungen. Ein Zufall?
Divisionnaire Marchetti
hält den Mörder für einen Irren. Entlassen, entflohen, oder bisher unerkannt?
ES IST VIELLEICHT NUR EINE MOMENTANE SPERRE … Eine hormonale Störung, Vitaminmangel, Unterversorgung mit irgendeinem Spurenelement … So was kann ausreichen, um aus dem Gehirn eine ausgedörrte Sahelzone zu machen, einen trostlosen Klumpen, ein Beinhaus versteinerter Worte, aus dem nie mehr ein Bild, die kleine blaue Blume eines hübschen Satzes kommen wird …
Doktor, ich bin leer, ausgehöhlt, steril.
Aber, ich bitte Sie! Und Ihre Rezensionen? Sind die etwa nicht von Ihnen? Na also!
Sie sind von mir, wenn Sie so wollen. Aber erstens mal brauche ich immer länger dazu. Und dann – den Inhalt eines Buches zusammenfassen, das kann doch jeder. Etwas gesunden Menschenverstand und Routine, mehr braucht man nicht dazu. Sie picken sich nach Lust und Laune hier und da ein Zitat heraus, Sie garnieren das mit ein paar wohlwollenden Bemerkungen. Auf die Dauer kommt da eine Sammlung von Klischees zusammen, die man …
Mein lieber Jeantôme, Sie übertreiben!
Ach, wirklich? Dann sagen Sie mir doch, was ich seit meinem Prix des Quatre Jurys geschrieben habe – zeigen Sie mir einen ernst zu nehmenden Prosatext! Vielleicht mal eine Reportage, einen Tatsachenbericht, ja – Dutzendware. Sachen, bei denen es auf Gedächtnis und Schreibfertigkeit ankommt … Aber ich erfinde nicht mehr, bin nicht mehr schöpferisch, mir fällt nichts mehr ein, ich bin ausgeschrieben … Und das schon seit Jahren. Es kommt wieder, hab ich geglaubt; ich brauch mich nur ernsthaft an die Arbeit zu machen, irgendwo weit weg von Paris, vom Telefon … Aber nein. Im tiefsten Inneren habe ich den Fehlschlag schon vorausgeahnt. Und das Schlimmste, sehen Sie – das Schlimmste ist, daß die anderen mich immer noch für einen begabten Burschen halten. ‹Läuft es? – Neue Projekte? – Sie sitzen doch sicher über einer Arbeit, ja?› Das sind so die wohlgemeinten Fragen – in der Redaktion, im Verlag, auf Cocktailparties … Was soll ich den Leuten sagen? Ich zwinkere vielsagend: ‹Warten Sie’s ab!› Und zu Hause könnte ich nur selber eine reinhauen. Sagen Sie mir nicht, ich leide an der Menopause des Schriftstellers! Ich bin erst fünfundvierzig, in dem Alter, in dem ein wirklich begabter Autor vor Ideen sprüht … Und? Was ist mit mir? Sprühe ich vielleicht?
Jeantôme denkt nach. Oder noch nicht einmal das. Er käut wieder. Er nagt und nagt am gleichen Knochen. Er schaut auf die Seine, die Wellen, die Lichtreflexe auf dem Wasser. Tja, ein Monet, denkt er träge, oder ein Renoir … Die haben sich nicht den Kopf zerbrochen. Die Sujets sind zu ihnen gekommen. Die haben sich immer an den gedeckten Tisch gesetzt. Ich dagegen … Das Sujet ist es ja gerade, was sich mir entzieht, das Thema, das Plot, der rote Faden. Was fehlt, ist der kleine Impuls, der die Explosion auslöst, ähnlich einem winzigen Stromstoß, der dann doch ein Riesenfeuer bewirkt. Aber wie soll man das einem Arzt erklären? – Stärkungsmittel? Ich pfeif drauf. Und auch auf ‹Verdrängungen› und die anderen dummen Psychiatersprüche. Ich sehe mich selbst ganz klar; das ist wie der Blick auf den Grund eines tiefen und durchscheinenden Wassers, das sehr kalt, bewegungslos und ohne jedes Geheimnis ist.
Natürlich, so was kapieren die Ärzte nicht; Professor Balavoine ebensowenig wie die anderen. Und das, obwohl er selber Bücher geschrieben hat. Bücher, ja. Aber keine Romane. All diese Leute mit ihren Erzählungen über Reiseerlebnisse, über Jugenderinnerungen, über bestimmte Lebensabschnitte – die meinen, sie würden schreiben. Die denken, es sei Literatur, wenn sie Hinz und Kunz Einblick in ihr Inneres geben, ihr Herz öffnen, während in Wirklichkeit …
Jeantôme betritt ein Café, nimmt inmitten von Touristen Platz und versucht, in dem Hin und Her der place Saint-Michel draußen aufzugehen, sich im Lärm ringsumher aufzulösen. Aber der soeben angerissene Satz vollendet sich in seinem Kopf: … während in Wirklichkeit Literatur ein Orgasmus ohne Partner ist.
Er fährt zusammen. Nicht schlecht, sagt er sich. Das sollte man festhalten … Er zückt ein schmales, in Leder gebundenes Notizbuch, zieht den dünnen Bleistift aus der Innentasche und notiert: Orgasmus ohne Partner. Er überfliegt dann ein paar Formulierungen, die er in den letzten Tagen zusammengetragen hat. Er ist nicht unzufrieden. Ein paar kommen auf Jules Renard hinaus. Die besten fallen ihm ein, während er in der Stadt umherirrt, um die Ile de la Cité herum oder sogar im Inneren von Notre-Dame, eventuell auch auf dem pont Mirabeau. Überall dort, wo noch Reste von Poesie in der Luft liegen, sie durchziehen wie Staubteilchen einen Sonnenstrahl. Aber das ist es ja eben – das sind alles Bruchstücke, Krümel. Nicht verwendbar. Das ist wie eine hauchdünne Schicht emotionaler Urmaterie, die aber mit Hilfe eines kleinen Alchimistenfeuers vielleicht schon bald in feine und erlesene Prosa umgewandelt werden könnte.
Jeantôme leert die Tasse. Er hat in Wirklichkeit überhaupt keine Lust auf Kaffee. Er bestellt ein Bier – als Vorwand, länger sitzen bleiben und seiner Grübelei nachhängen zu können, die ihm sowohl als Ausrede wie als Rechtfertigung dient. Ich bin auf der Suche, kann er sich zureden. Es ist dumm von mir zu denken, daß ich unfähig bin, steril. In Wirklichkeit mache ich eben eine Dürreperiode durch, wie so viele andere Künstler vor mir … Nur, daß diese Dürreperiode zugegebenermaßen jetzt schon anhält seit – seit sechs Jahren, das läßt sich schnell überschlagen. Seit er Myriam geheiratet hat, genauer gesagt. Oh, pardon, doch nicht Myriam – Valérie La Salle. Wo hat sie eigentlich dieses lächerliche Pseudonym aufgefischt?
Jeantôme bestellt ein weiteres Bier. Valérie La Salle. Sofort steigt Groll in ihm hoch, verspürt er ein Stechen in der Brust. Warum hat er sich eigentlich hierher gesetzt, so nahe am Boulevard mit seinen Buchläden? Er braucht nur ein paar Schritte über das Trottoir zu gehen, und schon springt ihm Valéries letzter Buchtitel in die Augen. Seelen in Not … Nach Verwundete Herzen und nach Die Liebe ist tot – das wenigstens nicht ganz ohne Verdienste gewesen war –, also nach diesen ganzen beschämenden Albernheiten jetzt dieses Machwerk, diese Sommerlektüre, die alle Rekorde brechen wird … Jeantôme ist so weit, daß er Selbstgespräche führt wie ein alter Mann. Und dann wird er von einem bösen Lachen geschüttelt. Ha! Was braucht er sich soviel Mühe zu machen – er, der auf der Jagd nach einer Idee hinter jedem Klatsch her ist wie auf der Suche nach dem Stein der Weisen! Wo er doch einen Traum von einem Stoff vor der Nase hat, wo er ihn in der Hand hält! Verkrachter Schriftsteller heiratet Erfolgsautorin … Aber das wirkt andererseits zu schön, um wahr zu sein. Zu gewollt, zu arrangiert. Die schlechte Synopse eines Drehbuchautors unter Zeitdruck. Und doch, ist die Begegnung zweier Autoren in der überhitzten Atmosphäre des Büchergeschäfts und des Show-Business nicht das Normalste von der Welt, direkt folgerichtig? Völlig banal, dieser Hochzeitsflug des Schmetterlingsmännchens hin zu dem Weibchen, um das herum sich die Aura der Berühmtheit verbreitet … Vor allem, da Myriam sehr verführerisch, ja schön gewesen war. Ist sie im übrigen immer noch. Sie ist dicker geworden, weil sie sich nicht genügend Bewegung macht, weil sie an ihren Schreibtisch gekettet ist wie ein Galeerensträfling an die Ruderbank. Ja, ihre fünfzehn Seiten täglich. Gott im Himmel! Wie kann man nur Tag für Tag fünfzehn Seiten ausschwitzen, ohne eine Streichung, ohne einen Zweifel? Und so was will ein Schriftsteller sein! Eher schon eine Seidenraupe. Na eben; gerade wegen dieser Diskrepanz eine großartige Romanfigur … Und ich, ich bin auch eine Romanfigur. Ah! Wenn ich nur wollte!!
Er steht auf, entscheidet sich für das im Schatten liegende Trottoir des boulevard Saint-Germain und geht mit kleinen Schritten auf das carrefour de l’Odéon zu. Er hat Zeit. Er muß nur seinen Bericht vor fünf fertig haben. Ja, seit Monaten trägt er sich mit dem Gedanken, Myriam zur Zentralfigur eines Romans zu machen – eine Frau, die alles andere dem geopfert hat, was sie für ihren Beruf hält. Man muß es gehört haben, wie sie erklärt: ‹Ich bin eben super, einfach Spitze.› Genauso, wie man etwa von Karajan sagen kann, daß er ‹Spitze› sei, oder von jedem anderen auf ganz hohem Niveau stehenden Profi. Eine Art Superwesen, überlegt Jeantôme, monströs, dem man besser nicht zu nahe kommen sollte … Gibt es nicht auch so einen exotischen Baum, der alles Lebendige lähmt, das sich unter seine Krone wagt?
Und mich hat sie auch gelähmt … Ihre Vitalität laugt mich aus. Und dann, mal gesetzt den Fall … Ich schreibe einen Roman. Mit welcher Auflage? Dreißigtausend? Oder vierzigtausend …? Wäre schon unerwartet. Und sie dagegen … In der gleichen Zeit ist sie auf dreihunderttausend oder vierhunderttausend gekommen. Man wird mich auslachen!
Er betritt La Rhumerie. Er hat wirklich keine Lust, Dutoit und seinem Korallenschmöker – wie war das noch? Ach ja, Barrier-Reef – zwanzig Zeilen zu widmen. Verdammt noch mal! Er braucht jetzt einfach einen süßlichen, eisgekühlten Drink, um den Faden seiner Reflexion wieder aufnehmen zu können. Ich will nicht wieder auf Jouhandeau machen, nimmt er sich vor. Und außerdem, um gerecht zu sein: Myriam ist nicht Elise. Sie ist schlimmer. Weil sie dumm ist … Sie weiß nicht, daß sie ihren Lesern – besser gesagt, ihren Konsumenten – Schnellgerichte vorsetzt, kaufertig, einen unsäglichen Pfusch voller Albernheiten, die niemand anzuprangern wagt … Während ich dagegen, der ich intelligent bin … Also doch, intelligent bin ich immerhin … Während ich also trocken und ausgedörrt bin, weil ich Ehrfurcht vor dem Schreiben habe. Und wenn es stimmt, daß Myriam durch ihren Mangel an kritischem Verstand schon die eigene Romanheldin ist, dann wäre es umgekehrt so, daß ich infolge meiner Urteilsschärfe ein unbedeutendes Würstchen bleibe … Nein, daß wir uns über den Weg laufen, das ist nicht drin.
Er nippt an seinem Drink. Er klebt ihm an den Lippen; er mag das Zeug nicht besonders. Die Zigarette, die er sich ansteckt, mag er eigentlich auch nicht. Aber ihm kommt alles recht, was die Rückkehr nach Hause hinauszögert, und sei es auch nur um ein paar Minuten. Wenn überhaupt von ‹zu Hause› die Rede sein kann: Myriam bewohnt das eine Stockwerk und er das andere. Sie begegnen sich selten. Aber sie haben ‹Geräuschkontakt›. Er ist der vertraute Schritt oben an der Decke. Und sie ist da unter ihm diese Buschmusik, die sie offenbar in der Arbeit beflügelt. Ja, gewiß … Man soll ruhig merken, daß sie auf Martinique geboren ist!
Er hat das bohrende Gefühl einer unglaublichen Ungerechtigkeit. Aber was tun? Arbeiten natürlich … Es versuchen, koste es, was es wolle. Sich vor das weiße Blatt setzen und aufs Geratewohl loslegen. Als ob er es nicht schon zur Genüge in seinem Büro gehört hätte, das Gefasel dieser ach so begnadeten Autoren, die in aller Bescheidenheit erklären:
‹Ich lasse meine Romanfiguren ihren eigenen Weg gehen. Sie sind es, die mich weiterführen.›
‹Aber Sie haben für den Anfang doch wohl eine Idee?›
‹Nicht im geringsten …›
Alles Schwindel! Als ob ein Autor sich nur hinzustellen und wie der Lehrer in der Pause ein wenig aufzupassen brauchte, daß nichts schiefläuft, während in Wirklichkeit … Sollen die sich doch mal bei Myriam erkundigen, was die Vorarbeiten angeht; da haben sie jemand, der sich damit brüstet, die Handlung präzise zu skizzieren …
Jeantôme lacht lautlos vor sich hin. In Wirklichkeit sind das keine Skizzen, sondern Horoskope der handelnden Personen, die nach allerstrengsten Regeln erstellt werden. Er hat Myriam am Werk gesehen. Sie pickt sich ein fiktives Geburtsdatum heraus mit Tag, Ort und Stunde, einfach so. Davon ausgehend leitet sie an Hand komplizierter Tabellen und Berechnungen die stellaren Koordinaten einer ersten Figur ab, dann einer zweiten und so weiter und so fort. Durch ihre jeweiligen Stellungen und die ihnen zugeschriebenen Einflüsse sind die Planeten im weiteren Verlauf bestimmend für Bündnisse und Gegnerschaften – von Myriam ausgetüftelt mit Hilfe von Quadraten, von Drei- und Rechtecken, die dann die Beschlüsse des Schicksals verkörpern. So kommen die Plots zustande, die Myriam gar nicht hätte erfinden können. Und bei alledem hat sie noch die Stirn, zu behaupten: ‹Mein Handlungslauf entwickelt sich folgerichtig und wie von selbst.› Und dann, was sie Balzac vorwirft, von dem sie kaum was gelesen hat: Daß er sich Romanhelden ausgedacht hat, die astrologisch unstimmig sind! Sie ist wirklich zum Abschießen. Zum Umbringen …
Jeantôme läßt seinen Gedanken freien Lauf. Sie umzubringen – nichts leichter als das. Es würde genügen, endlich den Roman zu schreiben, der von ihm erwartet wird. Er weiß ja so gut, was man einander zuraunt: ‹Ein so talentierter Bursche wie Jeantôme … Wie kann er es nur bei dieser Frau aushalten? Sicher, sie verdient viel Geld; möglicherweise liegt ihr der Ärmste sogar auf der Tasche. Aber er hat mit seinem Biribi, wenn Sie sich erinnern, beinahe den Goncourt bekommen, und auch beim Renaudot und Femina haben einige in der Jury für ihn gestimmt, vom Interallié ganz zu schweigen … Ein zweites Buch wie Biribi, und er hat die Gute auf ihren Platz verwiesen. Dann heißt es nicht mehr, er ist der Mann von Valérie La Salle, sondern sie ist die Frau von René Jeantôme …›
Gut, dieses Raunen da hinten im Kopf; beruhigend, diese Gerüchte über ihn … Sicher, das Gerede läßt nach, sein Stern droht langsam zu erlöschen. So geht es vielen hier in Paris. Noch ein Jahr, oder ein paar Monate … Neue Preisträger stoßen die alten vom Thron. Ein sterbendes Buch, das tut mehr weh als eine zu Ende gehende Liebe.
«Gott im Himmel», sagt Jeantôme laut, «aber das hängt doch einzig und allein von mir ab!»
Der Kellner eilt herbei. Er hat gedacht, er sei gerufen worden.
Jeantôme bezahlt. Diesmal muß er ja doch wohl zurück. Was soll er eigentlich über dieses Buch von Dutoit von sich geben? Auch so einer von diesen jungen Leuten, die es auf Abenteuer und auf Publizität abgesehen haben. Im übrigen ein netter Bursche. Schmeißt sich etwas an, wie in seinem Alter üblich … Für René Jeantôme, den unvergeßlichen Autor von Biribi, zum Zeichen meiner ehrfürchtigen Bewunderung … Eine Widmung, die wie eine hingestreckte Bettelschale ist. Und wenn seine Besprechung nicht freundlich genug ausfällt, dann wird Dutoit zu den anderen sagen: ‹Habt ihr die Rezension von Jeantôme gelesen, diesem alten Arschloch? Wird auch Zeit, daß er anderen Platz macht …›
Die rue des Saint-Pères … Der Hof mit den Büros des Verlagshauses Delpozzo am hinteren Ende. Jeantôme liebt dieses alte Gebäude mit den Rissen im Verputz, die wie ehrwürdige Falten aussehen. Wenn man die Eingangshalle passiert hat, ist man in ein Ehedem eingetreten, in dem noch Gänsekiele angespitzt wurden, in dem man noch in Ecus und in Louisdor rechnete, in dem die Autoren weißbehandschuht ihre Werke überreichten. Und trotz der Schreibmaschinen, der Kopiergeräte, der Rechner und Telefone haben die Räumlichkeiten Stil mit ihrer alten Täfelung, der gediegenen, ja strengen Ausstattung. Das Personal ist beflissen, flink und umsichtig. An den Wänden des breiten mittleren Flurs hängen die Fotos der Hausautoren. Jeantôme ist der letzte in der Reihe. Nach rechts geht es in die verschiedenen Abteilungen, und ganz hinten hat er seine ‹Höhle›, wie er zu sagen pflegt. Ein ganz kleiner Raum – Schreibtisch, Telefon, Aktenschrank, sein Sessel und ein einziger Stuhl für einen etwaigen Besucher. Kein Fenster, dafür aber ein Ventilator, der dazu neigt, Papiere durch die Gegend zu wirbeln. Und an den Wänden Plakate, die ein paar Neuerscheinungen anpreisen.
Jeantôme zieht das Jackett aus und hängt es an den Kleiderschrank hinter der Tür. Dann legt er auf der Schreibtischplatte seine Kultgegenstände aus wie auf einem Altar: Die Schreibunterlage in die Mitte, das Buch von Dutoit links, den Füllfederhalter (blaue Tinte) rechts, daneben seinen Briefblock. René Jeantôme, Editions Delpozzo, rue des Saint-Pères, steht da unumstößlich auf dem Briefkopf. Seine Briefe sollen wie Meldereiter sein … Er setzt sich, versucht die ideale Sitzposition zu finden, wird unruhig, steht auf. Er hat seinen Fetisch im Aktenschrank vergessen, seinen Talisman, sein Kind … Er legt es vor das Telefon. Er wird nicht müde, den vielgerühmten Schutzumschlag zu bewundern, auf dem infolge eines jener Glücksfälle, die einen an Wunder glauben lassen, sein Name steht. René Jeantôme. Biribi. 20. Auflage. Und dazu die berühmte Abkürzung: N.R.F. – Nouvelle Revue Française –, wobei das F kühn geschwungen ist wie der Bug eines Wikingerschiffs. Die Phantasie schwingt sich in die Höhe, der Mut kehrt zurück. Die Gründe, an sich zu zweifeln, sind nur noch ein bißchen Gischt im Wind.
Jeantôme greift nach dem Füllfederhalter und schreibt mit entschlossenen Schriftzügen: Barrier-Reef, von Albert Dutoit, Ed. Delpozzo. Er hält inne. Das geht vorbei, dieses Gefühl der Leere, er ist daran gewöhnt. Das ist wie eine leichte Betäubung, die sich klebrig über seinen Willen legt, die seine Konzentration lähmt und ihn plötzlich in die Lage versetzt, die feinsten Geräusche wahrzunehmen – Marie-Paule, die im Nebenzimmer etwas flüstert, und Evelyne, die auf dem Gang jemand fragt: «Möchten Sie einen Kaffee?»
Das Barrier-Reef! Fünfzehn Zeilen würden ausreichen. Was ist das schon, fünfzehn Zeilen. Eine Sache von einer Viertelstunde, noch nicht mal das. Vorausgesetzt, man findet das richtige Wort zum Einstieg. Jeantôme probiert mehrere aus. Bringt alles nichts … Dieses Wort Barrier wird plastisch, bildhaft, errichtet eine Art Hürde. Eine Barriere eben. Er rückt den Sessel zurück, beginnt nervös zu werden. Also … Wenn ich jetzt schon bei einer Buchbesprechung versage, dann kann ich mir gleich einen anderen Beruf suchen … Er lehnt Biribi aufrecht ans Telefon, wie er es mit dem Foto einer geliebten Frau tun würde. Dann nimmt er den Roman zur Hand, schlägt ihn auf und liest wahllos hier und da ein paar Zeilen.
Man braucht sich nur sinken zu lassen wie ein Schwammtaucher. Die Erinnerungen sind da, in Büscheln, in ganzen Kolonien; die einen stachelig-verschlossen wie Seeigel, die anderen voll aufgeblüht wie zarte Blumen … Oder, an anderer Stelle: … alle diese Sterne, schwindelerregend. Und sie sind, wie der alte Dominique gesagt hatte, der millionenfache Blick Gottes …
Ein Text zum Reinbeißen, wo man auch aufschlägt. Der einem wie von selbst über die Lippen kommt … Das und vieles andere habe ich mühelos niedergeschrieben, denkt Jeantôme. Wie war ich damals eigentlich? Auch nicht energischer, kraftvoller als heute. Auch nicht … Doch, wenn ich mir’s überlege. Ich war fröhlich. Ich war ehrgeizig. Und ich konnte aus allem etwas machen – Sätze bilden, ein literarisches Filtrat herausholen, ein Destillat an Worten, die mich schwindlig machten. Da war etwas in mir, das Wirkungen auslöste wie der Katalysator im Reagenzglas. Und jetzt … Auch wenn ich meinen ganzen Groll, meine Gehässigkeit und Verzweiflung zusammenlege, es kommen doch nur Trester heraus, Rückstand. Alles wegen dieser Frau, die mich erstickt, die mir den Atem nimmt, die mich obendrein verrät. Ja doch, ja … Wenn sie wenigstens noch recht hätte; wenn es nicht mehr ankäme auf die Sprache …
Jeantôme stößt den Sessel zurück und beginnt, in dem engen Büro hin- und herzulaufen, vom Besucherstuhl zur Tür und zurück. Worauf es ankommt, denkt er, ist vielleicht das, was den Erfolg der Rockmusik ausmacht – die Ekstase in der Platitüde … Genau das, was Myriam so gut kann.
Er lehnt sich an die Wand, massiert sich mit den Fingerspitzen das Gesicht und denkt angestrengt nach, wie ein in die Enge getriebener Angeklagter. Das ist doch nicht normal, was ihm da widerfährt. Das ist so etwas wie ein Zauber, ein Bann, der sich über ihn legt. Er hat als Kind Rittergeschichten gelesen, in denen ein Hexenmeister bei Turnieren den Ausgang der Kämpfe heimlich steuerte. Er kommt sich vor wie ein ferngesteuerter Ritter; sein Unvermögen, seine geistige Impotenz sind wie angehext. Seine Kraft ist da, er hat zeitweise ein direkt wütendes Bedürfnis, zu schreiben. Er bereitet sich darauf vor, nimmt den Füller zur Hand, und … Und dann die Sperre. Genauso, als ob er von irgendwoher einen Befehl erhielte. Aber von wem?
Er grübelt angestrengt darüber nach und merkt dann, daß er schon wieder auf der Suche nach einer passenden Ausrede ist. Myriam die Schuld zuzuschieben, das wäre so bequem! Tatsächlich hat er sie noch nie nach solchen Dingen ausgefragt. Hat sie als kleines Mädchen vielleicht eine eingeborene Kinderfrau gehabt, die in bestimmte Geheimkulte eingeweiht war? Oder … Kommt der Befehl, der ihn so lähmt, nicht eher von ihm?
Er schlägt sich mit der Faust hart gegen die Stirn. Er wird einen anderen Facharzt konsultieren. Zu Balavoine rennt er nun schon seit ein paar Jahren. Der ist nett, ja. Aber was er braucht, das ist jemand, der ihn nicht mit Samthandschuhen anfaßt und ihm geradeheraus sagt, ob er paranoid ist und was er tun soll … Ja, das ist beschlossene Sache.
Er schließt Biribi wieder in den Aktenschrank ein. Lange Zeit hatte er das Buch immer in einer Aktentasche mit sich herumgetragen, die er überallhin mitgenommen hatte. Was war denn dabei? Wieviel Gläubige haben nicht einen Rosenkranz in der Tasche oder eine Medaille am Hals! Seit einiger Zeit aber hat er diese fromme Praxis abgewandelt. Er zieht es vor, jeweils ein Exemplar des Romans bei sich zu Hause und im Büro zu haben und weitere in bestimmten Buchhandlungen zu deponieren. Er geht dort vorbei und schielt in die betreffende Ecke … Das ist wie eine Zeichensprache unter Verschworenen. Oder vielleicht eher wie unter Verliebten; aber im Grunde kommt es ja aufs gleiche heraus. Manchmal, o ja, manchmal ist das Exemplar verschwunden, ist Biribi weg. Dann tritt er mit aufgesetzt gleichgültiger Miene und klopfendem Herzen in den Laden und spricht den Buchhändler an. Ob er weiß, wer das Buch gekauft hat? War es ein Mann oder eine Frau? Alter …? Ist speziell nach diesem Titel gefragt worden? Nein? Ach so, hat sich zufällig ergeben. Na, schade … Aber, setzt der Buchhändler meist eilends hinzu, wir können bis morgen ein Exemplar bestellen. Der Titel ist bei Gallimard noch lieferbar …
Und Jeantôme verläßt den Laden, innerlich noch aufgewühlt. Vor Freude? Oder ist es die unruhige Erwartung von etwas Unbekanntem? Er weiß es nicht. Aber es gibt da insgeheim einen Freundschaftspakt zwischen ihm und dem restlichen Tag.
Ach, dieses Barrier-Reef … Er schiebt den Roman in seine Aktentasche, zusammen mit einem Block und dem Füllfederhalter (blaue Tinte). Ein anderes Handwerkszeug kommt nicht in Frage. Noch ein letzter Blick ins Büro. Die Schreibunterlage muß ein Stückchen weiter in die Mitte. Er verläßt das Zimmer.
«Gehen Sie schon?» fragt Evelyn.
«Ja, ich muß zum Zahnarzt.»
Er geht rasch hinaus. Dieses Bedürfnis, zu lügen, sich zu verstecken, zu fliehen … Warum? Auch davon muß er Dr. Brillouin berichten. Ja, er hat sich schließlich für diesen Brillouin entschieden, der eine Sachbearbeiterin in der Presseabteilung wieder hingekriegt hat, die kleine Lucette. Sie war in eine Depression reingeschlittert. Hätte sich beinahe vergiftet, weil ihr Freund sie verlassen hatte. Lächerliche Sache, als ob diese dämlichen Liebesgeschichten eine solche Bedeutung hätten … Jeantôme sieht auf die Uhr. Er wird vielleicht bei Myriam vorbeigehen; sie soll nicht das Gefühl haben, daß er sauer ist. Gestern abend sind sie nämlich ernstlich aneinandergeraten. Gott, wenn er nur dran denkt, warum! Allerdings wäre es nicht nötig gewesen, sie dadurch auf die Palme zu bringen, daß er ihr vorhielt, sie benutze im Dialog alle naselang Verben wie ‹plädierte sie›, ‹entrüstete sie sich›, ‹säuselte sie› und ‹schnarrte sie›.
«Würden Sie mir vielleicht mal vormachen, wie das geht, wenn man säuselt? Oder wenn man schnarrt? Ganz zu schweigen von Ihren ‹spie sie ihm entgegen› und ‹bellte sie› …»
Damit hatte er sie an einer empfindlichen Stelle getroffen. Sie bäumte sich auf wie ein geschlagenes Tier.
«Ich belle, wann ich will … Setzen Sie Ihre Lektionen doch selber in die Praxis um, damit man mal sieht, was Sie können!»
«Oh! Was ich schon zu sagen habe, meine liebe Myriam … Pardon, Valérie.»
Das war wirklich mies und hinterließ Wunden. Aber sie brauchen das alle beide, diesen Schlagabtausch, dieses plötzliche Zubeißen. Hinterher, wenn jeder seine Wunden geleckt hat, dann tun sie so, als hätten sie es vergessen, und bereiten sich gleichzeitig auf den nächsten Angriff vor. Zum Beispiel hat Jeantôme noch nie zu Myriam gesagt: ‹Sie haben die Manie, bei anderen Anleihen zu machen› … Er läßt es dabei bewenden, halblaut wie bei einem Selbstgespräch vor sich hin zu murmeln: «Der Schluß der Seelen in Not, der kommt mir irgendwie bekannt vor, der klingt wie ein Satz von der Colette. In so einem Fall setzt man das aber in Anführungszeichen – vorausgesetzt natürlich, man kennt sich in der Interpunktion aus …» Und damit macht er schon die Tür hinter sich zu; er vergeudet keine Zeit damit, die Antwort abzuwarten. – Und sie, sie holt zum Gegenschlag aus. Sie läßt Claire, ihre Sekretärin, die Grabbelkästen vor den Buchhandlungen abklappern, sie streckt ihm dann mit ihrem strahlendsten Lächeln ein praktisch neues Exemplar von Biribi entgegen. ‹Bei Lhomond gibt’s jede Menge davon›, verkündet sie. ‹Das da hat eine Widmung an einen Minister. Soll ich sie Ihnen vorlesen?› – Er reißt ihr den Band aus der Hand; er ist erbittert. Er würgt die Flüche hinunter und möchte am liebsten zuschlagen. Er knallt die Tür zu und geht in sein Appartement im sechsten Stock.
Komisches Abkommen, wenn man sich das mal überlegt. Der fünfte Stock hätte reichlich Platz für sie beide. Er hat es so gewollt, er hat einen Zufluchtsort, ein Lager, eine Höhle im sechsten Stock gewollt, in der er seine kläglichen Schreibversuche verbergen konnte. Ob er nun vor Wut kocht, im Zimmer auf und ab rennt oder sich auf die Couch fallen läßt und konzentriert jener inneren Melodie lauscht, die gerade ein paar Noten, ein paar Worte hervorgebracht hat … Seine einsamen Kapriolen gehen niemand etwas an außer ihm. Er ist derart mißtrauisch, daß er nichts aufbewahrt, nicht das kleinste Stückchen Papier. Ganz zu schweigen von allem, was nur von ferne wie ein Tagebuch aussehen könnte. Meine verbrannte Erde, denkt er, wenn er nach einem Rundumblick, der an einen mißtrauischen Zöllner erinnert, Schlaf- und Wohnzimmer seines Appartements verläßt.
Er kann über eine Innentreppe direkt in ihre Wohnung gelangen, wenn es in ihm kribbelt, wenn es ihn zu jucken beginnt und ein Streit mit Myriam fällig ist. Vor der Treppe unten ist jedoch eine Tür mit zwei Lämpchen, zwei Lichtzeichen: Ein grünes, wenn Myriam geneigt ist, den Eindringling einzulassen, und ein rotes, wenn sie in ungnädiger Stimmung ist.
Es ist beinahe sechs Uhr. Er betritt den im Treppenhaus eingebauten Lift, der nur bis zum fünften Stock geht und so eng ist, daß er nur zwei Personen aufnehmen kann, die sich jeweils eng aneinanderpressen müssen.
Jeantôme ist gerade an Claire gepreßt. «Wie ist das Wetter oben?» Er deutet mit dem Daumen zur Decke.
«Na ja, etwas unbeständig», sagt Claire, die an Jeantômes Ausdrucksweise gewöhnt ist. «Leicht böig, mit Tendenz zu Niederschlägen.»
«Wieso? Läuft ihr Buch nicht?»
«Doch, doch! Aber die Kritiken sind nicht gerade berühmt.»
«Sofern man in dem Fall von ‹Kritiken› sprechen kann», sagt Jeantôme bissig. «Nach Ihnen …»
Sie lösen sich mühsam voneinander.
«Sie brauchen ihr nicht zu sagen, daß Sie mich getroffen haben», sagt Jeantôme zum Abschied.
Er läßt Claire auf dem Treppenabsatz zurück und steigt die Dienstbotentreppe hoch. Rasche Kontrolle in beiden Räumen – als ob er immer einen Einbruch zu gewärtigen hätte.
Und jetzt muß er mit seiner Buchbesprechung zum Ende kommen. Er trifft erneut die entsprechenden Vorbereitungen. Um sich in Fahrt zu bringen, schnappt er sich ein Exemplar der Seelen in Not, das er unter das eine Sesselbein geklemmt hat, und schlägt es auf gut Glück auf. Im selben Moment lacht er höhnisch auf. Selene verbreitete ihr unheilvolles Licht über den Erdball, liest er laut. Unglaublich … Und das ganze Buch ist so! Da, wieder eine Perle: Florence betrachtete die Nacht. Ein verspäteter Windstoß fegte eilends über die Felder … Ha! Dieser verspätete Windstoß! Das ist was für die Leserinnen in der finsteren Provinz. Und für die in Paris? Nichts! Oder doch? Vielleicht das da: Kleines Biest! brüllte der Lude. Du wirst noch parieren lernen! Oha, Achtung, meine kleine Valérie. Hat schon etwas Patina angesetzt, dieser Lude. Riecht nach deinen geliebten literarischen Vorbildern aus den Fünfzigern oder Sechzigern – einem Mac Orlan oder einem Carco …
Jeantôme klemmt das Buch wieder unter den Sessel, schraubt seinen Füllfederhalter auf und sieht voller Verwunderung die Feder übers Papier gleiten.
Mit dem ‹Barrier-Reef› hat Dutoit den Auftakt zu einem neuen Genre geschaffen: Die ‹Entdeckerlyrik› … Ein Satz gibt den nächsten. Fünfzehn Zeilen in zwanzig Minuten. Jeantôme traut seinen Augen nicht. Die Empörung, die er Myriam zu verdanken hat, die Wut und der Ekel, all das hat eben wie ein Doping auf ihn gewirkt. Oder eher … Myriam als Aderlaß, vielleicht ist das die Lösung?!
«NUN», SAGT DR. BRILLOUIN, «dann erzählen Sie mal!»
«Also, es ist so», fängt Jeantôme an. «Ich arbeite im Verlag Delpozzo. Von dort kenne ich eine Ihrer Patientinnen, Lucette Ripoche, die mir Ihre Adresse gegeben hat. Um es ganz kurz zu machen: Ich leide unter literarischer Impotenz.»
Der Arzt legt eine Karte vor sich auf den Tisch.